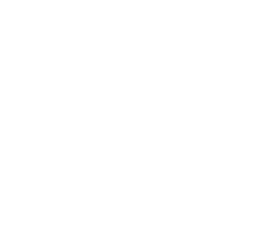Der falsche Trauring von Else von Steinkeller
E., den 1. Juli.
Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen –
Ja, und wenn er das Geld dazu hat, solche Reise zu tun, so wie ich. Ich heiße Lena von Sandten. Und dazu wirklich selbst verdientes Geld! Ein Jahr lang Unterricht gegeben an der Marienschule. Wozu hat man denn sonst sein Examen gemacht?
Und ganz nett war’s außerdem auch noch, das Lehrerin sein, bei all den niedlichen, kleinen Mädchen, die so an mir gehangen haben!
Also, ich habe gespart und gespart, und Papa hat noch hundert Mark dazugegeben – und nun sind wir so weit. Übermorgen wird abgereist – in die Schweiz – an den Vierwaldstätter See! –
Die Margot Wegener, meine beste Freundin, kommt mit. Die hat natürlich nicht zu unterrichten und auch nicht zu sparen brauchen. Die braucht nur ins volle Portemonnaie zu fassen. Wir beide nun also gänzlich ohne Aufsicht in die weite Welt. Wie das nur enden wird!
Mama findet es entsetzlich! Natürlich! Aber Papa sagt: „Recht so, immer selbständig sein! Alt genug bist du ja!“
Ich bin nämlich letzte Woche einundzwanzig Jahre alt geworden. Das gesetzliche Alter zum Selbständigsein. Und die Margot, die hat überhaupt Verstand für uns beide! So schön ruhig und „ausgeglichen“ ist sie! Ach, ich wollte, ich wäre auch so!
Den 3. Juli.
Um elf Uhr abends sollte unser Zug abgehen! Die Koffer haben die Burschen zur Bahn gebracht, dann sind wir hinterher gepilgert. Den Rucksack um, den Bergstock in der Hand!
Unser friedliches Städtchen hat natürlich schon fest geschlafen. Ein paar unsolide Bürger, die uns begegneten, haben erstaunt auf unseren Bergstock gesehen. Natürlich trugen wir den recht sichtbar. Papa sagt: „Protzig!“
Margots Vater hat uns eigentlich mit dem Auto zur Bahn schicken wollen. Ist aber empört von uns abgelehnt worden. Warum nicht gar im Aeroplan?
Diese geheimnisvolle Dämmerung und interessante Stimmung nun auf dem Bahnsteig! Wie der Zug so langsam einfuhr, und wie wir ins Kupee verladen wurden. –
All die guten Ermahnungen. Schreibt auch bald und frankiert richtig! Seid hübsch vernünftig! Adieu, adieu! Und fort ging es! Natürlich ist es ein Ferienzug gewesen! Kostet die Hälfte und ist das doppelte Vergnügen!
Jawohl! Ver-gnü-gen!
Wir haben wie die Heringe im Kupee gesessen. Darunter ein hoffnungsvoller Jüngling von elf bis zwölf Jahren mit einer ungemütlichen Mama.
Margot und ich hatten glücklicherweise Fensterplätze, aber trotzdem – an diese Nacht werde ich denken, und wenn ich hundert Jahre alt werde.
Ich habe das Schlafen versucht auf jede Art. Stehend, sitzend, seitlich angelehnt, vornüber mit dem Kopfe baumelnd – natürlich alles resultatlos. Den andern ist es nicht besser gegangen. Der einzige, der auf seine Kosten gekommen ist, war der hoffnungsvolle Jüngling. Der hat sich in schöner Bescheidenheit lang ausgestreckt, und sie „ungemütliche Mama“ hat seinen Schlummer verteidigt wie eine Löwin ihr Junges. Geschnarcht hat er auch noch!
Mich hat der Humor der Situation so überwältigt, dass ich alle Müdigkeit aufgegeben und nur noch beobachtet habe! Schlafen kann man schließlich zu Hause auch! Ein wundervolles Gewitter haben wir erlebt – die Sonne ging auf, die Gegend wurde immer schöner.
In Frankfurt-Sachsenhausen hielt unser „Zügle“ programmäßig!
Da sind die Menschen alle ausgestiegen, haben ihre Glieder gestreckt und dazu gegähnt. Himmel – wie haben sie ausgesehen! Morgenbeleuchtung ist nicht vorteilhaft für jedermann.
Schließlich haben sie angefangen, sich auf offenem Bahnsteig zu waschen und zu frisieren.
Einige verschämt und heimlich! Andre ganz ungeniert.
Die Margot und ich haben das Taschentuch ins Wasser getaucht und sind uns damit über das Gesicht gefahren. – Katzenwäsche!
Die Haarfrisur mit den Fingern ein bißchen zurechtgezupft, dreimal den Bahnsteig auf und ab gerannt, fertig waren wir!
Dann gab es Kaffee – auch frische Brötchen.
Und dann ging es weiter. Immer schöner ist die Welt geworden. Ich habe nichts getan, wie am Fenster gestanden.
Heidelberg haben wir gesehen, Berge, Burgen und Wälder. In der Ferne die Türme von Straßburg, die Vogesen!
Und dann der Rhein – der Rhein! Nicht der Vater Rhein, wie wir ihn kennen, nein, das Kind – der Jüngling! Aber der Rhein, trotz alledem!
Bald sind wir in Basel gewesen. Die Zollbeamten rückten an.
In schöner Ehrlichkeit hat die Margot eine Schachtel Zigaretten entlarvt und ich ein Paket Schokolade. Förmlich drängen taten wir uns, unser Geld loszuwerden.
Eine vornehme Handbewegung, ein ironisches Lächeln. – Die Zollbeamten verschwanden.
Wir sind unversteuert geblieben.
Mittag haben wir auf dem Schweizer Bahnhof gegessen, auf deutsch „Diner“.
Fleisch ohne Sauce, Kullerschoten, denen man mit der Gabel auf dem Teller nachjagt, bis man sie glücklich erwischt.
Und da am Nebentisch, da haben zwei Herren gesessen, wirklich nett haben sie ausgesehen. Die verwandten kein Auge von uns. Natürlich, weil die Margot so bildschön ist, denn nach mir sieht schon keiner. Aber peinlich war es doch.
Ob wir am Ende trotz des gesetzlichen Alters von einundzwanzig Jahren nicht würdig genug sind, allein zu reisen?
Da ist mir ein famoser Gedanke gekommen.
„Du, Margot,“ sagte ich, „was meinst du, wenn ich mich statt Fräulein von Sandten ‚Frau‘ nenne? Kennen tut uns hier niemand, und es gibt uns gewissermaßen einen würdigeren Anstrich!“ –
Margot hat gelacht, aber Spaß hat es ihr gemacht! Und weil sie doch auch ihre Maskerade haben wollte, und weil sie sich doch immer einbildet, daß alle Leute nur so hinter ihr her sind, ihres vielen Geldes wegen, will sie also von jetzt an als meine „arme Cousine“ und „Gesellschafterin“ mit mir reisen.
Wer es glaubt!
Jetzt bin ich neugierig, was daraus wird. „Verderben, gehe deinen Gang!“ würde Papa sagen.
In dem schönen, eleganten D-Zug, der uns von Basel nach Luzern fuhr, ist dann aber nicht viel mehr Zeit gewesen zum Pläneschmieden. Schöner und schöner ist die Welt geworden, höher und schroffer die Berge.
An alten Schlössern sind wir vorbeigekommen und an Dörfern mit echten „Schweizerhäuschen“. Immer von einem Fenster zum andern sind wir gelaufen, um ja nichts zu versäumen. Und dann plötzlich, bei Olten war es, wo die Bahn eine beträchtliche Höhe erreicht – ein Jubelruf: „Die Alpen!“
Da waren sie, fern, ganz fern, aber doch greifbar deutlich. Die Bergriesen Eiger, Mönch, Jungfrau, blendend im Schnee und klar bis zu den höchsten Gipfeln. Eine Beleuchtung dazu, wie sie kein Künstler schöner ausdenken kann.
Ich bin ganz verzaubert gewesen vor Freude!
Aber die Prosa des Lebens hat mich bald wieder mit beiden Füßen auf die Erde gestellt. Zunächste habe ich entdeckt, daß die beiden Herren vom Bahnhof in Basel mit im Zug waren, und dann haben wir, in Luzern glücklich angekommen, in rasender Eile unser Gepäck zum Dampfer spedieren und außerdem noch zum Juwelier stürzen müssen, um einen Trauring für mich zu besorgen. Ohne den geht es doch nicht! –
Nein, was der Mann aber für ein Gesicht gemacht hat, als ich einen wählte für zwei Mark! Ich habe den Handschuh nicht wieder angezogen – seinetwegen.
Dem Bergriesen Pilatus habe ich zuerst damit imponiert, und er hat schaudernd sein Haupt verhüllt, während wir mit dem schönen, weißen Dampfer „Unterwalden“, auf dem die Schweizer Flagge wehte, hindampften über den himmlisch schönen Vierwaldstätter See, nach dem Ort unsrer Bestimmung, dem kleinen B. am Fuße des Rigi.
Den 4. Juli.
Da sind wir nun! „Hotel und Pension Rigi.“ Stolz stehen wir im Fremdenbuch als „Freifrau“ von Sandten und Cousine, Fräulein Wegener. Ein paar Briefe habe ich schon vorgefunden und war zuerst doch recht erschrocken; dachte, die Fälschung meiner Frauenwürde würde gleich zu Anfang schon sich verraten, aber den Unterschied zwischen Freifrau und Freiin kennen die guten, braven Leute hier im Hotel nicht, und so scheint sich das Theaterstück ganz gut einzuleiten.
Margot markiert die „arme Verwandte“ auch wirklich ganz waschecht, nämlich mit Batistblusen, die sie allerdings vorzüglich kleiden. Zwei hübsche Zimmerchen mit Balkon haben wir nebeneinander im zweiten Stock. Viel Möbel sind nicht darin, nur gerade das, was man zum Leben braucht. Aber sauber sind sie, hell und freundlich! Ach, und der Blick aus den Fenstern. Gar nicht zu beschreiben, so schön, so einzig schön!
Nach vorn zu über ein Stückchen Straße und ein paar mit Maulbeerbäumen beschattete Verkaufsbuden fort der See, die Dampferanlegestelle und der Bahnhof der Rigibahn. Mitten im See, wie ein schwimmendes Felseneiland, der Bürgenstock, über den kokett ein rosa angehauchtes, ganz kleines Spitzchen des Bergriesen Pilatus sieht.
Aus einem Seitenfenster blicken wir mitten in die grüne Wildnis der Berge. Der Rigi mit seinem Vorbergen, das Stauferhorn, das Buochshorn, über allem thronend der schneebedeckte Uri-Rothstock in seiner eigenartigen Form. Beinahe wie ein kolossaler Backzahn sieht er aus. Und dann der blaue Himmel, und zu meinen Füßen der liebliche Villenort B., grüne Matten und Blumen, lachende Gesichter und frohe Menschen überall!
Wie ich heute früh aufgewacht bin, habe ich gedacht, ich wäre mitten im Märchenland. Eilig habe ich mich angezogen, die Zöpfe nicht einmal hoch gesteckt, und so bin ich heruntergehuscht zum See. So grün war er, so klar wie ein schönes Menschenauge, so wundervoll. Eine Farbe, wie ich sie nie gesehen habe!
Und soviel Fischchen spielten in der Sonne!
Von Luzern her kam ein Dampfer. Die Menschen darauf winkten mit Tüchern, und ich habe dieses Winken natürlich lustig erwidert.
Dann legte der Dampfer an, und plötzlich standen die beiden Herren aus Basel neben mir.
„Sieh, Karl-Heinz, hier grüßt uns eine Nixe vom Vierwaldstätter See!“ sagt der eine.
Ich bin ganz rot geworden!
Da haben sie ihre Hüte abgenommen und mir „Guten Morgen“ gewünscht.
„Guten Morgen!“ sagte auch ich. Warum sollte ich nicht höflich sein? Sie haben beide so nett ausgesehen – besonders der eine, der mit „Karl-Heinz“ angeredete Herr. Der hatte so lustige, lebhafte, braune Augen!
„Gnädiges Fräulein, gestatten Sie, daß wir uns nun endlich nach so langer Bekanntschaft vorstellen! – Graf Eck, Attaché bei der Gesandtschaft in Bern, und hier mein Freund, Hauptmann von Reimer vom Großen Generalstabe!“
„Lena von Sandten!“ habe ich absichtlich kühl geantwortet.
Aber ehrlich gestanden – ich bin doch recht verlegen gewesen – weiß ich auch nicht, ob das so richtig war, daß ich meinen Vornamen genannt habe, aber die „Freifrau“ hat mir den bezaubernd schönen, braunen Augen gegenüber nicht über die Lippen gewollt. Nur die Hand mit dem Trauring habe ich auf die Mauer gelegt.
Sie sind auch gleich darauf hereingefallen und haben mich immer umschichtig mit „gnädige Frau“ und „Baronin“ tituliert, was mir glatt herunterging.
Wirklich ganz nett haben wir uns unterhalten, alle drei, und so, als ob wir schon seit hundert Jahren bekannt wären. Aber mir ist denn doch auf das Gewissen gefallen, daß sich das alles eigentlich gar nicht schickte, und ich habe endlich so einen kleinen, würdigen Gruß gemacht und bin ihnen davongelaufen, um der Margot die Geschichte zu erzählen. Warum ist sie auch als meine „Gesellschaftsdame“ nicht dabei, wenn ich Abenteuer erlebe?
Den 5. Juli.
Ich muß doch unsre „Pension Rigi“ schildern. Groß ist sie ja nicht, kein Fremdenhotel im landläufigen Sinne, aber sie hat es in sich. Ich bin wenigstens entzückt von allem, und sogar Margot, die doch sonst von ihren Reisen nur das Großartigste gewöhnt ist, scheint zufrieden zu sein.
Der Besitzer, „Pensionswirt“ genannt, macht einen sehr respektablen Eindruck. Er trägt einen Gehrock und stellt bei Tisch die Suppe auf. Seine Gattin hat die Frisur im griechischen Knoten arrangiert – leider aber ist dies das einzig Griechische an ihr.
Dann ist da noch „Adolphe“ (Miphe), der Hausdiener. Madame Josephine, so eine Art Beschließerin, wundervoll alt, weißhaarig und appetitlich. Außerdem eine Galerie mehr oder weniger hübscher Kellnerinnen, „Sekttöchter“ nennt man sie hier. Alles spricht einen schwer zu enträtselnden Dialekt. Aber trotz all dieser Unverständlichkeit – es sind freundliche, nette, liebe Menschen.
Ich mache mich nach allen Himmelsrichtungen populär. Mit Handbewegungen, Zeichensprache respektive drahtloser Telegraphie komme ich ganz gut durch.
Und wie man hier gedeiht. All die Fröhlichkeit, das Nichtstun, das gute Essen. Förmlich gemästet wird man. Es sind auch wirklich nur nette Menschen hier, allerdings eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft. Neben soliden Offizier- und Beamtenfamilien auffallende, übermäßig moderne Ausländerinnen und diverse recht interessante Junggesellen!
Letztere wechseln häufig. Nur einer scheint seßhaft zu sein, „in Pension“ wie wir. Er ist Berliner.
„J. H. Freese, Berlin, Harzerkäse en gros.“ So hat er sich mir vorgestellt.
Ich gehe ihm möglichst aus dem Wege, obgleich er sehr komisch wirkt.
Überhaupt haben wir uns bis jetzt nur einer Geheimratsfamilie Scheffer aus Stuttgart näher angeschlossen, die mit drei netten Jungen mit uns auf einem Flur wohnt.
Einen großen braunen Dobermannhund haben sie. Ein Prachtexemplar, aber ungezogen.
„Weißt du, Frau Sandten,“ sagt Karlchen, der jüngste der Scheffer-Buben zu mir, „unser Hund, das ist sehr ein gescheiter Hund, der kann dir alles. ‚Schön‘ machen und ‚bitte, bitte‘, und auf den Hinterfüßen tanzen und alle Türen aufmachen und alles Verlorene suchen, auch Spitzbüberei!“
„Warum nehmt ihr den Hund aber mit auf Reisen?“
„Ja, schau, weil er zu Haus nix als Unfug angeben tut, wenn er allein bleibt. So ein gescheiter Hund ist er!“
Nun bin ich neugierig, was dieser „gescheite Hund“ hier in der Pension noch anstellen wird.
Den 6. Juli.
Wie die Sonne scheint! Wirklich beinahe italienische Sonne ist es. Ich bin mit meiner Schreiberei auf dem Balkon beinahe gebraten und wieder ins Zimmer gezogen. Am offenen Fenster ist es besser.
Die Margot schreibt auch, Briefe natürlich. Vormittags haben wir eine Kraxeltour gemacht, oder, besser gesagt, „machen wollen“ auf die „Wissifluh“!
„Ein bequemer, angenehmer Vormittagsspaziergang!“ steht in unserem Reiseführer.
Also wir mit Lackschuhchen! Durch das Dorf ging es ja so allenfalls, aber dann steil, hoch! Steine, Geröll, links die Berglehne, rechts der Abhang. Grüne Matten, hier und da Tannen und Buschwerk, und alle zwanzig Schritt ein Nußbaum. Hier gibt’s nämlich unendlich viele Nußbäume.
Nach halbstündigem Klettern sind wir denn auch unter einem solchen gestrandet. Ein Prachtexemplar! Weit, weit breitete er seine Äste aus. Ein großer Stein als Bank darunter.
„Auf diese Bank von Stein will ich mich setzen!“ deklamierte ich und zog den linken Schuh aus, weil ich ein Steinchen darin hatte.
Margot war halbtot vor Erschöpfung.
Entsetzt sieht sie hoch! Wie eine steile Wand liegt es noch vor uns, und da oben, ganz, ganz oben – die „Wissifluh“.
„Brr! Und das in Lackschuhchen!“
„Weißt du, Lene, wir gehen nicht weiter!“ schlägt sie vor.
Ich war natürlich einverstanden. Schöner wie hier kann es ja auch wohl nirgend sein. Unter uns liegt B. und der blaugrüne See, und über den Bürgenstock grüßt der Pilatus, rosig überhaucht und mit einem kleinen Wölkchen am Gipfel. Es sieht immer aus, als ob er raucht.
„Guten Morgen!“
Zwei Panamahüte werden geschwenkt.
Natürlich, da sind sie wieder, die ich längst über alle Berge wähnte. Die beiden Gesandschaftsattachés aus Bern.
Ich stelle vor, und wir gruppieren uns so lieblich wie möglich. Graf Eck zu meinen Füßen, der Hauptmann von Reimer zu Margots.
Nein, was die immer ruhig und sicher ist!
Beneidenswert!
Jede Situation beherrscht sie. Ich werde grundsätzlich verlegen, ärgere mich darüber und werde natürlich nur noch verlegener.
Scheußlich! Kommt jedenfalls davon, wenn man unter falscher Flagge segelt.
Übrigens, Graf Eck ist wirklich recht sympathisch! Nur immer die bildhübschen Augen, die mich so lieb und zutraulich ansehen.
„Ich kenne alle Sandtens, gnädigste Frau,“ sagt er, „nur den von den Xer Kürassieren nicht. Wer ist denn nun Ihr glücklicher Gatte?“
Himmel, diese Frage!
„Natürlich der von den Xer Kürassieren!“ lüge ich kühn und drehe an meinem Trauring.
„So?“
Er zwirbelt sein Bärtchen hoch und sieht mich an.
„Wie kann man solche Frau allein in der Welt umherreisen lassen!“
„Bitte, warum nicht, ich bin doch mündig!“ –
Wir sind dann zusammen in schöner Eintracht heruntergeklettert, was mit unserm Schuhwerk noch weniger pläsierlich war wie das“Auffikraxeln“. – Ein Glück, daß wir zwei Ritter hatten! Die haben uns geholfen, uns unten im Dorf auch gleich zum Schuhmacher geschleppt, wo wir „Bergstiefeln“ gekauft haben. Mit genagelten Sohlen! Pikfein!
Nachher bei Tisch habe ich meinen Spaß gehabt, weil die Scheffer-Familie nach allen Seiten hat um Entschuldigung bitten müssen wegen ihres „gescheiten Hundes“. Das liebe Tierchen hat heute früh im Korridor einen wahren Hexensabbat losgelassen, indem er sämtliche vor den Türen stehenden Schuhe „durcheinanderg’schmissen“ hat, um mit Karlchen zu reden. Die Schuhe sind dabei gegen die Türen geflogen, so daß die ruhig schlummernden Hotelgäste jäh geweckt worden sind.
Nachher wollen wir nach Weggis. Das liegt etwa eine Stunde Spazierweg in der Richtung auf Luzern zu. Scheffers wollen uns mitnehmen.
Ist mir auch ganz angenehm, man kann doch nicht wissen, vielleicht trifft man wieder jemand.
Da unten auf der Straße gehen eben der Reimer und Graf Eck vorbei. Alle Fenster sehen sie ab. Ob sie wohl hereinkommen? Ich muß doch sehen – nein – sie gehen vorbei.
Den 7. Juli.
Wir sind also gestern nachmittag in Weggis gewesen. Aber wie! –
Ich sag’s ja, wenn ich was unternehme, endigt es allemal mit Abenteuern. Heute bin ich aber unschuldig daran gewesen, die Scheffer-Jungen haben für die Erlebnisse gesorgt.
Die armen Bengels! Behauptet doch ihre Mutter, sie sähen elend aus, und hat einen Arzt aufgesucht, der hat ihnen eine Sahnenkur verordnet.
Mutter, natürlich begeistert, füttert sie nun fanatisch mit sterilisiertem Schweizer Alpenrahm! So dick ist das Zeug, daß der Löffel darin steht, elend kann einem werden, wenn man es nur sieht. Mutter Scheffer bleibt aber ungerührt. In schönem Pflichteifer gibt sie ihren Buben die Flasche mit Gewalt, wenn sie sie nicht gutwillig nehmen.
„Weißt du, Frau Sandten,“ sagt Karlchen, „mich freut rein nix mehr, kein Honig und kein Kuchen, alles schmeckt wie Rahm. Paß auf, es wäre der Mama ganz recht, wenn ich explodieren täte!“
Damit hängt er sich an meinen Arm, und wir marschieren los. –
Vornweg Vater, Mutter und die Margot, und ganz vorn, wo man sie meist nicht sieht, der Fritzel und der Franzel mit dem „gescheiten Hund“.
Ist das aber heiß! Aber schön! Ganz südliche Vegetation wird es, je weiter wir nach Weggis kommen. Sogar Feigenbäume, Kastanien und Magnolien mit wundervollen Blüten. Ich sehe mich entzückt um, hole tief Atem und – genieße. Selig bin ich, wie gewöhnlich! Nichts sehe und höre ich mehr als die himmlische Natur, nichts fühle ich als die weiche Luft und die Sonne, die mich braun brennt.
Oder nein, ich fühle doch sonst noch etwas – Karlchen! Wie schwer hängt der Junge an meinem Arm, förmlich schleppen muß ich ihn.
Ich versuche, seine kleine, braune Patschhand von meinem Arm loszumachen, dabei sehe ich ihn an.
Ganz elend sieht er aus. Grade noch kann ich ihn in den Schatten einer Kastanie ziehen – Karlchen hat es vorhergeahnt – er explodiert! Es ist seiner Mama ja ganz recht! Wo sind die glücklichen Eltern?
Da, da vorn, an der Wegbiegung, da, beim ersten Häuschen von Weggis, ebenso beschäftigt wie ich, denn auch der Fritzel und der Franzel – schweig still, mein Herz! – Die Alpensahne ist beim Marschieren zu Butter geworden.
Pech für die Familie.
Laut brüllend halten wir unseren Einzug im feinsten Kaffeegarten, und während Geheimrats andauernd mit ihren verbutterten Sprößlingen beschäftigt sind, und während der „gescheite Hund“ neben dem Familienereignis sitzt und „bitte, bitte“ macht, erquicken Margot und ich uns an den Genüssen besagten Kaffeegartens.
Genüsse? – Der schönste Genuß ist doch der Pilatus. Hier sehen wir ihn nun in seiner ganzen majestätischen Erhabenheit – wie ein Märchenbild im Glanz der Abendsonne.
Ob ich nicht dichten kann?
Unsinn!
Jedes Menschenwort kann dieser Herrlichkeit nur schaden.
Zurück sind wir mit dem Dampfer gefahren. Alle nach rückwärts zu über Bord hängend. Die Scheffer-Jungen aus praktischen, wir aus andern Gründen.
Den 8. Juli.
Wir haben heute den ganzen Morgen mit dem „Eck“ und dem Reimer verbummelt mit Kraxelei auf die benachbarten Almen. Diesmal fein, mit Bergstock und genagelten Stiefeln. Graf Eck meint, ich hätte alle Anlage zur Hochtouristin. Ich weiß nicht recht, ob er das ernst meint, man wird aus seinen wundervollen braunen Augen nie klug.
Etwas unsicher bin ich wieder gewesen, ob sich das auch schickt, daß wir so mit den beiden Herren ganz allein umherspazieren, aber die Margot ist ganz ruhig. Sie hat ihnen begreiflich gemacht, daß „Scheffers sich sicher freuen würden, die Herren auch kennen zu lernen“, und daß Scheffers sehr nette Leute sind!
Den Wink haben sie verstanden und sind mit in das Rigi-Hotel gekommen und Scheffers vorgestellt worden. Gleich haben wir dann zu morgen eine Dampferpartie verabredet. Der Geheimrat hat auch noch verwandtschaftliche Beziehungen zu Herrn von Reimer herausgefunden.
Also alles ist nun im schönsten Schick.
„Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr!“
Ganz gut könnte ich nun jetzt auch unverheiratet sein! – Ich weiß nicht, manchmal denke ich sogar, es wäre netter. Aber da ist nun nichts daran zu ändern. Ich kann mich so plötzlich doch nicht – scheiden lassen. Ich habe ja auch gar keinen Grund dafür. Wer das bloß alles hätte vorherahnen können! Nein – es ist doch zu dumm!
Den 9. Juli abends.
Es ist schon zehn Uhr, und eigentlich müßte ich nun wohl schlafen gehen, aber ich finde doch keine Ruhe. Erst muß ich diesen himmlischen Tag beschreiben. – Vormittags haben wir uns geschont, sind nur zwanzig Schritte weit in das Wäldchen gegangen und haben uns da aufgehängt mit den Hängematten und gelesen. Aber dann nach dem Essen Hut und Sonnenschirm geholt und los! An der Dampferhaltestelle haben unsre beiden Herren schon gewartet, mit einem Busch roter Nelken „für die Damen“, wie Hauptmann Reimer bemerkte. Er hat ganz übermütig ausgesehen, und die Margot ist rot geworden, ich habe es deutlich beobachtet. Wie es scheint, mag sie den Reimer gern, wenigstens hat sie immer so glückliche Augen, wenn er sie ansieht. Er ist auch wirklich ganz nett, ein bißchen feierlich und tugendhaft, aber so etwas gefällt ihr vielleicht gerade. Also, wir waren lustig! Und das Wetter war so himmlisch, Sonne, Licht und Wärme überall, ach, und die Farben hier am Vierwaldstätter See! Wie das Wasser aufspritzte am Dampfer! Grüngoldene Funken im Sonnenschein!
Wir haben zusammengesessen und sind froh gewesen, wenn wir auch wenig geredet haben!
Jeder ist mit andachtsvollem Schauen beschäftigt gewesen, hat höchstens die andern mal aufmerksam gemacht auf etwas besonders Schönes!
Vorbei sind wir gekommen an Gersau, an Beckenried, dann Treib mit dem schönen Schweizerhaus, am Rütli und Seelisberg. Dann das alte, historische Dorf Brunnen! Großstädtisch! Eine Reihe steifer, eleganter Hotels am Kai, dahinter die Mythen! In ihrer schroffen Form und eigenartigen Färbung erregen sie unser Entzücken. Enger wird der Vierwaldstätter See, steiler und höher die Felswände. Wir sehen den Axenstein und den Frohnalpstock zu unsrer Linken, während rechts immer großartiger der Gipfel des Uri-Rothstock hervorkommt.
Ein Andenken an Schiller, der Schillerstein: „Dem Sänger Tells. Die Urkantone.“
Weiter aufwärts hält unser Dampfer an der Tellsplatte. Da sind wir ausgestiegen und haben die Kapelle besichtigt, und dann ist ganz allmählich, nach aller Poesie, das alltägliche Leben wieder in seine Rechte getreten.
Das heißt, bei der Margot und dem Reimer konnte man das eigentlich nicht behaupten, sie haben ganz verklärt ausgesehen. Und mit mir war auch irgendwas los. Ich weiß noch nicht recht was. Ganz komisch war mir. Kann sein, daß mich die Naturschönheiten so mitgenommen haben.
Graf Eck hat mich so von der Seite angesehen. Ich glaube, ich bin rot geworden.
„Denken Sie jetzt an Ihren Gatten?“ fragte er mich.
„Mein Gott, lassen Sie mich doch mit meinem Gatten zufrieden!“
Das ist mir so herausgefahren – hinterher habe ich mich natürlich recht geärgert.
Aber ist es auch wohl nötig, daß mir dieses Phantom allen Spaß verdirbt?
„Es ist ihm schon recht, ‚meinem Gatten‘, daß ich mich ohne ihn so gut amüsiere.“
Graf Eck hat ein ganz entsetztes Gesicht gemacht und mich noch mehr von der Seite angesehen. Ich wurde immer röter. Ordentlich gefühlt habe ich es, daß ich schon aussah wie eine Feuerlilie. Und so furchtbares Herzklopfen hatte ich plötzlich, vermutlich von dem steilen Weg, der zum Restaurant führt.
Wenn Graf Eck doch nur ein vernünftiges Wort geredet hätte. Aber rein nichts hat er gesagt, nur immer im Vorbeigehen Blätter von den Sträuchern gegriffen und dabei geseufzt.
Schließlich konnte ich es nicht mehr aushalten.
„Warum seufzen Sie denn so herzbrechend?“ frage ich.
Das sieht er mich ganz ernst an und sagt:
„Weil die hübschesten Mädel immer schon verheiratet sind, wenn ich sie liebe!“
Also Liebeskummer!
Eigentlich dumm für einen erwachsenen Menschen.
Aber ich habe ihn doch trösten wollen und ihm die Hand gegeben. Das hat er falsch verstanden und hat sie – es war die mit dem Trauring – geküßt.
Dreimal hintereinander! Ist mir noch nie passiert!
Leider sah es gerade beim drittenmal der Geheimrat, der hinter uns herkam.
Hat der ein Gesicht gemacht! Ordentlich vorwurfsvoll!
Und nachher beim Kaffee habe ich eine Ansichtskarte an „meinen Mann“ schreiben müssen. War das ein Elend! So an einen Menschen, den man noch gar nicht kennt.
„Herrn Major Freiherr von Sandten in H. Es küßt Dich tausendmal Deine immer treue Lena.“
Nun kam es schon nicht viel darauf an, was ich schrieb. Je toller, je besser! Ordentlich ist der Übermut über mich gekommen. Mochte der alte Knabe in H. doch auch einmal einen Spaß haben.
Der Geheimrat hat dann auch wieder freundlicher ausgesehen. Alle haben sie unterschrieben, und dann ist die Karte in den Kasten gesteckt worden.
Aber soviel ich weiß, heirate ich nie! Wenn man schon solche Aufregung hat mit einem Ehemann, der für einen noch nicht einmal existiert, wie mag das erst sein, wenn man einem wirklichen angetraut ist! Unenedliches Mitgefühl habe ich mit euch, ihr armen Frauen! Wirklich, ich fühle euch nach, wie ihr immer und ewig „unverstanden“ seid, und wie ihr alles versucht, euch von der Tyrannei der Männer zu befreien.
Ganz nachdenklich bin ich gewesen. Aber, Gott sei Dank, solche Stimmung hält nicht lange bei mir an, und Graf Eck hat glücklicherweise auch wieder ein lustiges Gesicht gemacht, und der Appetit hatte unter all den Seelenqualen auch nicht gelitten. Tüchtig haben wir gegessen und sind dann rüstig weitermarschiert, hinein in die Axenstraße.
Gott weiß, warum ich so gefühlsselig bin!
Die Schönheit, die wir jetzt zu sehen bekommen, hat mich tief ergriffen.
Wenn ich doch nur malen könnte! Alles, alles festhalten, all die himmlischen Farben, und alles mitnehmen. Aber wenn man malen kann!
Rein toll muß man doch hier werden vor all den Motiven, die sich einem aufdrängen.
Ob wohl andre Menschen auch so lebhaft empfinden wie ich? –
Ich glaube es nicht!
Die Geheimrätin wenigstens hat an der wundervollsten Stelle ihre Buben gerüffelt, weil sie soviel Allotria mit dem „gescheiten Hund“ getrieben haben – er, der Geheimrat, hat den „Radetzkymarsch“ gepfiffen, und die Margot hat sich mit Hauptmann Reimer über Luftschiffe unterhalten. Ob sie gerade sehr bei der Sache waren, weiß ich nicht. Was tue ich auch mit der Luft, wenn die Erde so schön ist!
Was Graf Eck gedacht hat, möchte ich wissen. Er sagte nichts, und ansehen mochte ich ihn auch nicht wegen seiner „verflixten“ Augen und wegen seines Handkusses.
Endlich sind wir auch in Flüelen gewesen, da hat er ein Sträußchen Alpenveilchen vom Axenstein für mich gekauft. Die andern lachten immerzu, aber zum erstenmal in meinem Leben konnte ich dabei nicht mitmachen! Merkwürdig, wie ich zu so einem ganz unnormalen Zustand komme! Sicher ist das auch von dem dummen „Verheiratetsein“. Nun habe ich die Sorgen – habe noch keinen Mann und doch schon soviel Sorgen!
Den 11. Juli.
Natürlich, das dicke Ende mußte ja nachkommen. Gestern habe ich den ganzen Tag mit rasendem Zahnweh gesessen.
Die Margot war wie im Traum, machte mir immer ihre dunklen, glücklichen Augen und sah interessiert den Weg zum „Luzerner Hof“ hinunter, wo „er“ wohnt, aber niemand war zu sehen! Aber so sind die Männer! Wenn es einem gut geht, sind sie da, und sitzt man im Elend, dann drücken sie sich.
Mein Zahn ist auch immer schlimmer geworden, alle haben sie an mir herumkuriert; einer mit heißem Kamillentee, der andre mit Eisumschlägen. Gehorsam habe ich alle Mittel abwechselnd gebraucht, denn einen Zahnarzt gibt es hier nicht, nur einen Tischler, der nebenher – Zähne zieht. Mit vier bis sechzehn Aspirintabletten war ich dann glücklich so total bewußtlos, daß ich in der Nacht zwei Stunden geschlafen habe. Heute um fünf Uhr bin ich aber schon aufgewesen, um in aller Herrgottsfrühe mit dem ersten Dampfer nach Buochs zu fahren, wo der Sage nach ein „Dentist“ leben sollte. Ein Frachtdampfer war dieser erste Dampfer. Außer mir noch eine Herde Hammel und Kühe darauf.
„Bu-ochs!“ sagten die Kühe.
„Bu-ochs!“ stöhnte ich.
Aber mein Zahn ist nach einer heftigen Sitzung ohne Chloroform, Lachgas oder auch nur „örtliche Betäubung“ erledigt worden.
Persönlich habe ich ihn in den See versenkt.
Wie das Dorf Buochs aber auch reizend ist! Ich bin noch eine Stunde darin umhergelaufen, oder besser geklettert, in den engen, steilen Gassen. Auch in ein uraltes Schweizerhäuschen bin ich gegangen. Zwei niedliche Kinder waren allein zu Hause. Das eine in der Wiege, das andre, vielleicht vierjährig, als Aufsicht daneben. Ganz oben über dem Dorf auf einem Plateau liegt die für den kleinen Ort merkwürdig große und schöne Kirche. Mitten auf dem Kirchhof liegt die Kirche; wie eine Henne ihre Küchlein, so behütet sie ihre Toten. Hier am Vierwaldstätter See ist es überall so, eine schöne Sitte und ein schöner Gedanke.
Lebe wohl, kleines Buochs! Wenn der „Dentist“ nicht der Grund unsrer Bekanntschaft gewesen wäre, hättest du mir sehr gefallen. –
Ja, und was ich sagen wollte! Wenn der Tag schlecht anfängt, pflegt es so weiter zu gehen.
Nach Tisch sind Reimer und Graf Eck gekommen, um Adieu zu sagen.
Die Margot ist ganz blaß geworden und hat sich an der Stuhllehne festgehalten. Ich habe den Kopf hintenübergeworfen und „viel Vergnügen“ gewünscht.
Sie haben eine Depesche aus Bern bekommen. Diplomatische Verwicklungen, glaube ich! Na, ob Graf Eck die gerade entwirren wird!
Hauptmann Reimer will übrigens in acht Tagen wiederkommen. Graf Eck „weiß nicht, ob er kommen darf“.
Er hat mich dabei so ernst angesehen.
Ich habe die Achseln gezuckt. Meinetwegen kann er tun und lassen, was er will. Was geht es mich an!
Ich schreibe dies jetzt hier am Abend, während Margot schon schläft. Vor mir stehen die Alpenveilchen vom Axenstein, immer noch frisch und schön! –
Ach was! Unsinn! Lena, Kopf oben behalten und sich nicht unterkriegen lassen. „Ertragen muß man, was der Himmel sendet!“
Den 18. Juli.
Sie sind fort, lange, lange, und ich habe tagelang nichts in mein Buch geschrieben, weil wirklich nichts Besonderes passiert ist. Wir haben gelebt, wie eben alle Pensionsgäste hier leben. Gegessen, getrunken, die Aussicht bewundert, zum See gelaufen, Fische gefüttert und in der Zwischenzeit auf die Almen in der Nähe geklettert oder mit einem Buch im Gras gelegen.
Der „J. H. Freese“ hat sich unsre Verlassenheit zunutze gemacht und sich an uns herangedrängelt. Er ist mit seinem „Tell-Klaps“ wirklich zum kranklachen, und da uns Erheiterung not tat, haben wir ihn einmal zum Spaziergang mitgenommen. Er hat seinen besten lila Schlips dazu angetan und Glacéhandschuhe und hat die Augen verdreht.
Als wir an einem schönen Aussichtspunkte angekommen waren, hat er plötzlich mit der Faust auf seine schön gestärkte Hemdenbrust geschlagen und angefangen, den Monolog aus dem „Tell“ zu deklamieren. Gleich am Anfang kam er aber nicht weiter, sondern blieb schon an der Stelle: „Hier vollend‘ ich’s, die Gelegenheit ist günstig!“ elendig stecken.
Ganz rot ist er geworden!
„Hier vollend‘ ich’s, die Gelegenheit ist günstig!“ schreit er noch einmal, schlägt sich wieder gegen den Serviteur und sieht dazu die Margot so vielsagend an!
Er sucht nämlich eine Frau, wie er mir anvertraut hat, und so nett die Margot ist – ich weiß wirklich nicht, ob sie sich für „Harzerkäse en gros“ eignet.
Das gute Geschöpf! Richtig hat sie ihn mit seinem Monolog noch auf den Zug gebracht, dann meinte sie aber ganz ruhig und freundlich, wir hätten nun leider keine Zeit mehr, ihm weiter zuzuhören. Fort waren wir! –
Jeden Dampfer nach Luzern nehmen wir jetzt unten an der Haltestelle ab und prüfen ihn auf seinen Inhalt. Ich bin sicher, sie erwartet den Reimer. Er ist aber bis jetzt nicht gekommen – nur ein Schächtelchen Edelweiß hat er ihr geschickt.
Ich erwarte niemand, und mir schickt auch niemand etwas. Ist aber auch so ganz gut! Ich habe noch an meinen Aplenveilchen genug. Der Einfachheit halber werde ich sie jetzt lieber pressen. Man kommt doch ordentlich zur Ruhe und Vernunft beim Alleinsein. Selbst mein „ferner Gatte“ fällt mir weniger auf die Nerven. Nur mit dem Trauring ist es ein Kreuz! Er setzt schon Grünspan an.
Ich mußte mir Putzpomade kaufen, damit bekomme ich ihn sicher wieder blank.
Schrecklich, wenn man das einzige, was man von seinem Eheglück hat, mit Putzpomade bearbeiten muß. Ich kann mir jetzt vorstellen, daß man in Lebenslagen kommen kann, wo man genötigt ist, den Trauring im Portemonnaie zu tragen. –
In unsrer Pension sind viel neue Gäste angekommen, aber nichts, um besonders warm zu werden. Zwei Brüder Klitt aus Eisenberg i. Sa. erfreuen uns allabendlich durch den Gesang lieblicher Lieder, ebenso sorgt ein Konservatoriumsprofessor für unsre musikalische Bildung.
Eine Menge Engländer und Franzosen sind hier, im Gegensatz dazu dann wieder der ganz solide „Herr Pieper aus Labes in Pommern“, der so schnarcht, daß man es zwei Zimmer weit hört.
Ich gebe mich jetzt, wo ich Zeit zu einsamen Spaziergängen habe, auch viel mit den „Eingeborenen“ ab. Ihre Landessprache verstehe ich so ziemlich, und sie verstehen mich. Besonders die Kinder – die sind hier zu süß. Fast alles blonde Lockenköpfe mit dunklen Augen.
Übrigens hat mir die Geheimrätin heute eine Rede gehalten des Inhalts, daß ich blaß aussähe, und daß sie – meinen Mann nicht begreifen könnte, weil er mich hier so allein läßt.
Nun, ich habe ihn schon lange nicht begriffen – diesen Mann! Und einen andern begreife ich auch nicht, und mich selbst schon am wenigstens! Jedenfalls will ich mich von jetzt aber mal öfters in die Backen kneifen, damit ich nicht wieder Mitleid errege wegen allzu großer Blässe. Ich habe mich in meinem Leben nie bemitleiden lassen, weil ich es zu gräßlich fand – jetzt tue ich es nun schon gar nicht!
Den 20. Juli abends.
Es hat sich so viel und so Absonderliches ereignet, daß ich wieder einmal die Nacht zu Hilfe nehmen muß, um alles niederzuschreiben. Verloren gehen von meinen Erlebnissen darf doch nichts, schon allein aus dem Grunde, daß meine Enkel und Urenkel nach meinem frühzeitigen Tode ihren Spaß an diesem Tagebuch haben sollen. Aber genug der Zukunftspläne! Bleiben wir vorläufig bei der Gegenwart.
Früh, als die Margot und ich noch am Frühstückstische saßen, ist – Reimer gekommen. Allein, natürlich. Er hat ein strahlendes Gesicht gemacht, und die Margot auch, so daß ich mir sehr überflüssig vorgekommen bin und mich bald gedrückt habe. Sie haben mich auch nicht weiter zum Bleiben genötigt, und ich bin wieder mal ein Endchen hochgekrabbelt auf dem Wege zur „Wissifluh“. Gerade bis unter den großen Baum, wo ich die Aussicht auf den Pilatus hatte.
Schön war es, wie immer, aber ich hatte so tolles Kopfweh. Es hat dann nicht lange gedauert, da sind zwei den Weg heraufgekommen – Arm in Arm. Die Margot und der Reimer. Strahlend!
Die Margot ist rot geworden, wie sie mich gesehen hat.
„Du, Lena, wir haben uns verlobt!“
Er küßte mir die Hand und stammelte irgend etwas ganz Unorthographisches! Wie selig er ist, daß die Margot ihn liebt – so ungefähr lauteten seine Worte.
Habe ich mich aber gefreut! All mein Kopfweh ist vergangen.
Die Margot war wie ausgetauscht. Und er – so zärtlich und aufmerksam und verliebt. Gar nicht mehr feierlich und ernst wie sons waren die beiden.
„Wir werden uns sehr einrichten müssen mit dem bißchen Vermögen, das ich habe, aber wenn wir uns nur liebhaben, wird es schon gehen!“ sagte er und zog die Margot an sich.
„Laß nur, Kurt, es geht sicher, eine Kleinigkeit habe ich ja auch!“ flüsterte sie.
Der Strick! Die zwei bis drei Millionen nennt sie eine „Kleinigkeit“! –
Wie glücklich sie ist! Dieser da, „ihr Kurt“, hat sie doch nun wirklich nicht ihres vielen Geldes wegen geliebt.
Und ich bin ganz stolz. Eigentlich habe ich doch durch meine kühne Idee dies Glück begründen helfen! So ist unsre Mogelei doch etwas sehr Schlaues gewesen! Denn, wie der Reimer ist, in eine Millionärin hätte er sich vielleicht nicht verliebt.
Ob die Mogelei, soweit sie meine Person betrifft, auch etwas Schlaues ist?
Sicher!
Mittags haben wir die Verlobung der „Pension Rigi“ verkündet und auf das Wohl des Brautpaares etliche Flaschen Asti spumanti geleert.
Danach sind wir noch fröhlicher geworden, ich besonders. Der Geheimrat hat eine Rede gehalten, und der J. H. Freese hat zum erstenmal nichts mehr aus dem „Tell“ zu deklamieren gewußt.
Weil wir doch nun nicht den ganzen Nachmittag unter dem staunenden Publikum verbringen wollten, haben wir uns mitsamt der Scheffer-Familie auf die Rigibahn gesetzt und sind abgedampft nach Rigikulm!
Wie doch das arme, kleine Lokomotivchen, das unsern Wagen schob, keuchte und stöhnte bei dem schweren Weg. Ordentlich leid konnte es einem tun!
Aber schön ist die Aussicht gewesen! Kein Wölkchen am Himmel! Oder doch? Da hinten, jenseits des Sees und des Pilatus steigen Wolkenberge empor. Merkwürdige Wolken mit scharfen Zacken und Spitzen.
Oder sind es gar keine Wolken?
„Hurra! Schneeberge!“ schreit Karlchen Scheffer.
„Ja, Schneeberge, Karlchen! Das Berner Oberland! Die Alpen!“
Herrgott, wie ist doch die Erde so schön, so schön! Wenn wir nur erst ganz oben sind, ganz den Überblick genießen können.
Endlich!
Unser Lokomotivchen stößt noch einen tiefen Seufzer aus, dann hält es still, ganz außer Atem.
Und wir: Ausgestiegen, sie steile, letzte Höhe emporgeklettert und am Abhang in das Gras geworfen.
Da sitzen wir, und vor uns wie ein Panorama die Kette der Alpen.
In leichtem, bläulichem Dunst die Vorberge, strahlend in blendendem Weiß das Hochgebirge!
Nebeneinander aufgereiht, an den Fingern kann man sie herzählen wie in der Geographiestunde: Finsteraarhorn, Schreckhorn, Wetterhorn, Eiger, Mönch und Jungfrau.
Wir sehen und sehen und denken, wir sind im Märchenland! Zu schön ist es, um Wirklichkeit zu sein, selbst die Scheffer-Jungen sind andächtig und still geworden!
Und diese reine Luft, diese warme, herrliche Sonne und drüber der ewige Schnee!
Seit langem bin ich nicht so froh gewesen wie heute. Macht das Margots Glück, das auf mich abfärbt, oder ist es, weil in der reinen, schönen Höhenluft endlich das Kopfweh und all die törichten Gedanken fort sind?
„Dort liegt Bern!“ höre ich die Stimme Reimers eben zu Margot sagen, und er zeigt mit der Hand geradeaus.
Dort liegt Bern!
Wie ein Vision steigen vor mir ein Paar braune Augen, ein hoch gezwirbeltes Schnurbärtchen und ein schief sitzender Panamahut auf.
Ein rosiger Schein von der untergehenden Sonne huscht darüber hin, über das liebe Bild und über die äußerste Spitze des Finsteraarhorns.
Da, er geht weiter, er springt von Spitze zu Spitze, bis hin zum Silberhorn der Jungfrau. Dunkler wird er, getaucht in rote Glut, mit blitzenden Goldfunken darüber liegen die Schneeberge vor mir.
Alpenglühen!
Und während ich verzaubert hinschaue auf dies Wunder, fällt ein Schein des Lichtes auch in mein Herz, und da – ja – da gibt es auch ein Alpenglühen!
Klar wird es mir mit einem Male, was mit mir los ist; ich weiß, daß ich „ihn“ lieb habe! „Ihn“, lieber Gott, du weißt ja, wen ich meine, Karl Heinrich Eck heißt er.
Den 21. Juli.
Nach den Entdeckungen des gestrigen Tages müßte ich ja nun wohl unglücklich sein und mit Selbstmordgedanken und andern Schießwaffen umgehen. Aber nichts davon ist zu merken! Entschieden funktioniere ich anders als die Heldinnen in den Romanen, die ich gelesen habe.
Alles lacht und frohlockt in mir.
Glückselig bin ich. Unsinn schwatze ich, Unsinn stelle ich an. Mit den Scheffer-Buben bin ich auf unsern Nußbaum geklettert, und wir haben von da aus das darunter küssende Brautpaar mit kleinen, grünen Nüssen beworfen.
„Gott sei Dank, jetzt bist du wieder die alte!“ sagt Margot.
„Ja, Gott sei Dank, das kommt vom Alpenglühen!“
Ich bin ja so froh! Ich habe „ihn“ lieb! Unmenschlich lieb! – Mehr verlange ich gar nicht!
So gern habe ich immer Liebesgeschichten gelesen, aber gut ausgehen haben sie müssen. Jetzt erlebe ich nun meine Liebesgeschichte, und sie ist wundervoll! Viel, viel interessanter als alle andern, nur ich fürchte, gut ausgehen kann sie gar nicht.
Zu toll habe ich mich festgelogen mit meinem sagenhaften Ehegemahl. Und jetzt sagen, daß alles nicht wahr ist, jetzt, seit ich weiß, wie lieb ich „ihn“ habe – unmöglich! Allen könnte ich es gestehen, nur „ihm“ nicht. „Er“ würde ja merken, weshalb ich es tue. Und das darf er nie – nie – nie!
Ob er mich wohl auch ein wenig lieb hat? Das möchte ich zu gern wissen!
Auf dem Abreißkalender im Speisesaal hat heute ein Vers gestanden, den ich aufschreiben will.
„Ich werfe tausend unsichtbare Bande
von mir zu dir, die sollen ziehen in deine Lande,
und hinterher, auf luft’gen Brücken,
will ich dir meine Seele schicken –„
Bis hierher ist es hübsch, dann aber kommt es ganz dumm:
„Denn sie ist krank nach deinen Blicken,
oh, laß sie ein in deine Tür!“
Nein, krank ist meine Seele nicht die Spur! Und wenn sie es wäre, schickte ich sie höchstens zum Doktor, aber nicht zu einem Menschen, den ich lieb habe.
Den 22. Juli.
Gestern abend war ich so ganz ruhig. Und nun ist heute über Tag doch wieder alles durcheinander gekommen.
Mittags bin ich mit dem Brautpaar nach Luzern gefahren. Als wir da ankamen, wer empfängt uns?
„Er – Graf Eck!“ – natürlich hat die Margot das so eingefädelt, und sie hat es gut gemeint, aber es war überflüssig.
Mir hat das Herz doch beinahe einen Moment stillgestanden, als ich ihn so unerwartet wiedersah, aber ich habe ein paarmal tief geatmet, da ging es vorüber. – Und nun machten wir rastlos Konversation, und ich redete das Blaue vom Himmel herunter. Aus reiner, purer Verlegenheit. Aber ich glaube, er hat nichts gemerkt. Ist Luzern aber eine interessante Stadt, und so malerisch mit all den alten Türmen und Gebäuden!
Die Hofkirche haben wir besehen, den Gletschergarten und dann den Löwen und immer wieder den Löwen. Gar nicht satt habe ich mich daran sehen können. Schließlich ist das Brautpaar zu einem Juwelier gegangen, Verlobungsringe zu bestellen, und ich habe nicht gern mit wollen, aus Angst, es könnte derselbe Juwelier sein, von dem mein billiger Ring stammt, also habe ich erklärt, ich könnte mich von dem Löwen nicht trennen. Graf Eck behauptete, mir Gesellschaft leisten zu müssen. Und so sind wir zwei also bei unserm Löwen allein geblieben. Als „Anstandswauwau“ hat er ja auch genügt! Ich bin so fröhlich gewesen und gar nicht mehr verlegen. Aber Graf Eck hat mit einem Male sein „Dienstgesicht“ vorgesteckt und schließlich, als auch die letzten neugierigen Kinderfräulein mit ihren Zöglingen aus unsrer Nähe verschwunden waren, hat er einen Brief aus der Tasche gezogen und ihn mir gezeigt.
„Kennen Sie die Handschrift, Baronin?“
„Nein, keinen Schimmer!“
„Sie kennen die Handschrift Ihres Mannes nicht?“
Er sah mich förmlich entsetzt an.
Natürlich, wieder mein Mann!
„So, was schreibt er denn?“
Da habe ich den Brief, und da steht es! Er verleugnet mich total, mein Mann! Er wendet sich an den Grafen Eck, weil dessen Name der einzig leserliche auf der Ansichtskarte von der Tellsplatte gewesen ist, und bittet ihn um Aufklärung über die betreffende „immer treue Lena“. Er kennt niemand dieses Namens, wohl aber ist er und seine Frau (dick unterstrichen) empört über diesen unqualifizierbaren „Scherz“. Er bittet, der betreffenden „immer treuen Lena“ das Handwerk zu legen!
Er verleugnet mich! Mich, die ich hier Kummer und Sorgen um ihn leide und nebenher auch noch jeden Tag den Grünspan von dem Eheringe herunterputze. Wirklich, der Mann verdient mich gar nicht! Ich lasse mich scheiden – ich –
In meinem Kopfe geht alles durcheinander. Dazu ewig die fragenden, vorwurfsvollen Blicke von „ihm“.
„Unsre Karte scheint an eine falsche Adresse gekommen zu sein. Komisch, nicht wahr?“ lächle ich unsicher.
Er atmet auf.
Dann nimmt er meine Hand, zieht sie an die Lippen und sieht mich mit so guten Augen an, daß mir ganz schwach wird.
„Lena,“ sagt er, „nicht wahr, Sie wissen, daß ich Ihr bester, treuester Freund bin, und wenn Sie in irgendeiner Not sind, fragen Sie mich um Rat?“
Ach, du liebe Güte! Nur nicht so gut zu mir sein, das vertrage ich nicht. Lachend reiße ich meine Hand los und bemühe mich, recht leichtsinnig auszusehen.
„In was für einer Not soll ich denn sein? Und, selbst wenn es der Fall wäre – was ich mir einbrocke, esse ich auch selbst aus, da brauche ich Ihre Hilfe nicht!“
Natürlich hat er recht pikiert ausgesehen, aber ich habe ihn bald wieder lustig geschwatzt. Einen schönen weißen Löwen aus Elfenbeinmasse hat er mir noch gekauft, der gute Kerl.
Dann ist das Brautpaar gekommen, und wir sind leichtsinnigerweise in den Schweizerhof gezogen zum Abendbrotessen und haben da nicht Asti spumanti, sondern französischen Sekt getrunken. Eine Zigeunerkapelle hat dazu gespielt.
Gut, daß die Margot und ich nachher allein im Mondschein nach Hause fahren mußten. Es war so schön, beinah zuviel Poesie.
In unsrer Pension waren übrigens bis spät in die Nacht hinein große musikalische Veranstaltungen. Der Konservatoriumsprofessor hat vorgespielt, und die „Brüder Klitt“ haben gesungen.
Immer nach der „Krone im tiefen Rhein“ hat der eine geschrien. Die Wände haben ordentlich gebebt, und der „gescheite Hund“, der sein Lager bei uns auf dem Korridor hat, heulte vor Wehmut.
Jetzt – um zwei Uhr nachts – scheint die Krone endlich gefunden zu sein, wenigstens ist es nun still.
Lieber Himmel, wenn ich mein Löschblatt ansehe, schäme ich mich ordentlich. Überall steht „Karl-Heinz“! – Lena, Lena, mach keine Dummheiten! – Ach was, es sieht’s ja niemand!
Den 24. Juli.
Margots Vater ist gekommen. – Seinen Segen zur Verlobung hat er mitgebracht, und den Besitz der vielen Millionen haben sie dem Hauptmann in einer stillen Stunde schonend mitgeteilt.
Nun ist alles im schönsten Schick. „Papa Wegener“ hat sich schleunigst mit „Papa Scheffer“ angefreundet, und die beiden kraxeln nun in der Naturgeschichte umher und kümmern sich um niemand weiter.
Übrigens, „Papa Wegener“ nennt mich andauernd „gnädige Frau“. Wir haben ihn natürlich einweihen müssen in meine Ehe, und er fand die Sache kolossal spaßig, meint auch, die Mogelei würde bei mir ebenso gut ausgehen wie bei seiner Tochter.
Ich meine das Gegenteil! Gestern war Sonntag. Dreißig Grad im Schatten – und Föhn. Unglaublicher Zustand! Herr J. H. Freese empfing mich schon beim Morgenkaffee mit der Neuigkeit: „Es rast der See und will sein Opfer haben!“
Gar so sehr hat er aber nicht gerast, nur kleine, weiße Katzenpfötchen huschten über das Wasser, aber alle Kleider, Hüte rasten, und die Chiffonschals auch, die man hier so kokett drapiert trägt.
So ein „Föhn“ ist etwas drolliges! Minutenlang totale Windstille, kein Lüftchen rührt sich. Dann plötzlich pustet es los aus allen Ecken, der richtige Wirbelwind.
Das allgemeine Sonntagsvergnügen hier stört der Föhn aber nicht. Alle ankommenden Dampfer und die Rigibahn sind besetzt bis auf das letzte Plätzchen. Eine Italienerkapelle, Leute mit gestrickten Mützen und roten Schärpen, singt, spielt und tanzt Gondellieder. Männergesangvereine ziehen von Lokal zu Lokal und geben schwermütige Volksmelodien zum besten. Man weiß nicht, wo man zuerst sein soll!
Ich entscheide mich für die Italiener, bei denen ich Zaungast spiele. Einige Centimes stecke ich ihnen zu, dafür spielen sie mir alles, was ich gern habe, und machen mir dazu noch schöne Augen. Lieber Himmel, warum soll ich die kleine Huldigung nicht mitnehmen, sonst macht mir ja doch niemand „schöne Augen“! –
Ich glaube gar, ich fange an, melancholisch zu werden! – Na, das fehlte gerade noch! –
Den 25. Juli.
Es regnet! – Das soll es nach dem „Föhn“ hier immer tun. Es regnet Bindfaden, aber alles atmet auf nach der glühenden Hitze der letzten Tage.
Ich marschiere mit dem Brautpaar im pladdernden Wasser den Weg nach Gersau zu, die „kleine Axenstraße“, wie wir ihn nennen. Die beiden unter einem Schirm – ich ganz solo! Margot hat ihrem „lieben Kurt“ meinen ganzen Roman erzählt.
Schändlich! Nun bearbeiten sie mich, Graf Eck auch aufzuklären, angeblich, weil der besonders froh darüber sein würde.
Wer das glaubt! – Höchstens sieht er mich wieder böse an, weil ich gelogen habe! Was geht es ihn auch schließlich an? Und was soll er von mir denken, wenn ich unaufgefordert derartig zarte Geheimnisse verrate.
Nein, ich mache mich nicht lächerlich! Mögen sie es ihm meinetwegen später erzählen, wenn ich ihn nicht mehr wiederzusehen brauche.
Den 26. Juli.
Es regnet immer noch, aber etwas weniger. Hinter dem Uri-Rothstock kommt schon wieder ein Stückchen blauer Himmel vor. Man sieht doch wenigstens den guten Willen.
Es tut auch not! Unser unglücklicher Pensionswirt ist von seinen Gästen schon beinahe entzweigefragt worden.
„Ob es hier immer so regnet?“
Und dabei haben wir drei Wochen nichts wie Sonnenschein gehabt.
„Ob es nicht bald aufhören wird zu regnen?“
Der Bedauernswerte rettet sich ins Lesezimmer, kommt aber dabei buchstäblich aus dem Regen in die Traufe, denn hier sitzt J. H Freese.
„Sagen Sie, lieber W., wie denken Sie eigentlich über Wilhelm Tell?“
Der Pensionswirt, nervös geworden durch den Jammer der letzten Tage, bemerkt, daß er darüber „gar nicht denke“.
„Aber ich bitte Sie, ein Schweizer wie Sie?“
Da verlässt Herrn W. Die Fassung.
„Herr Freese, den Wilhelm Tell, den hat es nie gegeben, die ganze Geschichte ist eine Sage!“
„Nie gegeben – aber ich bitte Sie – Schiller hat den ‚Tell‘ doch geschrieben!“
„Ach was, Schiller ist nie in der Schweiz gewesen, Goethe hat ihm das alles hier geschildert, und an Wilhelm Tell glauben auch nur die Deutschen!“
Herr J. H. Freese steht entgeistert. Er fährt sich ein paarmal mechanisch durch die Frisur, dann verlässt er wortlos das Zimmer.
Ich schleiche nach. Auch mir ist ein Altar meiner Kindheit zertrümmert. Aber Hochachtung erfüllt mich vor Schiller, der ein Land, das er nie gesehen hat, so lebenswahr schildern konnte.
Allerdings, Goethe hat es ihm erzählt!
Den 27. Juli.
Es hat aufgehört zu regnen – und es ist ein Brief gekommen vom Grafen Eck. Er fordert uns auf zu einer Partie nach Göschenen-Andermatt. Morgen früh mit dem ersten Dampfer kommt er von Luzern. Wir sollen dann hier einsteigen. Bis Flüelen Dampferfahrt, dann Gotthardbahn!
Ich weiß nicht, mir ist es nicht ganz recht. Eigentlich habe ich mit Eck doch abgeschlossen und wollte ihn nicht mehr wiedersehen. Zweck hat es ja doch nicht.
Aber der Hauptmann Reimer hat gleich „ja“ telegraphiert, und nun muß ich doch mit wegen der Margot. Papa Wegener hat nämlich morgen schon eine Partie verabredet mit dem Geheimrat nach Engelberg, und Mama Scheffer muß ihre Buben hüten.
Ich werde mich recht ruhig und würdig benehmen, damit die Sache gut abläuft! –
Den 30. Juli.
Heute früh habe ich der Mama Scheffer alles gesagt. Ich konnt’s nicht aushalten, sie so belogen zu haben, besonders wo aus dem übermütigen Streich solch trauriger Ernst geworden ist. Sie hat mich ordentlich zärtlich geküßt.
„Ich habe es beinahe geahnt, Kindchen,“ meint sie, „und ich weiß einen, der sich sehr darüber freuen wird!“ Gute Mama Scheffer, wenn du wüßtest, was die Lena für einen Bock in sich hat, und daß der „Eine“ nie etwas erfahren soll.
Um neun Uhr mit dem Dampfer ist die Scheffer-Familie abgefahren.
Es war ein trauriger Abschied. Alle haben sie die Taschentüchlein naßgeweint, sogar mein Karlchen, und den „gescheiten Hund“ haben sie mit Gewalt und einem Strick auf den Dampfer bugsieren müssen.
Der J. H. Freese ist auch fort.
Düsteren Blicks hat er Abschied genommen, und im Fremdenbuch der „Pension Rigi“ prangen die tragischen Worte:
„Ihr habt aus meinem Frieden mich gerissen,
in gärend Drachenblut die Milch der frommen Denkart mir gewandelt.
J. H. Freese, Berlin. Harzerkäse en gros.“
Den 31. Juli.
Ich gehe überall umher, Abschied zu nehmen.
Übermorgen fahren wir. Schwer ist es schon, aber besser ist es auch, ich gehe jetzt fort. Wer weiß, was mir hier noch alles bevorsteht. Und ob der Herr von Sandten in X. nicht doch noch die Polizei auf mich hetzt wegen „falscher Titelführung“ oder sonst was.
Mir ist auch noch etwas Schreckliches passiert. Mein Tagebuch war fort! Unterm Nußbaum hatte ich noch darin geschrieben, dann habe ich es da wohl vergessen und unterwegs verloren.
Wie man nur so gedankenlos sein kann! Heute früh lag es nun wohlverpackt und versiegelt neben meiner Kaffeetasse, obendrauf ein Sträußchen Alpenveilchen. Niemand weiß, wer es dahingelegt hat. Die Margot zuckt nur die Achseln und lacht.
Ich kann nun keinem Menschen mehr in die Augen sehen. Jeder, der mir begegnet, kann es ja gelesen haben, und was steht da doch alles darin!
Den 1. August.
Ich weiß nicht, wie ich Ruhe finden soll zum Schreiben, aber Margot sagt, die Geschichte muß einen Schluß haben, und nun sitze ich hier um zwölf Uhr nachts und bemühe mich, ein paar richtige Gedanken zu fassen.
Wie ist doch alles so gut geworden!
Den ganzen Tag bin ich traurig herumgeschlichen. Koffer haben wir gepackt, kleine Andenken und Mitbringsel gekauft, aber gefreut hat mich nichts mehr. Ich habe mein Andenken im Herzen gehabt, und das hat weh getan.
Abends haben wir den See noch einmal im Mondschein genießen wollen und dazu uns unter die Kastanien am Kai gesetzt. Es war der Tag der Schweizer Bundesfeier, und auf allen Bergen brannten Freudenfeuer. Margot und ihr Kurt haben immerzu miteinander geflüstert und dann erklärt, daß sie noch etwas promenieren wollten.
Nun war ich allein!
So hell hat der Mond geschienen, alles ist in blausilbernes Licht getaucht gewesen, und auf dem Wasser war eine lange, lange silberne Straße. Dazu die Scheinwerfer vom Stauferhorn und vom Bürgenstock, die die Ufer beleuchteten, und italienische Musik, die aus einem Hotelgarten leise über das Wasser klang.
Ich habe den Arm auf die Mauer gestützt und in den Mond gesehen. Und alles, alles, was ich hier erlebt habe, ist an mir vorbeigezogen.
Gefragt habe ich mich, ob ich dem Grafen Eck wirklich alles hätte sagen müssen, und ob er wohl ein bißchen traurig ist oder ob er sich schon getröstet hat.
Und wie ich so darüber nachgedacht habe, konnte ich es doch gar nicht mehr aushalten, daß ich ihn nun nie mehr wiedersehen sollte. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber da habe ich mit dem Kopf auf der Mauer gelegen und habe geweint und geweint wie toll.
Das war endlich eine Erleichterung, und es hat’s ja niemand gesehen. Da schadet es auch nichts, wenn man weint. Ich weiß nicht, ob ich dann eingeschlafen bin und geträumt habe. Irgendwer hat mich aufgerichtet, ein paar Arme haben mich ganz fest gehalten und eine liebe, bekannte Stimme „Meine, meine Lena!“ zu mir gesagt. Ich wußte ja, daß ich nur träumte und habe die Augen gar nicht aufgemacht, damit der schöne Traum nicht etwa aufhörte. Ganz genau wußte ich auch, wer es war, der mich im Arm hielt.
„Karl-Heinz!“ habe ich leise geflüstert, und dann wußte ich mit einem Male, daß es kein Traum war. So, wie ich jetzt geküßt worden bin, das konnte nur Wirklichkeit sein.
Gar nicht geredet haben wir. Nur so fest hat er mich gehalten und immer leise über mein Haar gestrichen. Aber ich bin ganz ruhig gewesen und gar nicht verwundert, daß er bei mir war. Ja, und dann hat er erzählt, daß er die ganzen Tage hier gewohnt hat, weil er sich nicht von mir trennen konnte, und immer heimlich hinter mir hergewesen ist. Dabei hat er dann auch mein Tagebuch da oben unter dem Nußbaum gefunden und natürlich gelesen, und da ist ihm dann alles klar gewesen.
Ich weiß nicht, wie lange wir so gesessen haben, schließlich ist Margot mit ihrem Kurt dazugekommen, lachend und nicht ein bißchen überrascht.
Zu vieren haben wir im Mondschein gesessen und Zukunftspläne gemacht, und auch des Herrn von Sandten in X. wurde dabei gedacht. Er soll eine Verlobungsanzeige haben von seiner „ungetreuen Lena“, weil wir uns seinetwegen so gequält haben.
Und dann hat mir Karl-Heinz den falschen Trauring vom Finger gezogen und ihn weit fort in das Wasser geworfen.
„Weißt du, Lenachen,“ sagt er und küßt mich, „den stiften wir den Nixen vom Vierwaldstätter See.“
– ENDE –