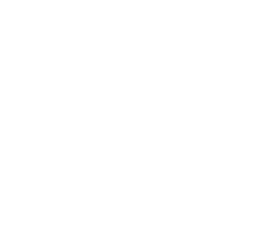Krankenschwester im Kaiserreich – Einblicke in Ausbildung und Alltag
Die preisgekrönte Serie „Charité“ warf einen lebendigen Blick auf das Leben und insbesondere das Gesundheitswesen Ende des 19. Jahrhunderts (Staffel 1) und in Staffel 2 und 3 im 20. Jahrhundert unter verschiedenen Regimen.
An der schon damals berühmten Charité-Klinik arbeiteten damals Persönlichkeiten wie Robert Koch, Paul Ehrlich und Rudolf Virchow, deren Leistungen als Wissenschaftler heute noch als überragend gewürdigt werden.
Auch die medizinische Ausbildung wird thematisiert – Krankenschwester war einer der ersten Berufe, für die es eine Ausbildung für Frauen gab und welche für Frauen als „schicklich“ galten.
Ein Studium war dagegen bis Ende des 19. Jahrhunderts für Frauen in Deutschland generell nicht möglich, so wird es auch in der Serie erzählt. Wer das Geld und die Mittel hatte, konnte als Frau in der Schweiz Medizin studieren, z.B. an der Universität Zürich.
Ab 1900 öffneten dann auch die deutschen Universitäten Frauen ihre Pforten – den Anfang machte Freiburg, danach wurden Frauen, auch zum Medizinstudium, an mehr und mehr deutschen Universitäten zugelassen.
Wie eine die Ausbildung und der Alltag von Krankenschwestern 1906 aussahen, erzählt ein Artikel der Wochenzeitschrift „Über Land und Meer“ zum Schwesternwesen der Stadt Berlin.
Wurden Schwestern zunächst vor allem von der Kirche (in der Serie: Diakonissen) und privaten Schulen ausgebildet, so entwickelte sich im Kaiserreich parallel eine kommunal organisierte Ausbildung. Exemplarisch wird das Schwesternhaus des Moabit-Krankenhauses vorgestellt, welches zu dieser Zeit zwei Jahre existierte.
Wer bewarb sich damals als Schwester? Dazu wird erzählt:
„Die Schülerinnen entstammen meist Pastoren, Ärzte-, Lehrer- und Beamtenfamilien, ein weiteres Kontigent rekrutiert sich aus besseren bürgerlichen Häusern der Stadt Berlin.“
Die meisten Schwesternschülerinnen kamen also aus dem bürgerlichen Milieu.
Aber hielten auch alle die Ausbildung durch?
„Mühsam und verantwortungsreich ist der Beruf der Schwester.“ Ja, noch heute!
Nicht jeder ist seinen physischen und psychischen Anforderungen gewachsen, und von den Neueintretenden kehrt regelmäßig fast ein Drittel wieder in den Schoß der Familie zurück.“
Beim Eintritt in den Schwesternverband, also am Beginn der Ausbildung, mußten sich die Schülerinnen „gegen Hinterlegung einer Kaution von 200 Mark verpflichten, für eine Zeit von vier Jahren dem Schwesterverband anzugehören.“ Innerhalb des ersten halben Jahres konnte man allerdings freiwillig ausscheiden und bekam seine Kaution zurück.
Die Ausbildung kostete übrigens nichts (was zu dieser Zeit nicht selbstverständlich war) und „neben freier Verpflegung, Wohnung und Wäsche erhält die Schülerin nach Ablauf des ersten halben Jahres ein Taschengeld von 10 Mark.“
10 Mark waren damals mehr wert als heute, aber Taschengeld passt schon. Apropos Unterkunft und Verpflegung. Bei der Unterkunft geriet der Verfasser regelrecht ins Schwärmen, bei den Bildern habe ich seine Kommentare zu den einzelnen Räumen dazu geschrieben. Neben den Einzelzimmern (!) für die Schwestern gab es einen gemeinsamen Eßsaal mit Klavier, der auch Aufenthaltsraum für die Freizeit war.
Diese Freizeit war aber recht knapp bemessen: „Um ihren Beziehungen zur Außenwelt gerecht zu werden, ist einmal in der Woche ein freier Nachmittag und Abend vorgesehen, außerdem auf Wunsch zweimal wöchentlich noch eine zwei- bis dreistündige Urlaubszeit. Ein drei- bis vierwöchiger Sommerurlaub bringt eine wohlverdiente Erholungspause.“
Der sonstige Schwestern-Alltag war straff organisiert: „Den größten Teil des Tages weilt die Schwester auf der ihr zugeteilten Station und wacht hier über die den ihr anvertrauten Kranken. Vor respektive nach dem gemeinschaftlichen Essen, das …in zwei Abteilungen (Schichten sind gemeint) eingenommen wird, ist eine Freistunde vorgesehen, danach geht es wieder zur Station zurück, wo gegen acht Uhr das Tagewerk vollbracht ist. Die Nachtwache kommt, der übrige Teil ist nunmehr dienstfrei.“
Um 10 Uhr abends war Nachtruhe und die Schwestern mussten auf Ihrem Zimmer sein „so will es die Hausordnung“. Morgens ging das Tagewerk von neuem los.
Die Lehrzeit betrug damals nur ein Jahr bis zum Schwesternexamen. Während dieser Zeit arbeiteten die Schülerinnen im praktischen Teil auf verschiedene Stationen und hatten in einer Schwesternschule (die sich in diesem Fall auch auf dem Klinikgelände befand) theoretischen Unterricht. Dort erwarben sie die notwendigen Kenntnisse:
„An der Hand vorzüglicher Modelle und Präparate wird hier der Bau des menschlichen Körpers sowie die Funktionen der wichtigeren Organe erläutert, die Technik kleiner Eingriffe, welche die Schwester später selbst ausführen soll, gelehrt, das Verbinden geübt, kurz das Fundament zu einer rationellen, auf wissenschaftlicher Basis aufgebauten Krankenpflege gelegt.“
Außerdem wurden die angehenden Schwestern „neuerdings“ für einige Wochen in der Zentralküche und Dampfwäscherei beschäftigt, „damit auch die wirtschaftliche Seite der Ausbildung nicht vernachlässigt wird“. Dieser Teil der Ausbildung war allerdings noch im Versuchsstadium, wie es weiter heißt.
Und was verdienten Schwestern zu dieser Zeit? „Das Anfangsgehalt der Schwester beträgt 360 Mark und steigt jährlich um 30 Mark bis zum Höchstbetrag von 540 Mark.“
Wir sprechen hier wohlgemerkt von einem Jahresgehalt. Dazu muss man jedoch zwei Sachen bedenken. Die Schwestern hatten freie Kost und Logis. Aber auch wenn man dies einrechnete, war die Bezahlung gering. Sie wurde inklusive der „Nebenbezüge“ im Artikel auf 860 Mark veranschlagt. In ähnlichem Bereich bewegten sich die Verdienste von Arbeiterinnen. Zum weiteren Vergleich, ein Arbeiter verdiente zu dieser Zeit ca. ab 1300 Mark jährlich, eine Lehrerin in der Stadt ab 1200 Mark, gute Gehälter starteten ab 3000 Mark jährlich.
Aufstiegsmöglichkeiten bestanden zur Oberschwester, die etwas mehr verdiente (540-660 Mark).
Einen Vorteil der städtischen Schwestern: Sie bekamen eine Alters- und Invalidenversorgung, auch bei eine beruflich bedingten Erwerbsunfähigkeit gab es eine Rente.
Im letzten Satz heißt es: „So sehen wir seit zwei Jahren den kräftigen Nachwuchs einer neugeschaffenen groß angelegten Institution heranwachsen, ein Nachwuchs, aus dem eine Reihe wohlgeschulter Pflegerinnen zunächst für den Bedarf des Krankenhauses Moabit hervorgeht, der jedoch auch berufen ist, einen Stamm von Schwestern für das größte Hospital der Welt, das Rudolf-Virchow-Krankenhaus zu bilden.“
Das war vorausschauend geplant, denn das damals größte Krankenhaus der Welt wurde 1906 eröffnet, im Artikel findet Ihr einige Bilder dazu aus der „Sonntagszeitung“.
Mein Fazit:
Hier wird ein besonders positives Beispiel eines neuen Schwesternhauses aus der Hauptstadt vorgestellt, sicherlich war das angenehme Ambiente des Hauses und die komfortablen Schwesternzimmer nicht unbedingt Standard (sondern am oberen Ende der Skala). Auf der anderen Seite zeigt der Artikel aber auch, dass man sich bemühte, die Rahmenbedingungen dieses harten Berufes attraktiv zu gestalten. Was allerdings beim Gehalt aufhörte.
Tja, Ähnlichkeiten zu real existierenden Zuständen sind nicht zufällig.
Dem heute noch „mühsamen und verantwortungsreichen Beruf der Schwester“, wie es im damaligen Text so schön hieß, gilt mein Respekt – und das nicht erst seit der Corona-Krise! Vielen Dank an Euch und wenn ich Euch mit den Bildern und Informationen zum Schwesternberuf der damaligen Zeit unterhalten konnte, würde es mich freuen.
In einer Geschichte vom Preisausschreiben „Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt“ erzählt eine Frau von ihrer Ausbildung und Tätigkeit als Schwester im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts: „Die Freuden und Leiden der Krankenpflege„.