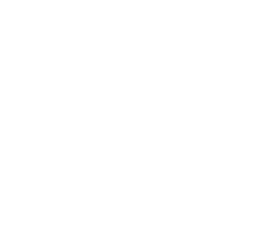Die Freuden und Leiden der Krankenpflege
Eine Geschichte aus dem Preisausschreiben „Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt“
Wer mehr zu diesem Preisausschreiben erfahren möchte, kann es hier nachlesen. Die Links zu weiteren schon veröffentlichten Geschichten findet Ihr am Ende.
Mein Vater war Arzt. Als mich der Familienbeschluss im vierzehnten Lebensjahr zur Lehrerin bestimmte, waren die Mittel für den Schulbesuch bis zum Examen nicht vorhanden. Ein zweijähriger Fortbildungskursus musste also, so gut es ging, die Lücken des bisherigen Dorfschul- und Privatunterrichts ausfüllen. So wurde die sechzehnjährige Lehrerin und Erzieherin für ein äußerst geringes Gehalt, ja musste froh sein, dass sich überhaupt jemand fand, der ihrer jugendlichen Unerfahrenheit seine Kinder anvertraute. Nur auf entlegenen Landgütern hatte man dazu selbst vor zwanzig Jahren den Mut.
Bei absolutem Mangel an pädagogischem Talent, viel zu ernstem Sinn für eine große Kinderzahl, heftigem Temperament und großem eigenen Wissensdurst sind zwei Jahre äußerster Abgeschlossenheit von jeder geistigen Anregung in einem Hause, in dem es außer den Schulbüchern nur einen dänischen Roman, ein dänisches Predigtbuch und einige landwirtschaftliche Kalender gab, die Zeitung aber nur für den Hausherrn da war, eine endlose Zeit. Instinktiv empfindet ein gewissenhafter Mensch selbst in so jugendlichem Alter die eigene Unzulänglichkeit vor schwierigen Pflichten, wenn auch die Fähigkeit logischer Schlussfolgerung noch fehlt.
Die Schwierigkeiten, welche der Unterricht wenig veranlagter Kinder jeder Lehrerin bieten muss, wachsen ins Unendliche, wenn noch dazu die häuslichen Verhältnisse unerfreuliche sind , Sprachschwierigkeiten durch langen Aufenthalt der vorschulpflichtigen Kinder in der dänischen Heimat der Mutter, schwere Krankheitszeiten dazu kommen und vor allem der eigene Geist zu völligem Darben verurteilt ist. Aber zwei Jahre wollte ich aushalten!
Und was dann? Immer klarer wurde mir, dass ich nicht weiter unterrichten könne, so dass ich eine von meiner Lehrerin angebotene Stellung ausschlug. Eine wirtschaftliche Tätigkeit zu suchen, wie meine Schwestern, kam nicht in Frage, da man mich stets für unpraktisch erklärt hatte und meine Erfahrungen nach der Richtung erst recht mangelhaft waren.
Da brachte der Zufall einen Ausweg. Ich hörte von der segensreichen Tätigkeit einer Diakonisse während einer Diphtherie-Epidemie auf dem Lande in jener Gegend. Krankheit und die Fürsorge für Kranke waren dem Landkind sehr naheliegend und vertraut, besonders da vom Vater her eine Anlage zur Krankenpflege vererbt war. Mein Entschluss war schnell gefasst, stieß aber auf den entschiedensten Widerstand meiner Mutter, die bei meiner Jugend fürchtete, dass mein ernster Sinn unter so viel traurigen Eindrücken zur Melancholie werden müsse. Anknüpfungspunkte für die Ausführung meines Planes fehlten auch, da die große Masse über nichts so im Unklaren zu sein scheint wie über die Verhältnisse in der Krankenpflege, heut noch wie vor 20 Jahren.
Also hieß es warten, noch einmal eine Lehrtätigkeit übernehmen, diesmal zwar unter freundlicheren Verhältnissen, aber ebenso unbefriedigend. Der Tod unserer Jüngsten an Diphtherie, die schon unsern einzigen Bruder hingerafft und die wir alle mehr als einmal in schwerster Form durchgemacht hatten, stimmte meine Mutter meinem Wunsche weit günstiger, und da mein Zögling ohnehin in die Schule eintreten sollte, stand meinem Berufswechsel nichts mehr im Wege.Ich schrieb an die Schwesternschaft eines Rote-Kreuz-Mutter-Hauses, dessen Statuten ich durch Bekannte erhalten hatte, und erhielt den Bescheid, ich möge in vier Wochen zur Einweihung des neuen Krankenhauses unbedingt eintreffen.
Mit dem ganzen Eifer meiner 19 Jahre begann ich das neue Leben, das mir, die ich bis dahin fast nur in ländlicher Abgeschiedenheit gelebt hatte, eine Fülle von neuen Eindrücken brachte.
Die Einweihungsfeier führte einen großen Teil der etwa hundert Schwestern, die durch die ganze Provinz und darüber hinaus in Krankenhäusern, Kliniken und Gemeinden arbeiteten, für kurze Zeit zusammen. Dann füllte sich das Haus mit Kranken, und das Lernen begann. Praktisch und disziplinarisch war nichts auszusetzen, aber in einem Punkt behandelte mich das Schicksal stiefmütterlich: Schwere Krankheit der Oberin, eine Folge der Überanstrengung beim Einrichten des Hauses, endete die theoretischen Kurse gleich nach dem Anfang für das ganze Halbjahr, so dass ich selbst das geringe Maß dieser wichtigen Kenntnisse, das man sonst gewährte, nicht erhielt.
Großer Schwesternmangel zwang außerdem dazu, auch die Jüngsten und Unerfahrensten vor Aufgaben zu stellen, denen sie weder körperlich noch geistig gewachsen sein konnten. Mit noch nicht 20 Jahren war ich vertretende Stationsschwester der medizinischen Männer-Abteilung einer Universitätsklinik, in deren vier Räumen 42 Kranke versorgt wurden und zwei Wärter und eine Wärterin mir unterstellt waren.
Zunächst schwirrten Namen, Diät, Medikamente und Verordnungen so vieler Patienten in meinem Kopf durcheinander. Ein täglicher Wechsel von etwa einem Viertel der Krankenzahl erschwerte den Überblick noch mehr. Bis dahin hatte ich einzelne oder eine kleine Zahl von Patienten unter Anleitung versorgt, jetzt sollte ich für die Leistungen des Personals einstehen und war viel unerfahrener als dieses. Da empfand ich zuerst, wie unzulänglich ein halbes Jahr Ausbildung, an dem mir sogar noch drei Wochen fehlten, für solche Verantwortung ist! Viele Hilfsmittel und Apparate waren mir ganz fremd, und ich musste mich vorsehen, meine Unkenntnis nicht zu sehr merken zu lassen, da es ohnehin nicht leicht war, die nötige Autorität den Kranken und dem Personal gegenüber zu wahren.
Außerdem war der Chef empört, dass man ihm ein so junges Geschöpf, noch dazu für eine Männerstation, geschickt hatte. Und doch ließ sich’s nicht ändern – denn Ersatz für die schwer erkrankte Stationsschwester musste geschafft werden, und ich war die letzte verfügbare von zwanzig Schülerinnen. Der Arzt machte zuerst ein erstauntes Gesicht, als ich mir bei der Visite Notizen machte, aber nach acht Tagen brauchte ich sie nicht mehr, und bald ging alles ruhig im alten Gleise.
Gelernt habe ich in der Zeit viel fürs ganze Leben! Ich hatte noch nie einen Menschen sterben sehen – in einem Vierteljahr stand ich an 23 Sterbebetten! Ich hatte zum Schluss auch die Vertretung auf der Frauen-Abteilung bekommen; da starben in einer Nacht unerwartet plötzlich ein Kind und ein 17-jähriges Mädchen, das nur wenige Tage am Typhus schwer krank lag.
Solche Erlebnisse erziehen zu eiserner Selbstbeherrschung! Denn außer der Erfüllung der reichlichen Berufspflichten, muss die Schwester den Kranken möglichst die traurigen Eindrücke, die sich vom Krankenhause nicht trennen lassen, fernhalten und mildern.
Da heißt’s vom Totenbett mit heiterem Antlitz zu den Kranken in den anderen Räumen gehen, die von dem schweren, qualvollen Sterben nichts erfahren dürfen. Der natürliche Erfolg solchen Lebens ist aber nicht Melancholie, sondern, dass alles, was an Frohmut im Menschen steckt, an die Oberfläche dringt, um ein bisschen Sonnenschein ins Leben der Kranken zu bringen.
Natürlich fehlt es auch nicht an wohltuendem Gegengewicht. Das Helfen können ist allein schon eine Wonne! So viel Liebes, so viel Dankbarkeit bringt wohl kein Frauenberuf! Der Schwesternkreis kommt seiner Jüngsten, die tapfer ihren Platz auszufüllen sucht, besonders herzlich entgegen. Müssen auch die Mahlzeiten mangels eines Speisezimmers einzeln eingenommen werden, so gibt’s doch sonntags ein gemütliches Kaffeestündchen im Garten in der Laube, am Wall unter prächtigen, alten Bäumen. Nach Ablauf der vierteljährigen Vertretung war mir der Abschied schwer, als sei ich, wer weiß wie lange, eingewurzelt. Nun folgte ein anstrengendes Jahr in einer Privatklinik, zwei weitere Jahre in der chirurgischen Frauen-Abteilung derselben Universitätsklinik.
In diesen Jahren entwickelt sich der praktische Blick für die Verhältnisse, die Überzeugung, dass mit einem Taschengeld von 12 Mark monatlich neben der Kleidung und freien Station und dem Versprechen einer Versorgung im Mutterhaus nach mindestens zehn Dienstjahren doch am Ende Zukunftssorgen nicht ausgeschlossen sind. Der Entschluss zu selbständiger Arbeit reift, um die Familiensorgen erleichtern zu helfen.
Die schwere Erkrankung meines Vaters an einem unheilbaren chronischen Leiden drängte mich, noch einige Monate früher, als geplant, in die Privatpflege der Großstadt, kein leichter Schritt für die Dreiundzwanzigjährige mit nur vier Jahren Berufserfahrung! Es lässt sich mancherlei lernen in diesen Jahren, manche Erfahrung sammeln, aber das Fehlen jedes Systems lässt große Lücken, und das Fehlen jeder theoretischen Grundlage macht sich immer wieder geltend.
Besonders ist dies in der ganz selbständigen Privatpflege der Fall, in der man in kritischen Augenblicken oft nach Stunden erst den Arzt erreicht und nicht wie im Krankenhaus den Rat erfahrener Schwestern einholen kann. Dabei muss man Arzt und Patienten wie deren Familie unbedingtes Vertrauen einflössen, um zum Ziel zu kommen. Das gibt innerlich manch harten Kampf, macht die bangen Nächte noch sorgenvoller. Und wie viel besser könnte man für die Kranken sorgen, wenn man alles das an Kenntnissen und Erfahrungen beherrschte, was unser Beruf voraussetzt, und was in vollem Maße in Deutschland nur wenige Bevorzugte erwerben können!
Man muss selbst jahrelang unter dem „Nichtwissen“ gelitten, allmählich entdeckt haben, wie vieles man aus Unkenntnis versäumt, wie viel mehr man, mit besseren Kenntnissen ausgerüstet, in zahlreichen Fällen für die leidende Menschheit hätte tun können, um die ganze Tragweite unserer ungenügenden Pflegeausbildung richtig zu schätzen.
Außer der Möglichkeit, durch die höheren Einnahmen den Angehörigen eine Stütze zu werden, eventuell für die eigene Zukunft sorgen zu können und in seiner Lebenseinrichtung unabhängig von anderen Instanzen zu sein, ist der Hauptvorzug der Privatpflege der, dass man dem einzelnen Kranken in der eigenen Häuslichkeit menschlich sehr viel mehr sein kann und nicht mit den Schwierigkeiten des Unbehagens zu kämpfen hat, das die ungewohnte Umgebung, das Zusammenleben mehrerer Kranker in demselben Raum und die unerlässliche strickte Krankenhausordnung unbedingt hervorrufen müssen. Jede im Krankenhaus tätige Schwester wird darunter leiden, dass sich für die etwas verwöhnten Kranken so manche ihrer Gewohnheiten nicht berücksichtigen
lassen, während für die Unbemittelten natürlich die absolute Sauberkeit und die Möglichkeit, die ärztlichen Verordnungen genau durchzuführen, vieles aufwiegt. Dass die Einzelpflege im Privathaus andere Eigenschaften bei der Pflegerin voraussetzt als die Krankenhauspflege, mag beiläufig erwähnt sein.
Nur eins hat die Krankenpflege überall gemeinsam: Sie überanstrengt unbedingt, sie verbraucht die beste Lebenskraft in ein- bis anderthalb Jahrzehnten! Als ich die Privatpflege begann, war der Mangel an Schwestern hierfür so groß, dass ich das erste Jahr ohne Pause in zwei Pflegen verlebte. Im zweiten Jahr kam ich zwischen mehreren Pflegen ein Vierteljahr gar nicht erst in meine Wohnung.
Im Lauf dieser Zeit machten sich die Folgen der zu intensiven Arbeit schon durch plötzliches körperliches Versagen geltend. Das wird zuerst durch eine kurze Ruhezeit und die nötige Pflege schnell ausgeglichen, macht dann aber stets längere Pausen nötig, die nicht immer rechtzeitig erreichbar sind. Es ist ein furchtbares Gefühl, wenn ein kräftiger Mensch schon Ende der zwanziger Jahre fühlt, wie seine Leistungsfähigkeit verschwindet, und mit 33 Jahren abermals vor der Frage des Berufswechsels steht, da er seiner liebsten, durchaus befriedigenden Tätigkeit körperlich nicht mehr gewachsen ist. Für uns Frauen ist es in solchem Fall besonders schwer, eine neue Grundlage für unser wirtschaftliches Leben zu finden, da uns durchweg gediegene, praktische Kenntnisse fehlen.
Ich wurde glücklicherweise allmählich auf einen Weg gewiesen, der nicht nur öde Büroarbeit zu bringen braucht, sondern dem Bedürfnis, anderen zu nützen, und zwar gerade denen, die mit mir ein gleiches Schicksal haben, den auf ihre eigene Kraft angewiesenen Frauen, Spielraum genug lässt.Zunächst nur durch die Sorge um meine eigene Zukunft veranlasst, hatte ich mich jahrelang mit dem Studium der zahlreichen Versorgungseinrichtungen beschäftigt, die es schon gab. Ich fand, dass außer der staatlichen Invaliditäts- und Pensionsversicherung, die einen unschätzbaren, aber doch beschränkten Versorgungswert hat, nichts bestand, was dem Bedürfnis und den Mitteln der erwerbenden Frau entsprach. Dadurch hatte ich volles Verständnis für den Wert der nach dem Beispiel staatlicher Versicherung neu entstehenden privaten Versicherungseinrichtungen und war gern bereit, an ihrer Entwicklung für uns Frauen mitzuarbeiten.
Dass mein Hauptinteresse meinen Berufsgenossinnen galt, ist selbstverständlich, und so kam meine neue Tätigkeit nicht nur der Lösung des schwierigen Versorgungsproblems für viele einzelne Schwestern und andere Berufstätige zu Hilfe, sondern wirkte auch mit bei der Anbahnung weitest gehender Reformen in der ganzen deutschen Krankenpflege der Zukunft.
Ausreichende, gründliche Vorbildung und Schutz gegen Überanstrengung bekommen erst dann ihren vollen Wert, wenn zugleich die feste Grundlage für die Zukunftsversorgung gegeben werden kann, wie wir sie in vollkommener Form erst Ende des letzten Jahrzehnts durch die Invaliditäts- und Pensions-Versicherung erlangt haben, die jederzeit im Notfall eintritt.
Geht aus dem Vorstehenden auch hervor, dass eine mittellos auf sich selbst angewiesene Frau schon in den letzten Jahrzehnten in Deutschland eine befriedigende, selbständige Lebensarbeit finden konnte, sogar ohne wirkliche Vorbildung auf irgend einem Gebiet, so möge man doch zwischen den Zeilen lesen, wie schwer dies Leben durch die mangelhafte Vorbereitung war, und jeder, der für die Zukunft junger Mädchen verantwortlich ist, möge alles daransetzen, ihnen außer guter, praktischer Allgemeinbildung auch eine Berufsausbildung zu sichern, zu der es heute so viele Wege gibt, und die ihnen erspart, einen großen Teil ihrer besten Kraft in dem schlimmen Gefühl der Unzulänglichkeit gegenüber den zu erfüllenden Pflichten aufzureiben.
Nachbetrachtung:
Im Artikel „Krankenschwester im Kaiserreich“ wird von den Ausbildungsbedingungen in einem modernen Schwesternheim im Jahr 1906 erzählt. Gegen diese Beschreibung mutet die Realität, von der diese Frau in ihrer Geschichte berichtet, sehr hart an. Eine ungenügende Ausbildung, ein Einsatz an Positionen, mit denen sie aufgrund mangelnder Erfahrungen hoffnungslos überfordert ist und dafür wenig Lohn und nicht mal „viel Ehr“.
Verdienten Krankenschwestern im Jahr 1906 neben Kost und Logis nicht viel, so erhielten sie doch für ihre anstrengende Tätigkeit nicht nur ein Taschengeld. Es ist zu vermuten, dass die Erzählerin ihre Ausbildung im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts absolvierte – bis 1906 hatten sich einige Kriterien, u.a. der Verdienst und sicher auch die Ausbildung, verbessert.
Denn was schon in der Erzählung deutlich wird: Krankenschwestern wurden dringend gebraucht und es gab eher einen Mangel als einen Überschuß an ihnen.
Interessant ist auch die letzte Passage zu dem entstehenden staatlichen und privaten Versorgungswesen. Ab 1889 gab es eine staatliche Alters- und Invaliditätsversicherung, die aber nur eine Grundabsicherung war. Aufgrund ihrer Erfahrungen hilft die Erzählerin beim Aufbau einer privaten Vorsorge für ihre ehemaligen Berufsgenossinnen und weiteren weiblichen Berufstätigen. Gleichzeitig hilft sie mit, die Krankenpflege zu reformieren – sie beklagt also nicht nur die Mißstände, sondern versucht aktiv die Lage zu verbessern. Genaueres wird aber leider nicht dazu ausgeführt.
Falls Ihr Lust auf weitere Geschichten von Frauenschicksalen aus dem Preisausschreiben „Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt“ bekommen habt, hier sind die Links dazu:
„Die Lithographin“ , „Vom Sprachunterricht zum Kunstgewerbe“ , „Ein Besorgungsinstitut“ , „Mit dem Kochlöffel“, „Am Telefon“ und „Die Lehrerin“ .