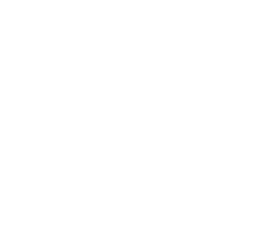Der Lebensgang einer Schriftstellerin
Eine Geschichte aus dem Preisausschreiben „Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt“
Wer mehr Informationen zum Preisausschreiben von 1905 lesen möchte, kann hier weiterlesen.
Meine Alltagstragödie eines Mädchens aus guter Familie gleicht tausend anderen. Man hat nach der Schule in Sprachen und Musik dilettiert, aus Holz und Porzellan zu Familienfesten „reizende” Geschenke hergestellt, man guckte ein wenig in die mütterlichen Kochtöpfe, hörte am Ende gar einen Zyklus moderner Literaturvorträge und erhielt eine vage, aber ganz vage Ahnung vom Schneidern — dann war die Bildung „fertig“. „Gott sei Dank,’ sagt Mutter, „meine Tochter hat’s nicht nötig, ein Brotstudium zu ergreifen, sie findet wohl bald einen lieben, braven Mann.” „Gott sei Dank,” sagt auch Vater, „mein Mädel soll sich weder die Augen beim Lernen verderben noch bei der Kunststickerei, sie soll kein Malweib werden oder das Haus mit nervös machen der Musikpaukerei verseuchen, ich will sie weder als bleiches Kontorfräulein sehen noch als „emanzipierte”” Studierende, sie soll bleiben, was sie ist: unser Sonnenscheinchen im Hause.
Sonnenscheinchens schüchternes Streben nach irgend einem Beruf wird leicht beiseite geschoben, und das junge Ding lässt sich’s ja auch gerne einreden, dass sie nur ein paar Winter „auszugehen“ braucht, um glücklich unter die Haube zu kommen. In den Romanen endet’s auch meist so schön!
Während der Bruder mit aller Energie zur Berufsvorbereitung angehalten wird, lebt sie eine Spanne Zeit sorglos dahin, wirklich nichts als ein fröhlich Sonnenscheinchen. Aber das Schicksal fragt nicht an; ohne Warnung zerstört es eines Tages das ganze Glück der Familie.
Erst ein Ringen zwischen Tod und Leben, bange Wochen am Krankenbett, und dann wird der ehedem unermüdliche Familienvater dem Leben zurückgeschenkt, dem Leben, aber nicht der Gesundheit, ein gebrochener, siecher Mann. Seine traurigen Blicke sagen: „Für euch wär’s besser, ich wäre gestorben, dann hättet ihr wenigstens die Versicherungssumme, jetzt habt ihr nichts und noch mich als Last.“
Wie ein schwerer Alp lastet dies Gefühl auf ihm, drängt ihn oftmals dazu, das neu geschenkte Leben freiwillig von sich zu werfen. Die Krankheit war langwierig und teuer, auch die Mutter bricht für kurze Zeit nieder unter der Anstrengung und Aufregung; auf den einzigen Besitz, die Versicherung, wird ein Darlehen aufgenommen, man ruft die Jüngste aus dem Pensionat nach Hause, schränkt sich ein, nimmt ein paar Pensionäre, quält sich, spart und leidet und hofft auf die fernen Zeiten, wo der Sohn vielleicht so weit kommt, dass er den Eltern eine Stützes sein kann.
Mit dem Beruf als Sonnenscheinchen ist’s für die Älteste vorbei. Die 22jährige will aber wenigstens den ihrigen keine Last sein. Fort treibt es sie, in die Hauptstadt, dort muss es für Arbeitswillige auch Arbeit geben, ja mehr als das – eine Zukunft! Schon baut die Jugendluft aus dem Unglück goldene Märchenschlösser!
Die Meinen weinten, als ich fortging, aber sie gaben mir recht. Ich musste daran denen, zu erwerben, etwas zu werden. Freie Bahn vor mir, ein paar Goldstücke in der Tasche – wie in einem Rausch fühlte ich mich, zum ersten Mal allein in der Großstadt! Wie im Rausch, denn auch die Ernüchterung kam bald. Zu eintönig wär’s, all die Einzelheiten solch einer Stellensuche zu schildern. Ich jagte Vermittlungsbüros ab, beantwortete Hunderte von Annoncen — alles, was ich dabei gewann, war die Erkenntnis, dass meine ganze sogenannte Bildung weniger zum praktischen Leben taugte als die eines Dienstmädchens.
„Waren Sie schon in Stellung? Haben Sie Zeugnisse? Haben Sie Branchenkenntnisse? Wo haben Sie gelernt? Können Sie stenographieren? Maschinenschreiben? Schneidern? Haben Sie den Kindergartenkurs durchgemacht? Eine Lehrerin- oder Sprachprüfung? Können Sie perfekt kochen? Verstehen Sie die Krankenpflege?“
All diese und ähnliche Fragen musste ich verneinen, ich konnte ja auf nichts verweisen als auf meinen guten Willen. Schon war ich in ein ganz billiges, schlechtes Stübchen bei rohen Wirtsleuten gezogen, und ich begann ab und zu etwas von meiner Habe nach der Pfandleihe zu tragen; mitunter fand ich dann einen Gelegenheitsverdienst als Adressenschreiberin oder dgl., das half nicht auf lange.
Nach Hause wollt‘ ich’s um keinen Preis schreiben, wie schlecht es mir ging, Stolz und Zärtlichkeit ließen das nicht zu.
Ein unerfahrenes, sonniges Kind war ich nach der Hauptstadt gekommen, bald sah ich mit reifen, traurigen Augen ins Leben! Ich lernte so viel verstehen und blickte in so viel Hässlichkeit, so viel Gemeinheit, die unter hundert verschiedenen Gestalten und Versuchungen an die Schutzlosen herankriecht. Mehr denn einmal wandelte sich das erwachende Glücksgefühl plötzlich zu tiefer Scham, wenn es mir klar geworden, was Lächeln, Blicke und Scherze bedeuteten, die das Angebot so mancher Stellungen begleiteten.
Oh, wie wurde man angesehen und taxiert bei der Bewerbung um einige dieser Posten, die nicht Kenntnisse, sondern „Jugend und repräsentable Erscheinung“ als erstes Erfordernis verlangten. Heiß errötend bin ich oft die Treppen hinuntergeeilt, und damals lernte ich begreifen, dass wir auf keine den Stein werfen dürfen, die da erliegt auf dem Kreuzweg der jungen, allein kämpfenden Frau!
In unscheinbarer Form nahte sich endlich mein Glück. Es war ein Posten gegen freie Station und Taschengeld bei einer kränklichen Dame, die meiner Dienste als Vorleserin, Korrespondentin und Gesellschafterin nur des Nachmittags und Abends benötigte. Die Vormittage hatte ich zu freier Verfügung; diesem Umstande danke ich alles weitere. Ein Dach überm Kopf und gesichertes Brot — nun konnte ich das Versäumte nachholen. Ich besuchte Handelskurse, lernte deutsch und englisch stenographieren — ein Jahr später konnte ich mit besserem Erfolge und einem Abgangszeugnis eine Stellung suchen.
Nach einigen Umwegen kam ich zu einem Schriftsteller, der auch für englische Blätter arbeitete, als Sekretärin, und normalerweise sollte hier meine Geschichte enden. Um aber der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich auch das Wunderbare erzählen. Ich wagte ab und zu den schüchternen Versuch, kleine Berichte und Skizzen aus der Großstadt selbständig zu verfassen, Blättern einzusenden, und das wunderbarste daran: sie wurden gedruckt!
Erst tat ich’s nur ganz nebenbei, dann wuchs mein Selbstvertrauen, und so wurde, im Laufe der Jahre, aus dem kleinen Tippfräulein die Schriftstellerin Lina Liszt. Man zog mich zu Vereinen zu, lud mich ein, und so bin ich „Jemand“ geworden, zwar keine Berühmtheit, das bilde ich mir durchaus nicht ein, wohl aber eine brauchbare, geschätzte Arbeiterin in der Tagespresse. Mein Einkommen ermöglicht mir ein behagliches Dasein, und ich kann den Meinen regelmäßig Zuschüsse senden. Meine Schwester hatte ich ein Jahr lang zu Besuch und ließ sie in dieser Zeit einen gründlichen Kursus in Haushaltungskunde, Krankenküche, Obst- und Gemüseverwertung durchmachen. Auf dieser Grundlage hat sie in unserer Heimatstadt auch wieder einen recht gut besuchten Kurs für Schülerinnen eingerichtet.
Nicht wahr, meine Geschichte scheint nun doch noch etwas märchenhaft zu enden, und ich habe recht, wenn ich sage, sie müsste von Rechts wegen bei Stenographieheft und Schreibmaschine schließen? Nichts möchte ich mehr vermeiden als die Erweckung falscher Hoffnungen, ich will wahrhaftig nicht dazu beitragen, die Flut unbrauchbarer und hoffnungsloser literarischer Arbeiten zu steigern. Mit der Feder durchzudringen, ist immerhin etwas wie das große Los zu gewinnen, und schließlich gehört noch eins dazu — ein Fünkchen Talent!
Doch auch ohne das hätte ich einen sichern, ehrenhaften Lebensunterhalt gefunden. Fast alle meine einstigen Kolleginnen aus der Handelsschule sind, soweit sie nicht geheiratet haben und fleißig waren, im Laufe ihrer sechs- bis achtjährigen Tätigkeit gut vorwärts gekommen. Sie beziehen bei Rechtsanwälten, in Geschäftskontoren, bei Privaten Monatsgehälter von 100–140 Mark, sind frische, tüchtige Kämpferinnen, denen das Leben wohl auch Kummer und Schmerz bringt, die aber gelernt haben, ihm Kraft entgegenzusetzen.
Oft werde ich vertrauensvoll gefragt, wie ich’s denn „gemacht“ habe, und um Rat angegangen. Könnte ich euch allen helfen! Ich rate meist zu durchaus praktischen Berufen, und das mag manche enttäuschen, mit denen ich den Kampf gegen das Vorurteil des „nicht standesgemäßen Berufs“ auszufechten habe. Jeder ehrenhafte Beruf ist standesgemäß, wenn er wirklich gut ausgefüllt wird, auf die Persönlichkeit allein kommt es an.
Wir Frauen, meine ich, können aber viel zu vernünftigeren Auffassungen beitragen, indem wir uns bemühen, Berufstätige jeder Art in unseren Gesellschaftskreis einzubeziehen. Schon sind wir ja zum Glück ein gut Stück in der Achtung vor der Arbeit vorwärts gekommen. Ich habe Bekannte, die Putz und Schneiderei ausüben und dabei doch völlig blieben, ‚was sie waren: Gebildete Frauen, die sich auch geistige Interessen bewahrten.
Eine meiner Freundinnen, die in nur kurzer, glücklicher Ehe mit ihrem Manne lebte, ist Hausschneiderin; sie wird überall als zur Familie gehörig betrachtet, erwirbt neben voller Beköstigung 4–5 Mark den Tag, so dass sie weit besser für sich und ihr Kind sorgen kann als durch viele sogenannte höhere Berufe. Als Tapeziererin und Dekorateurin findet ein mir bekanntes junges Mädchen ihr reichliches Auskommen; ihr Geschick beweist, dass Frauen sich ganz vorzüglich für dieses Fach eignen. Ihre junge Schwester ist zurzeit Buchbinderlehrling. Neben der schon lange bekannten Betätigung, die das Lehrfach in den verschiedensten Disziplinen und die Krankenpflege bieten, sah ich erfolgreiche Frauenarbeit auf dem Gebiete der Photographie und Photochemie, neuerdings auch in der Röntgenphotographie.
Tüchtige Kräfte, freilich nur solche, finden stets leicht ein Unterkommen für häusliche Tätigkeit. Verhältnismäßig günstig liegt der Fall da, wo noch genügend gewartet werden kann, um erst eine Ausbildung in irgendeinem Fache zu erlangen. Sich ohne Vorkenntnisse von heut auf morgen selbstständig zu machen, das bedingt einen verzweifelt schweren Kampf, bei dem manche untergehen. Es ist ein Lieblingsplan von mir, den ich hoffentlich bald mit Gesinnungsgenossinnen verwirklichen kann, eine gänzlich unentgeltliche Stellenvermittlung zu schaffen, die sich insbesondere mit der Unterbringung plötzlich zum Erwerb genötigter Frauen und Mädchen befasst und auch in der Lage sein soll, durch eine Darlehenskasse so mancher zum Aufbau einer Existenz zu verhelfen. Solches Geld wäre, wie ich glaube, gut angelegtes Kapital.
All dies aber ist nur Flickarbeit, der Kernpunkt der Frage heißt auch hier: Vorbeugen! Nicht warten, bis ein Unglück hereingebrochen! Es ist Pflicht der Eltern, genau so wie ihre Söhne auch ihre Töchter instand zu setzen, sich ihr Brot zu verdienen. Die besten Vermögensverhältnisse, die glücklichste Ehe bieten keine lebenslängliche Glücksgewähr. Ein ganzer Mensch darf nicht immer auf die Hilfe anderer angewiesen bleiben. Es kommt wenig darauf an, welchen Beruf man wählt, wenn man nur ein Fach wirklich beherrscht. Kenntnisse haben noch keinem geschadet, ihr Mangel hingegen ist eine nie versiegende Quelle tausendfachen Elends. Lasst eure Töchter tüchtige Menschen werden, nicht Zierpflanzen, und gebt ihnen überdies das Wort Th. Vischers mit auf den Weg:
„Weichheit ist gut an ihrem Ort,
Aber sie ist kein Losungswort,
Kein Schild, keine Klinge und kein Griff,
Kein Panzer, kein Steuer für dein Schiff.
Du ruderst mit ihr vergebens.
Kraft ist die Parole des Lebens:
Kraft im Wagen,
Kraft im Schlagen,
Kraft im Behagen,
Kraft im Entsagen,
Kraft im Ertragen,
Kraft bei des Bruders Not und Leid
Im stillen Werk der Menschlichkeit,
Wenn Euch die Geschichte gefallen hat, hier sind weitere schon veröffentlichte Geschichten aus dem Preisausschreiben bzw. Buch „Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt“:
„Die Lithographin“ , „Vom Sprachunterricht zum Kunstgewerbe“ , „Ein Besorgungsinstitut“ , „Die Lehrerin“ , „Am Telefon“ und „Mit dem Kochlöffel“, „Mit eigenem Anbau zum Erfolg“