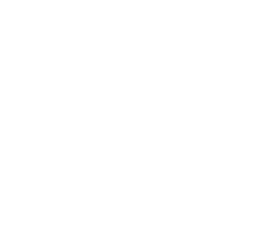Fortsetzungsreihe: Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt – Frauen erzählen ihr Schicksal: Am Telefon
Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt – Frauen erzählen ihr Schicksal: Am Telefon
Wer die ersten Geschichten schon gelesen hat, kann gleich zur heutigen Geschichte im nächsten Absatz springen.
Für alle anderen möchte die Story hinter der Fortsetzungsreihe noch einmal kurz erzählen: Im Jahre 1905 veranstaltete die Wochenzeitschrift „Die Gartenlaube“ ein Preisausschreiben mit dem Thema „Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt“. Dabei ging es um Frauen, die plötzlich selbst ihren Lebenunterhalt verdienen mußten, meist aufgrund von Schicksalsschlägen. Denn es war zu dieser Zeit keineswegs selbstverständlich, dass Frauen überhaupt eine gute Schul- und Berufsausbildung hatten, meistens eher nicht. War doch ihre gesellschaftliche Aufgabe vor allem als Hausfrau und Mutter festgelegt. Das änderte sich jedoch in dieser Zeit: Es entstanden neue Mädchenschulen, Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen und auch die Möglichkeit zu studieren. Man mußte natürlich das nötige Kleingeld dazu aufbringen.
Zurück zum Preisausschreiben, die Resonanz auf die eingesandten Geschichten war anscheinend sehr groß und so wurden die besten und interessantesten Geschichten im Frühjahr 1906 als Buch herausgegeben. Zur Auswahl heißt es im Vorwort:
„Dem Zweck des Preisausschreibens hätte es nicht entsprochen, wenn nur der literarische Wert der Arbeiten für unsere Auswahl maßgebend gewesen wäre; für die Aufnahme entscheidend war vornehmlich der Nutzen, den Schicksalsgenossen aus diesen Schilderungen der Kämpfe und Siege ihrer Mitschwestern ziehen können“.
So haben die Aufsätze der erzählenden Frauen auch oft einen solidarischen Ton und geben anderen Rat. Und als Ratgeber war das Buch auch vorwiegend gedacht, auch wenn die Schilderungen der Schicksale oft spannend und auch dramatisch sind.
Auf der Seite sind schon einige Geschichten aus dem Buch bzw. Preisausschreiben veröffentlicht worden, die Links dazu findet Ihr am Ende der Geschichte.
Am Telefon
Liebe, treue Hermine!
Länger sollst Du nicht im ungewissen über mich bleiben. Deinen dritten flehenden Brief erhielt ich gestern und beantworte ihn nun sofort, nachdem ich ein Jahr lang aus Gram und Trotz, aus Zeitmangel, ach aus tausenderlei Gründen geschwiegen. Dafür erhältst Du heute ein wahres Briefpaket: die Schilderung des letzten, unsäglich schweren Jahres, in dessen Verlauf ich vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt wurde.
Es ist furchtbar, wenn sich zwei Augen für immer schließen. Als Vater starb, konnte ich noch nicht ganz die Tragweite ermessen. Ich war noch so jung: Die Schule bot mir Zerstreuung, und kam ich nach Hause, musste ich mein geliebtes Mütterchen über den Verlust aufheitern, wir hatten ja nur uns beide. Auch als erwachsenes Mädchen suchte ich keinen Verkehr; das weißt du ja. Ich hatte durch tausend Nadelstiche erfahren, was es heißt, ein armes Mädchen höherer Stände zu sein. Mütterchens kleine Pension reichte für uns, die Miete für unsere Wohnung im grün umsponnenen Vorstadthäuschen war nicht hoch; so gingen viele stille Jahre dahin, bis ich einen Tag nach meinem zwanzigsten Geburtstag meine geliebte Mutter entschlummert fand. So sacht war sie hinübergegangen, dass selbst meine heiße, sorgende Liebe nichts gespürt, und ich nun unvorbereitet vor dem Unfasslichen stand.
Zuerst war ich wie gelähmt, aber die erbarmungslose Wirklichkeit rüttelte mich mit harter Faust, ich musste mein wundes Herz in beide Hände nehmen und tapfer sein. Verwandte haben wir nicht, wie Du weißt, außer dem entfernten Onkel Jobst, der auch mein Vormund geworden ist. Aber schon vor zwei Jahren, als es Muttchen einmal kümmerlich ging, wies er jede Unterstützung mit der Bemerkung ab, es sei „meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, einen Beruf zu ergreifen, wie hundert andere Mädchen auch“. Ich schrieb nun an ihn, meldete den Tod der Teuren und erhielt einen Brief, worin er über schlechte Zeiten klagte, über seine studierenden Söhne schimpfte, die viel verbrauchten, und mir im übrigen viel Glück für die Zukunft wünschte.
Zur Beerdigung kam er nicht. Nur drei Menschen gaben Mütterchen das letzte Geleit: unser alter Wirt, ein einfacher Volksschullehrer von tiefer Herzensbildung, ein halb vergessener Regimentskamerad meines Vaters, der auf der Durchreise zufällig das Hinscheiden meines Mütterchens in der Zeitung gelesen hatte, und ich.
Oberst von Wilhelmi empfahl mich auch sofort einer Bekannten, welche eine „Stütze“ suchte, Und schon nach acht Tagen befand ich mich in H. Von unseren lieben Möbeln hatte ich die wertvollsten zurückbehalten, weil Verkauf oder Versteigerung gar zu wenig einbringt. Herr Christlieb, unser guter Hauswirt, stellte mir alles gegen ein geringes Entgelt in ein unbenutztes Stübchen, und seine Frau versprach mir, auf Staub und Motten zu achten. Auch sämtliche Wäsche behielt ich und packte den Küchenschrank voll Porzellan. Wie schwer war es, sich auch nur von einem Stück zu trennen, aber es musste sein. Ich nahm Abschied von vielen lieben Andenken, die dann zur Versteigerung wanderten. Der Erlös daraus betrug 300 Mark; es war noch verhältnismäßig viel, wie mir der alte Lehrer sagte.
Von dem Vierteljahr als „Stütze“ bei Frau Fabrikant A. könnte ich Dir wohl Bände schreiben, will’s aber nicht tun, um nicht bitter zu werden. Als „Stütze der Hausfrau“ mit 20 Mk. Monatsgehalt kam ich. Ein kleines, unendlich ärmlich möbliertes, halbdunkles Zimmer nach dem Hofe hinaus war mein eigentliches Heim in dem zweistöckigen, geräumigen Hause. Um halb sechs Uhr morgens musste ich aufstehen, gleich mein Zimmer in Ordnung bringen und das übrige Tagewerk beginnen. Weißt Du, Hermine, es war keine geregelte, stramme Arbeit, wie ich sie sonst gewohnt war, abwechselnd mit lieben Muße – d. h. Handarbeitsstunden, sondern ein planloses Hetzen treppauf und treppab unter Schelten und Geschrei der vier schulpflichtigen Kinder, des Hausherrn, der Hausfrau und der zwei Dienstboten. Fünf Köchinnen und drei Stubenmädchen wechselten in diesem Vierteljahr — ich harrte aus, denn ich schämte mich, einzugestehen, dass ich mich diesen Anforderungen nicht gewachsen fühlte. Aber dann kündigte man mir. Meine Füße waren in den letzten Wochen arg angeschwollen, ich konnte nur schwer gehen und vor allen Dingen konnte ich einen Punkt meines Vertrages nicht erfüllen: ich sollte in meinen „Mußestunden“ der Dame des Hauses vorlesen. Aber diese Mußestunden fand ich nur abends nach 10 Uhr, wo ich regelmäßig über dem Buche „Helene oder die Rache der Betörten“ einschlief.
So schickte man mich fort; ich musste noch hässliche Worte, wie „Tränenweide“ und „Hochmutsprinzessin von Habenichts“ einstecken, aber ich war zu müde, um mich irgend zu wehren. Ein jämmerliches Fiasko, Hermine — mein erster wirtschaftlicher Kampf! Doch »nunquam retrorsum“ „niemals zurück“, heißt der Wahlspruch unseres Geschlechts.
Äußerlich musste ich freilich zurück, wenigstens hierher zum alten Lehrerpaar, das mich freundlich aufnahm; bei ihm erholte ich mich durch fleißige Wechselfußbäder und Ruhe.
Ich konnte nach vierzehn Tagen meine neue Stelle antreten; erhielt sie durch Anzeige und zwar in der Nähe bei Frau Amtsrichter von R. Ehe ich dorthin übersiedelte, erwog ich mit dem alten Lehrer den Plan, das Seminar zu besuchen und trotz meiner zwanzig Jahre nach dreijährigem Kursus das Examen für Volksschullehrerinnen zu machen. Das zerschlug sich. Aus eigenen Mitteln konnte ich es nicht durchführen, und ein Brief an Onkel Jobst, den ich bat, die nötige Summe vorzustrecken, wurde so zornig beantwortet, dass ich es nicht wagen werde, mich jemals wieder an ihn zu wenden, auch in der höchsten Not nicht, vor der mich Gott bewahren möge.
Bei Amtsrichters waren sechs lebendige, wilde, gute Kinder von acht bis einem halben Jahr. Großes Haus, großer Garten, dazu eine Menge Besuch, viel mehr Arbeit als in dem erstbeschriebenen Haushalt, d. h. richtige planmäßig eingeteilte Arbeit und alles durchsonnt von der Herzenswärme der Hausfrau und dem guten, frohmütigen Regiment des Herrn Amtsrichters. Dies wäre mir eine dauernde Heimat geworden, aber auch in dies Haus trat der Tod. Zwei der herzigen Kinder mussten wir innerhalb acht Tagen an Diphtheritis sterben sehen, und dann starb die junge, prächtige Frau. Als sie begraben wurde, lag ich bereits am gleichen, heftigen Scharlachfieber im Krankenhaus des kleinen Städtchens. Wie oft habe ich mich damals gefragt: warum starb ich nicht, die ich so vereinsamt bin? Warum diese unersetzliche Mutter? Ach, warum? Törichte, quälende Frage unzähliger Menschenherzen, die sich dem Allweisen, Allwissenden nicht fügen wollen!
Nachdem ich genesen, ging ich zu dem gänzlich gebrochenen Witwer, teils, um mich zu bedanken, da er in hochherziger Weise die Kosten meiner Krankheit übernommen hatte, teils um meine Dienste weiter zur Verfügung zu stellen. Letzteres war überflüssig, denn die Mutter seiner Frau hatte bereits die Führung des Haushalts übernommen, und eine Schwester der Verstorbenen ersetzte die Stütze. Also wieder zum Lehrerpaar zurück! Aber nicht flügellahm, sondern neue Pläne schmiedend. Ein junger verwandter Kaufmann war inzwischen zu ihnen gezogen, und bei ihm lernte ich in kurzer Zeit die Bedienung der Schreibmaschine, wofür ich mich durch französische und englische Nachhilfestunden erkenntlich zeigte. Ich fand dadurch Beschäftigung bei einem Generalagenten der Feuerversicherung, aber nur aushilfsweise für kurze Zeit, denn der Andrang war wahrhaft ungeheuer.
Dass ich jede unnütze Ausgabe vermied, brauche ich Dir wohl nicht erst zu sagen. Ich war in Kost und Wohnung bei dem lieben Lehrerpaar und half zum Dank für ihre geringe Berechnung meines Unterhaltes im Haushalte, wo ich nur konnte. In den Nachmittagsstunden stickte ich Wäsche für ein hiesiges Geschäft, eine Arbeit, die aber meine Augen hart angriff und sehr schlecht bezahlt wurde. Als trotz aller Sparsamkeit mein kleines Sümmchen stetig schmolz, nahm ich eine Stelle als Empfangsdame in einem hiesigen großen photographischen Atelier an, wo auch meine fremdsprachlichen Kenntnisse gewünscht wurden — wieder ein Reinfall, noch gründlicher als der erste. Doch war es wohl meine Schuld. Ich eignete mich gar nicht für den Posten, war viel zu jung und zu „scheu“, wie mir der „Chef“ sagte, der aber meine französische Aussprache sehr lobte. Aber einen ganzen Monat hat er mich doch behalten, dreißig Tage voll Demütigungen, doch eine gute Schule für mich! Nun blieb ich wieder sechs Wochen „daheim“. Welch‘ süßen Klang hat sonst dies Wort, nur nicht für mich.
In diesen sechs Wochen übernahm ich eine Schuhlieferung für ein Stickgeschäft in Leipzig, für welches früher eine verstorbene Tante von mir arbeitete. Du kennst ja die warmen, zweifarbigen, außen „Nuppchen“, innen weiche Wollschlingen zeigenden Schuhe mit Filzsohlen, die wir nach einer Familientradition „Nalchen“ nannten. Die Firma antwortete auf meine Anfrage sehr höflich und erfreut, dass sie mir gern auch für die Zukunft diese Schuhlieferung übertrüge, falls ich so gefällig und rasch arbeitete wie meine verstorbene Verwandte, für die sie noch keinen Ersatz gefunden hätte. Für jedes Paar Schuhe brauchte ich eine Lage schwarzer Kastorwolle und ungefähr zwei Lagen farbiger Zephirwolle, ein Stückchen Watte zum Füttern der Sohlen und etwas Flanell, um ihn auf der Watte zu befestigen. Aus Resten der farbigen Zephirwolle fertigte ich auch die Ausputzrosetten, wenn nicht Bandschmuck gewünscht wurde, wozu ich ein Meter schmales Seidenband für jedes Paar Schuhe brauchte. Meine Auslagen betrugen für ein paar Schuhe 1 Mark 60 Pfg. bis 1 Mark 80 Pfg. Für die fertigen Schuhe erhielt ich 3 Mark. Die fünfundzwanzig Paar, die ich nach sechs Wochen ablieferte, hatten großen Beifall, und ich freute mich des Sümmchens und freue mich noch auf die kommenden langen Winterabende, an denen ich — trotz kaiserlichen Dienstes — fleißig stricken will. Ja, höre und staune: trotz kaiserlichen Dienstes!
In all den einsamen Strickstunden hatte ich vollauf Zeit, an meine weitere Zukunft zu denken und mir eine dauernde, feste Lebensstellung als das Erstrebenswerte auszumalen. So verfiel ich in meinem Grübeln und Sinnen auch auf die Post, auf das Amt einer Fernsprechgehilfin. Aber ich hatte niemand in der großen, weiten Stadt hier, der mir hätte raten, niemand, der mich den rechten Weg hätte führen können. Daher schrieb ich an Oberst von Wilhelmi, und von nun an leuchtete mir ein freundlich heller Stern. Sein Bruder ist Vorsteher des Militär-Postamts in L. und schickte mir sofort in liebenswürdiger Weise die Annahmebedingungen, die mich zu weiteren Schritten ermutigten: natürliche Anlagen und guter Gesundheitszustand, Eifer und Trieb für den Beruf, Ordnungssinn, Zuverlässigkeit, Achtung und Folgsamkeit gegen Vorgesetzte, richtiges Benehmen gegen Mitarbeiter, sittlicher Lebenswandel, Wohlerzogenheit, allgemeine Gewandtheit, achtbare Familie, Alter 18 bis 30 Jahre.
Von meiner Allgemeinbildung wurde verlangt, dass ich ein gutes Deutsch sprechen und schreiben könne; dazu würde eine Prüfung kommen: Aufsatz, Rechnen in den vier Rechnungsarten, Erdkunde und Französisch. Nun schrieb ich erst einmal an meinen Vormund und erhielt seine schriftliche Einwilligung zu meinem Vorhaben. Mein nächster Weg war zum Postvertrauensarzt Dr. N.. Seine Untersuchung ergab, dass ich von entstellenden Gebrechen frei, kräftig gebaut und mit gesunden Atmungsorganen ausgestattet sei, und dass Stimme, Augen und Ohren in guter Verfassung seien. Hierauf begleitete mich mein Hauswirt nach der Polizei, wo mir ein Führungszeugnis „vom Schulabgang an bis jetzt“ ausgestellt wurde.
Zu Hause angelangt, nahm ich einen großen Bogen weißes Papier, Reichsformat, zur Hand und schrieb einen kurzen Lebenslauf. Einen zweiten großen Bogen knickte ich in der Mitte längs und schrieb in die linke Spalte oben: Gesuch der Rose Duras um Annahme als Fernsprechgehilfin. Hierbei sieben Anlagen.
In die rechte Spalte schrieb ich:
N., den 19. Juli 190.
Der Kaiserlichen Ober-Postdirektion überreiche ich in den Anlagen 1. einen Lebenslauf, 2. eine Geburtsurkunde, 3. ein Schulabgangszeugnis, 4. ein ärztliches Zeugnis, 5. ein Polizei-Führungszeugnis, 6. eine Einwilligungserklärung meines Vormundes, 7. eine Erklärung, dass ich frei von Schulden bin, mit der Bitte, mich, wenn angängig, als Fernsprechgehilfin annehmen zu wollen.
Rose Duras.
Wohnung: Beethovenstraße 33, bei Herrn Lehrer Christlieb.
Hierauf wurde ich nach einigen Tagen zur Prüfung vorgeladen und erhielt kurze Zeit später den Bescheid: „Die von Ihnen gefertigten Prüfungsarbeiten sind genügend ausgefallen. Sie sind daher zur Beschäftigung im Post- und Telegraphendienste vorgemerkt worden. Dabei werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass sich zu Ihrer Einstellung in den Dienst noch keine Gelegenheit bietet, da der Bedarf an Gehilfinnen zurzeit gedeckt ist.“
Also „warten“! Ach, es mag sich wohl geduldig im Elternhause warten, wenn man die Füße unter den gedeckten Tisch setzt, sei dieser auch noch so einfach bestellt. Aber schwer wartete es sich unter meinen Verhältnissen. Doch „Kopf hoch!“ Mut nicht verlieren, Geld verdienen, nunquam retrorsum! Das Leipziger Geschäft ließ mich Schuhe auf Vorrat stricken und bezahlte immer sofort. Außerdem erhielt ich Privatkundschaft durch Frau Lehrer Christlieb. Und ein freundliches Geschick wollte es, dass ich sogar mit einem Pfunde wuchern konnte, das ich bisher kaum beachtet: mein Talent zum Reimen. Eine Bekannte meiner Wirtsleute ist an einen Großbauern im Dorfe Lindenfeld verheiratet, und dieser Großbauer bestellte bei mir ein Hochzeitsgedicht. Ich schrieb es auf einen großen Bogen, malte mit Wasserfarben glühend rote Rosen und leuchtend blaue Vergissmeinnicht flott als Umrahmung und erhielt für meine Arbeit — sage und schreibe — zehn Mark. Und nicht genug! Drei Tage lang konnten wir uns am köstlichen Hochzeitskuchen den Magen verderben und in Gestalt von drei prächtigen Mettwürsten hielt Lukullus Einzug in mein Stübchen. Das Ende ist nicht abzusehen. Dieser Hochzeit sind schon wieder andere Dorffestlichkeiten gefolgt. Ich habe inzwischen Tauf- und Sterbegesänge verfassen müssen und bekam je nach dem Eindruck, den sie machten, eine bis fünf Mark, immer aber Kuchen, Wurst, Speck und Schmalz dazu. Ach, und die Verwandtschaft des Großbauern ist so unabsehbar groß!
Siehst Du, liebste Hermine, auf allen meinen Unternehmungen spüre ich den Segen meines Mütterchens.
Dann kam der erste große Tag, an dem mir von der hiesigen Ober-Postdirektion eröffnet wurde:
„Sie sollen im Telegraphen- und Fernsprechdienste ausgebildet werden um bei sich darbietender Gelegenheit zunächst aushilfsweise gegen Tagegelder beschäftigt zu werden. Für die Zeit der Ausbildung haben Sie keinen Anspruch auf Bezahlung aus der Postkasse. Zu Ihrer Verpflichtung und Ausbildung in den genannten Dienstzweigen wollen Sie sich am 22. August vormittags 10 Uhr bei dem Vorsteher des Kaiserlichen Telegraphenamtes, Herrn Telegraphendirektor Theo, melden.“
Gesagt, getan! Vier Monate dauerte meine Ausbildung. Da galt es wieder nebenbei für das liebe tägliche Brot zu sorgen. Zu diesem Zwecke verwertete ich noch eine andere Fertigkeit: ich servierte in feinen Häusern, deckte die Tafel zu Mittag- und Abendessen, zu Kaffeeschlachten und seinen Tees und schmückte alles zierlich mit den mir zur Verfügung gestellten Blumen. Mein Servieranzug bestand aus einfachem, schwarzem Rock, weißer Satinbluse, weißem Leinenkragen und schwarzem Schlips. Beinahe auf jeder Stelle erhielt ich vier bis fünf Mark und war spätestens um 11 Uhr abends immer zu Hause.
Demütigungen gab es auch hierbei zu verwinden. Aber wie viel Liebe Häuslichkeiten lernte ich dafür wieder kennen! Damen, die mir gütig die Hand drückten, die Wange streichelten und mich auf jede Weise vergessen lassen wollten, dass die Sonne des Glückes den Menschen verschieden lache.
Während meiner Ausbildung im Fernsprechdienst erfuhr ich, dass ich, nachdem sie vollendet, nur dann Bezahlung zu erwarten habe, wenn ich zur Aushilfe oder vollen Beschäftigung einberufen würde, dass mir auch dauernde Beschäftigung nicht in Aussicht gestellt werden könnte, sondern dass ich die Behörde vorbehielte, je nach Gestaltung der Betriebsverhältnisse mich zeitweise unter Wegfall der Tagegelder außer Tätigkeit zu setzen. Aber was focht das mich an?! Mein Mut war durch all die kleinen Aufmunterungen des Schicksals ins Ungeheure gewachsen; ich hoffte weiter, und siehe da, ich wurde schon vom 1. Oktober ab als „Telegraphengehilfin“ auf Probe angenommen und genieße als solche die Rechte und Pflichten eines Reichsbeamten. Freilich gewährt mir meine Stellung vorläufig keinen Anspruch auf Zulage oder Unterstützung, und wenn ich mich verheiratete, würde ich sofort mein Amt verlieren. Aber vor Krankheit wird mich unser Herrgott hoffentlich bewahren, und vor einem Manne bin ich bei meiner großen Armut sicher.
Auch eine Uniform, dunkelblaue Bluse mit blanken, glatten Messingknöpfen und orangefarbenem Vorstoß, haben wir „Blitzmädel“, wie der Volksmund uns nennt. Und ich fühle mich wohl in dieser Haut. Das Gehorchen wird mir nicht schwer, da meine Vorgesetzten überaus gütig sind; und liebe, verträgliche Kameradinnen erleichtern mir den Übergang in die mir völlig fremde Welt. Zwei davon stehen mir besonders nahe: Marie Hardlin, die Tochter einer Arztwitwe, und Frida von Ludwig, Offizierswaise wie ich. Das Publikum ist im Allgemeinen höflich; es würde wohl oft noch geduldiger und rücksichtsvoller sein, wenn es wüsste, wie anstrengend der Dienst für uns ist, und wie tapfer man dabei seine Nerven bezwingen muss.
An Tagegeldern bekomme ich 2 Mk. 25 Pfg. täglich, also 67 Mk. 50 Pfg. im Monat, nach zwei Jahren 2 Mk. 50 Pfg., nach vier Jahren 3 Mk Bis jetzt bin ich noch nicht beschäftigungslos gewesen. Nach neunjähriger Dienstleistung werde ich mit 1100Mk. Jahresgehalt und 432 Mk. Wohnungsgeldzuschuss etatsmäßig angestellt; nach zwölfjähriger Dienstzeit steigt das Gehalt auf 1500 Mk. Durch meine größeren Kenntnisse in fremden Sprachen kann mir auch jetzt schon mancher Vorzug und eine kleine Mehreinnahme erwachsen. Und so will ich Arbeit, Arbeit und nochmals tapfere Arbeit meine Losung sein lassen, von meinen jetzigen Einnahmen bezahle ich 35 Mk. für Kost und Wohnung bei meinen lieben Lehrersleuten, benutze aber meine eigenen Möbel und eigene Wäsche. Unser altes, trautes Wohnzimmer mit dem grün umsponnenen Altan ist mein Heim; ich habe es genau so eingerichtet wie früher, und über dem Zylinderbüro hängen die großen Ölbilder von Väterchen und Mütterchen. Komme ich dann abends nach anstrengendem Dienst nach Hause, dann halte ich köstlich stille Zwiesprache mit ihnen und spiele auf unserm alten, wunderbar erhaltenen Spinett, was Mütterchen so liebte, und singe den beiden, die aus mich herniederschauen, alte, liebe Weisen vor.
„Es geht ein Liedchen im Volke,
Die Mädchen singen’s zur Nacht,
Wenn unter den blühenden Halmen
Im Garten die Sehnsucht erwacht“
Ja, Sehnsucht habe ich wohl unablässig nach den lieben Heimgegangenen, aber sie ist gemildert durch meine Arbeit, durch den Gedanken an mein zielbewusstes Vorwärtsschreiten. Nunquam retrorsum! Gott behüte uns beide, liebe, alte Freundin!
Deine tapfere
Rose Duras.
Hier geht es zu den weiteren schon veröffentlichten Geschichten: „Die Lithographin“ und „Vom Sprachunterricht zum Kunstgewerbe“ , „Ein Besorgungsinstitut“ und „Die Lehrerin“