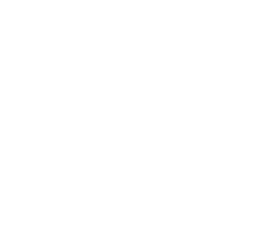Vergessene Zeugen des Alpenraums
Ein Gastartikel von Georg Jäger
Einleitung
Georg Jäger hat sich mit jenen ländlichen Schichten im alpinen Raum beschäftigt, die in der traditionellen Geschichtsschreibung nur eine Randnotiz gewesen sind und über deren Leben bis dato wenig bekannt gewesen ist. Sie hatten als Kleinhäusler wenig oder keinen Besitz, waren trotz harter Arbeit wenig geachtet und gingen teilweise auch, meist aus Not, verbotenen Beschäftigungen wie dem Wildern nach.
Selbst Nachkomme einer armen Kleinhäuslerfamilie aus dem Sellraintal, gelegen in den nördlichen Stubaier Alpen, möchte er mit seinen Recherchen zum Leben dieser Menschen (zu denen er mehrere Bücher verfasst hat, die am Ende noch vorgestellt werden) ein anschauliches Bild ihres Lebens vermitteln und die Erinnerung an diese untergegangenen Lebensformen wachhalten.
Bittere Armut war früher die auffälligste Begleiterscheinung des Lebens im „Land im Gebirge“. Ebenfalls große Not herrschte in anderen Alpenländern. Die Bevölkerung mit wenig oder überhaupt keinen Grundbesitz kämpfte ums nackte Überleben und hatte kaum eine Zukunftsperspektive. Sie lebte am Rande der Gesellschaft und war auf die Mobilisierung sämtlicher zur Verfügung stehender Ressourcen angewiesen, um sich eine eigene Existenzgrundlage aufbauen zu können. Neben den im Berufsleben stehenden erwachsenen Personen mussten auch Kinder, Jugendliche und Alte mitarbeiten bzw. mitanpacken.
Den Söllhäuslern auf der Spur – das starke Geschlecht
Die ländliche Bevölkerung erscheint dem Städter als eine fast ausschließlich von der Agrarwirtschaft geprägte Gesellschaft, sodass häufig alle Bewohner am Land mit dem Bauernstand gleichgesetzt werden. Geschichtlich gesehen lassen sich jedoch drei bäuerliche Schichten nachweisen, nämlich die über Grund und Boden verfügenden Bauern sowie die Kleinhäusler und Häusler als Nach- und Spätsiedler. Der Fokus dieses Beitrags wird auf das Kleinhäuslertum gelegt.
Zu den Kleinhäuslern (= Söllhäusler, Söll-Leute, Seldner oder Keuschler) gehörten u. a. neben den Maulwurf- und Schermausfängern auch die Ziegenhirten. Während die Besitzer von Söllbehausungen einer handwerklich-gewerblichen Tätigkeit nachgingen und noch ein eigenes Dach über den Kopf hatten, waren die saisonal beschäftigten „Scherfoacher“ und/oder „Mauser“ in größeren Bauernhäusern untergebracht. Die Entlohnung der bei den Bauern im Frühjahr und Herbst sehr willkommenen Maulwurfsfänger erfolgte gegen Ablieferung der Maulwurfsschwänze. Die Maulwurfsfelle wurden getrocknet und zum Kürschner gebracht, wo man sie zu einem Mantel verarbeitete, dem „Pelz des kleinen Mannes“.
Das gemeinsame bzw. verbindende Merkmal dieser namentlich angeführten Bevölkerungsgruppen war ihr Leben am Existenzminimum. Die Angehörigen des Kleinhäuslertums waren im Unterschied zum eigentlichen Bauerntum nicht auf die Butterseite gefallen. Dabei handelt es sich – wie der Name sagt – um besitzlose oder bodenarme Landbewohner, die auf einen Nebenerwerb angewiesen waren.
So erzeugte ein 60-jähriger Nagelschmied in einem 15-Stunden-Tag 1000 Flügelnägel und benötigte für jeden einzelnen Nagel nicht weniger als 30 Hammerschläge. Meist litten die Vertreter dieses Gewerbes unter Verkümmerungen der Wirbelsäule, Rheumatismus und Deformierungen der Hände. Wörtlich schwere Lasten hatten die Kraxenträger aus dem Passeier- und Zillertal zu tragen. Andere Seldner verdingten sich als Taglöhner in der Land- und Forstwirtschaft, arbeiteten im Bergbau oder als Schneider, Schuster, Maurer, Zimmermann, Binder oder Seiler.
In Nord-, Süd-, Ost- und Welschtirol wurden im Jahr 1780 neben 55.000 Bauern nicht weniger als 82.000 Kleinhäusler gezählt. Ursprünglich vom Bergbau, Kleingewerbe, Hand- und Tagwerk lebend, konnten sie allmählich Grund und Boden erwerben und waren dadurch zu Kleinbauern geworden. Ihr spärlicher Viehbestand umfasste meist nur eine Kuh sowie einige Ziegen und Hühner.
Lebensfreude trotz bitterer Armut
Die in ihrem Besitz stehenden exponiert gelegenen Söllhäuser grenzten oft an Wildbäche, wie z. B. die hochwassergefährdete Ansiedlung Gand im Martelltal. Die Söllgüter oder Keuschen lagen meist auf der Schattseite (= Nederseite) und wurden von den wohlhabenden Bauern abwertend als „Bruchbuden“ oder „Baracken“ bezeichnet. In der Kirche und im Wirtshaus hatten die Kleinhäusler nur Zugang zu den ihnen ausdrücklich zugewiesenen Plätzen.
Die abwertende Bezeichnung „Goaßbäuerle“ (= Geißbauer) kränkte die auf kleinen Gütern lebenden Bewohner sehr. Deshalb wollten die Ziegenhalter Kuhbauern werden und aus dieser in der Dorfgemeinschaft wenig geachteten Schicht der Kleinhäusler heraustreten. In nicht wenigen Fällen war aber aus Geldmangel ein Kuhkauf nicht möglich.
Gerade die Kleinhäusler verloren, obwohl sie im Vergleich zum Bauernstand viel mehr Existenznöte und damit auch größere Sorgen hatten, nie ihren Humor, wenn es beim Theologen Josef Anton Schöpf im Jahr 1887 über die Oberinntaler Gemeinde Telfs heißt: „Das Dorf ist groß, zählt viele Leute, meistens Kleinhäusler, die wenig zum beißen haben. Trotzdem wird fast nirgends so viel gesungen, gejutzt, geschnadert, als wie in Telfs. Die armen Leute sind zufrieden und fröhlich …“
Die Ziegen als Kühe der Armen
Neben den Kleinhäuslern prägten auch die Ziegenhirten das Ortsbild im Alpenraum, wobei nicht wenige beim Geißhüten im steilen Gelände auf tragische Weise ums Leben kamen. Die „Goaßbuben“ (Goaß = Geiß, Ziege) waren als Halb- oder Vollwaisen aus den ländlichen Unterschichten überhaupt die ärmsten Burschen im Dorf und mussten mit ihren Bockshörnern von Frühjahr bis Herbst auf die meckernden Ziegenherden aufpassen und schon in aller Herrgott’s Früh nach einer kurzen Nacht, oft auch schlafbrechend, die Geißherde des Dorfes zu den Weidegründen führen.
Die „Goaßhirten“ bildeten die unterste Stufe der im Gemeindedienst tätigen Personen. Der Geißbub stand innerhalb der bäuerlichen Dienstboten nach dem Großknecht, dem zweiten, dritten und vierten Knecht sowie dem Fütterer an sechster und damit an letzter Stelle. Die tägliche Arbeit der Ziegenhirten begann den ganzen Sommer über um sechs Uhr morgens und dauerte bis acht Uhr abends. Für diesen beschwerlichen 14-Stunden-Tag gab es in der Regel nur eine geringe Entlohnung, meist eine Lodenhose und ein Paar Schuhe. Allerdings musste der Geißhirt auch von den Ziegenbesitzern abwechselnd verköstigt werden.
Am schlimmsten sah der Ziegenbuben-Alltag bei Schlechtwetter aus, wenn es tagelang in den Tiroler Bergen regnete, schneite und kalter Wind wehte. Der erst neun bis zwölf Jahre alte Junge war häufig barfuß unterwegs, hatte höchstens eine alte Decke oder einen Sack mit, um sich hineinzuwickeln. Abends kroch er dann mit seinen nasskalten Zehen ins feuchte Heulager, denn richtige Betten für Geißbuben gab es keine.
Alle Fotos Bildarchiv Georg Jäger
Hungerleidende Ziegenhirten
Der deutsche Reiseschriftsteller August Lewald (1792–1871) schildert im Jahr 1835 in seinem Werk „Tyrol, vom Glockner zum Orteles, und vom Garda- zum Bodensee“ die Erlebnisse auf der Fragsburg bei Meran. Während der Sommermonate arbeitete dort die verwitwete Moidl als alleinerziehende Mutter. Und ihr Sohn musste immer wieder mit leerem Magen die Ziegen hüten:
„Unsere arme Moidl (Marie) aus Hafling hatte noch einen kleinen Jungen von sechs Jahren oben in ihrem Häuschen, den sie stets auf drei Tage mit einem Brei von Blende (= Plenten, Anm. G. J.) und Milch zu versehen pflegte. Nach drei Tagen ging sie dann wieder zu ihm hinauf, um weiter für ihn zu sorgen; hatte er starken Appetit gehabt und war früher mit dem Proviant fertig geworden, so musste er hungern, bis dass die Mutter kam, und kam die Mutter nicht zur rechten Zeit, so hungerte er auch länger, denn dass die andern ihm etwas gegeben hätten, daran war nicht zu denken, das waren selbst sehr arme Leute. Aber oben bleiben musste er, denn wer würde sonst die Ziegen gehütet haben?“
Nach diesem düsteren Einblick in die Welt der Kinderarbeit am Beispiel der Ziegenhirten wenden wir uns anschließend dem grauen Arbeitsalltag der Frauen zu, die in der Vergangenheit genauso wie in der Gegenwart oft Übermenschliches leisten mussten bzw. tagein tagaus leisten müssen.
Frauenpower im alpinen Raum
Die Mehrfachbelastung mit verschiedenen Aufgabenbereichen prägte das Leben der Bergbäuerinnen und Kleinhäuslerinnen im Alpenraum. Das weibliche Geschlecht war früher ja nicht nur mit den Innenarbeiten (Haushalt – Kochen, Kindererziehung, Schule – Hausaufgaben usw.) voll ausgelastet, sondern musste als Draufgabe auch im Außenbereich auf den Feldern und Wiesen ihren „Mann“ stellen.
So hat meine eigene Großmutter aus Sellrain während des Zweiten Weltkriegs allein auf dem Bergmahd (= Bergwiese) gearbeitet, schwere „Buren“ (= Heubündel) und sperrige „Stangger“ (= Holzgerüste zum Heutrocknen) getragen. Oder die Paznaunerin Agnes Walser aus Ischgl/Versahl, die bis ins hohe Alter Socken und Handschuhe für das Tiroler Heimatwerk strickte, Brennnesseln sammelte und sie mit Heublumen zu einer Schweinesuppe abbrühte und dann abgekühlt verfütterte.
Nach neueren Untersuchungen hätten die Frauen im Alpenraum überhaupt zwei Drittel der anfallenden Arbeiten verrichtet. Besonders berührt haben mich als Sellrainer die dort ansässigen Stadtwäscherinnen, die bis in die 1970er-Jahre hinauf neben ihrer Tätigkeit in der Berglandwirtschaft noch zahlreichen Innsbrucker Haushalten und Gasthöfen die Schmutzwäsche im Sellraintal gewaschen haben.
Schlafbrechende Trägerinnen
Es soll von jenen Frauen erzählt werden, die neben Hausarbeit und Kindern auch noch ein Zubrot verdienen mussten, um die Familie durchzubringen. Obwohl die körperliche Arbeit sehr schwer und schweißtreibend war und den Frauen alles abverlangte, wurde so mancher emanzipatorische Schritt mit schwerer Last auf dem Rücken getan.
Diese Schwerstarbeit blieb auch nicht ohne Folgen. So schrieb etwa der Topograf Johann Jakob Staffler in seinem Werk über „Tirol und Vorarlberg“ im Jahr 1842 über die u. a. als Bötinnen und Kraxenträgerinnen arbeitenden Frauen im Tuxertal, wo sie entlegene Bergbauernhöfe mit dringend benötigten Waren versorgten: „Auffallend ist das frühe Verblühen des weiblichen Geschlechtes. Mit 30 Jahren schon geht es schnell abwärts, und das Aussehen gibt dann meistens um 10 Jahre mehr als das Taufbuch. Schwere und viele Arbeit und darum vieles Schlafbrechen sind die feindlichen Ursachen, welche so zerstörend wirken.“
Filomena Fankhauser (1875–1943), vulgo „Fasser Menal“, war die letzte Tuxer Bötin. Über 40 Jahre lang trug sie mit ihrem Rückenkorb verschiedene Lebensmittel, z. B. Brot, Arznei- und Kurzwaren von Mayrhofen ins Tuxertal. Ein anderes Beispiel war die Bötin Genoveva Eschgfäller aus Hafling, die noch als 85-Jährige Butter und Eier zu den Gastbetrieben nach Meran trug und den Bäuerinnen ihres Heimatortes von dort Kurzwaren zurückbrachte.
Stadtwäscherinnen im Dauereinsatz
Von der Zeit Maria Theresias bis weit hinauf nach dem Zweiten Weltkrieg reinigten in den beiden Gemeinden Sellrain und Gries im Sellrain zahlreiche Frauen die Innsbrucker Schmutzwäsche, weil in der Tiroler Landeshauptstadt das Holz viel teurer war und entlang der Melach kein aggressiver Chlorkalk zum Einsatz kam.
Der gesundheitsschädigende und langwierige Waschvorgang war zwar sehr schlecht bezahlt, angesichts der kleinen landwirtschaftlichen Betriebsgrößen ein Zusatzverdienst aber notwendig. Trotz der beschwerlichen Arbeit ertönte aus den im Freien stehenden zugluftigen Sellrainer Waschhütten freudiger Gesang. Als besonders schlimm wurde aber das mühevolle Wäschewaschen im Winter empfunden, weil nicht selten die Knospen (= Holzschuhe) der „Waschweiber“ am Steinboden angefroren waren.
Nicht nur verheiratete Frauen hatten gewaschen und sich dabei die Hände wundgerieben, sondern auch ganz junge Mädchen, denen vor Kälte und Erschöpfung die Tränen heruntergeronnen waren. Tränen, die auch in den kurzen Nachtstunden nicht versiegen wollten, da jeder Versuch sich zu erwärmen, in den Strohbetten nichts mehr genützt hatte.
Es gab Wäscherinnen, die bestens mit ihrer städtischen Kundschaft vertraut waren. Noch im hohen Alter von 85 Jahren – 14 Tage vor ihrem Tod – hielt sich die rüstige Sellrainer Stadtwäscherin „Gobis Nannele“ in Innsbruck auf, ging dort ihrem Brotberuf nach, indem sie die schweren Wäscheballen von und zu ihren Kunden trug. Für das hart erarbeitete Geld kauften sich die Sellrainerinnen verschiedene Lebensmittel: Getreide, Mehl, Kaffee und Zucker.
Wildheuerinnen und Ährenleserinnen
Manches Leben unserer weiblichen Vorfahren wurde durch die Doppel- und Dreifachbelastung verkürzt. Und so manche Frau starb beim Bergheuen oder auf Steigen, etwa durch Absturz in schwindelerregender Höhe. Geradezu lebensgefährlich war die Tätigkeit der Wildheuerinnen, die Fuß- oder Steigeisen benötigten, um auf steilen Felswänden das spärliche Gras zu rupfen oder mit dem Hacker (= Sichel) abzuschneiden.
Durchwegs Angehörige der ländlichen Unterschichten waren auch die Wurzengraberinnen (= Wurzelgräberinnen), die im Zillertal im Sommer sogar in eigenen Hütten im Hochgebirge lebten. Im Falle größerer Erträge gingen dann diese Frauen als Hausiererinnen mit dem aus den Wurzen gewonnenen Enzianschnaps von Haus zu Haus, wie z. B. das „Wurzen-Trinerl“, das aus dem Arlberggebiet stammte und mit ihrer erst neunjährigen blondlockigen Tochter in den „Wurzenstrichen“ (= Wurzengebiete) Enzianwurzeln ausgrub.
Osttiroler und Pustertaler Jätergitschen (Gitsch = Mädchen, unverheiratete Frau) wurden als arme Mägde im Oberpinzgau vielfach beim Unkrautziehen ausgenutzt und kehrten oft geschwängert von reichen Großbauern nach Hause zurück. Wie ein Hohn wirken da die Beschreibungen gelehrter Zeitgenossen, die das Bild der arbeitenden Frauen mit verklärtem Blick gesehen haben. Auch davon ist in der mit zahlreichen historischen Bildern bestückten Text-Bild-Dokumentation die Rede. Das Umschlagbild auf der Rückseite, wo eine alte Jäterin aus Fieberbrunn in stark gebückter Haltung dargestellt ist, bringt wohl die zentrale Botschaft dieses zweiten Bandes auf den Punkt.
Aus den übervölkerten Alpentälern (z. B. Seitenarme im Oberinntal, Montafon) zogen aber auch zahlreiche Saisonarbeiterinnen Jahr für Jahr nach Südwestdeutschland, betätigten sich dort als Erntehelferinnen und durften nach der Einstellung der Arbeit durch den Hofbauern die auf dem Feld liegen- oder stehengebliebenen Ähren sammeln. Eine tüchtige Frau konnte bis zum Ende der Erntesaison bis zu 200 Kilogramm Getreide zusammenbringen, die von einem gemeinschaftlich gedingten Fuhrmann in die Heimat transportiert wurden.
Arbeit auf der Alm und im Hochgebirge
Die Hochalmen waren für verschiedene Berufsgruppen Arbeitsplatz oder Versteck, teilweise auch Lebens- oder Tatort: Sennerinnen, Schmugglerinnen, Wilddiebinnen, Gämswilderer und Gämsjäger. Steil die Hänge, schön die Aussicht – hart die Arbeit, karg der Lohn. Ein Leben in einer Bescheidenheit und Abgeschiedenheit, wie es in der Gegenwart kaum noch vorstellbar ist.
Vor der Einführung der Hartkäseproduktion zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren im „Land im Gebirge“ auch erfahrene Frauen als Allround-Arbeitskräfte für die Milcherzeugung und Milchverarbeitung innerhalb der Almwirtschaft zuständig. Neben dem mühsamen Alltag der Sennerinnen, welche auf schwer erreichbaren Almhütten recht selbstbestimmt leben konnten, wird auch die Vorstellung der Hochalmen aus Sicht von jenen Personen beleuchtet, die drunten im Dorf oder Tal geblieben sind. Viel Sündiges wurde oben vermutet. Und so mancher bischöfliche Erlass sollte den befürchteten Verfall der Sitten aufhalten.
Das arbeitsreiche Leben der Sennerinnen, die als eigene Sozialgruppe bis heute erhalten geblieben ist, stand also während des 18. Jahrhunderts ganz im Zeichen der Kontrolle durch die geistliche Obrigkeit, wie die damals nachweisbaren Sennerinnen-Verbote zeigen.
Den Bauernmägden, vor allem den jungen ledigen Sennerinnen, wurde gerne vom Klerus unterstellt, auf den entlegenen Almen ein unkeusches Leben zu führen. Tatsächlich häuften sich aber die in die Jahre gekommenen sogenannten „Raffelscheiter“ (= alte Frauen) in der Hochweidestufe: „Je höher die Alm, desto älter die Sennerin.“ Dass die alltägliche Arbeit für die Sennerinnen alles andere als gemütlich und lustig gewesen ist, geht aus einer eigens zusammengestellten Unglückschronik hervor.
Saubere und billige Arbeitskräfte
Der Benediktinermönch und Schriftsteller Beda Weber (1798–1858) berichtet im Jahr 1838 in seinem Werk „Das Land Tirol. Ein Handbuch für Reisende. Band 3: Die vorzüglichsten Nebenthäler von Nord- und Südtirol“ über die allmählich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert aufgrund obrigkeitlicher Maßnahmen von den Viehhirten oder Sennern (worunter sich je nach Arbeitsteilung die Kuhbuben, Fütterer, Hüter und Melcher befanden) zurückgedrängten Sennerinnen im Zillertal.
Was waren einst die Gründe bzw. Ursachen für die Bevorzugung von Sennerinnen gegenüber ihren männlichen Arbeitskollegen? Und hier ist eine einfache kurze Antwort: Die Sennerinnen arbeiteten sauberer, was u. a. die Reinhaltung der Melkkübel und Milchgefäße anbelangte. Sie waren auch sonst gepflegter („reinlicher“) im Vergleich zu den Melkern, kosteten bei weitem nicht so viel, arbeiteten also „billiger“, und hielten sich hauptsächlich auf kleineren, leichter zu bewirtschaftenden Almen mit relativ geringen Bestoßzahlen (höchstens 15 bis 20 Kühe) auf.
Sennerinnen als Wilddiebinnen
Die Frauen, welche auf weltabgeschiedenen Almen bzw. abseits stehenden Hofstellen im Bereich der Asten (= Voralmen) illegal auf die Jagd und daher „wildern“ gingen, waren fast durchwegs Bauernmägde oder kinderreiche Witwen von recht früh verstorbenen Bergbauern bzw. alleinerziehende Mütter ohne irgendeine soziale Unterstützung, die mit ihrer Kinderschar am Hungertuch nagten.
Immer wieder brodelte es in der Gerüchteküche, dass wildernde Sennerinnen mit den Förstern oder Jägern aufgrund einer engen persönlichen Beziehung unter der Bettdecke steckten und deshalb – im Unterschied zu ihren männlichen Wilderer-Kollegen – nicht auf frischer Tat erwischt wurden.
Über die einzige historisch nachweisbare und genau erforschte Tiroler Wildschützin Elisabeth Lackner (1845–1921) aus dem hinteren Zillertal erfahren wir in der überlieferten Ginzlinger Dorfchronik in Kurzform u. a. Folgendes:
„Wer auf dem Floitenschlag wohnt, dem schauen die Gämsen zum Fenster herein. Kein Wunder, dass es in der Hütte zuweilen illegalen Gamsbraten gab. Die ‚Floitenschlagstaude‘ wilderte nicht bloß aus Leidenschaft. Sie war eine arme Frau, sie und ihre Kinder brauchten oft genug und dringend eine Zubuße. Und sie wusste mit der Flinte besser umzugehen als mit dem Kochlöffel.“
Mir ist die Büchse losgegangen
In den meisten Fällen war Not – richtiger gesagt Fleischnot – das Motiv für die Wilderei. So ist im Jahr 1880 von einer wildernden Bauerntochter mit dem abgekürzten Namen Anna H. (H. = Horngacher) in der Kufsteiner Gegend am Hintersteiner See die Rede, welche die Schützenfahne auf dem Preisschießen in Rosenheim gewonnen hat: „Diese Bauerndirne, eine stämmige, amazonenhafte Gestalt, hat auch als Wildschützin einen Ruf: Ihr Pfeifchen im Munde und den Stutzen an der Schulter streift sie oft tagelang den flüchtigen Gemsen am Kaisergebirge nach; und von ihrer Kraft wüßte nicht ohne Erröthen mancher Bauernbursche zu erzählen, den sie beim ‚Ranggeln’ (= Raufen) so hübsch manierlich auf den flachen Rücken gelegt hat.“
Auch im wildreichen Oberbayern gab es Schwarzschützinnen. Nicht umsonst hatte in einem solchen Revier im Jahr 1923 ein Jagdpächter eine seit längerem schon aufgrund der Wilderei in Verdacht stehende Person auf frischer Tat ertappt. Über diese Wilddiebin in der Gemeinde Waakirchen (Landkreis Miesbach) stehen folgende nachdenklich stimmenden Zeilen: „Ein junges Weib betätigte sich in der letzten Zeit in der Gegend von Schaftlach als Wilderer und machte die umliegenden Jagdreviere unsicher. Kürzlich wurde sie von einem Jagdpächter an der Reichersbeurer Grenze gestellt.“ Darauf gab sie ruhig zur Antwort: „Mir is die Büchs losganga!“ Dieselbe Frau wurde erst kürzlich nach Jagdfrevel und Holzdiebstahl zu einer höheren Strafe verurteilt.
Gämsjäger und Gämswilderer
Die Gämsjäger waren genauso wie die Gämswilderer gerne gesehene Besucher bei den Sennerinnen, die etwas mehr Farbe (heute würde man wohl „Action“ sagen) in das arbeitsreiche Alltagsleben der Sennerinnen gebracht haben. Es hat Gämsjäger aus dem kleinbäuerlichen Milieu gegeben, die nebenher hervorragende Bergführer geworden sind. So mancher Gämswilderer wurde dank seiner vorzüglichen Geländekenntnisse gerne umgeschult, sodass er ebenfalls den für den aufkommenden Alpinismus wichtigen Träger- oder Bergführerberuf ausüben konnte.
Unter den Gämsjägern, die sozusagen kein „Wildererblut“ in ihren Adern gehabt haben, ist wohl der Passeirer Bergführer Josef Pichler (1765–1854), vulgo „Pseirer Josele“, als Erstbesteiger des Ortlers (1804) der berühmteste in ganz Tirol gewesen. Umgekehrt wurde der von den Aufsichtsjägern ständig verfolgte und ebenfalls legendär gewordene Gämswilderer Urban Öfner (1771–1867) aus der Leutasch von der einheimischen Bevölkerung besonders verehrt.
Die Grenzen zwischen den schneidigen Gämsjägern und unerschrockenen Gämswilderern waren in den schroffen Tiroler Bergen fließend. Eine ganz auffällige Gestalt war beispielsweise der Gämswilderer Thomas Scheiter (1828–1912) aus Navis, vulgo „Saxer Thumele“. Sein Lieblingsrevier befand sich im hinteren Voldertal und Wattental. Oft mitten im Winter strich er mit seinem Bruder, dem „Gams-Josele“, in der felsig-waldigen Wildnis herum. Diese beiden verwegenen Wipptaler Wilderer-Gestalten sind übrigens unter den zwei Übernamen „Gams-Josele“ und „Gams-Thumele“ in die Tiroler Volkstradition eingegangen!
Fazit: Humor trotz harter Arbeit
Die Angehörigen des Kleinhäuslertums hatten im Alpenraum neben dem eigentlichen Bauernstand einen beachtlichen Teil der ländlichen Bevölkerung ausgemacht. Die Wohnverhältnisse der fast durchwegs kinderreichen Seldner- oder Keuschlerfamilien waren vor allem für außenstehende Reisende erbärmlich. Trotzdem verloren die Kleinhäusler ihre Lebensfreude nie. Der ursprünglich vom Bergbau, Waldgewerbe, Tag- oder Handwerk lebende Söllmann wurde durch sein Streben nach Erwerb von Grund und Boden zum Kleinbauern (Söllgütler). Die mehrfach belasteten Frauen mussten die Feldarbeit machen, weil die Männer anderweitig einer Beschäftigung nachgingen. Die Ziegenhirten oder Geißbuben waren oft vaterlos (Halbwaisen), also Söhne verwitweter bzw. alleinerziehender Mütter. Damit diese meist neun- bis zwölfjährigen Buben den Landgemeinden nicht als Sozialfälle zur Last fielen, mussten sie beim Ziegenhüten ihr karges Brot verdienen. Und dennoch erschallte in den Bergeshöhen der fröhliche Gesang dieser armen Hirtenknaben.
Auch das Leben der mit Arbeiten überhäuften Frauen war eine einzige Schinderei. So schleppten die Bötinnen oder Kraxenträgerinnen Waren des alltäglichen Gebrauchs in die Hochtäler hinauf. Die Stadtwäscherinnen aus Sellrain reinigten die Schmutzwäsche zahlreicher Innsbrucker Haushalte, wobei im Winter die Kälte den verheirateten Frauen und jungen Mädchen arg zusetzte. Ein flüchtiger Blick auf die Wildheuerinnen und Wurzelgräberinnen oder auf die Ährenleserinnen und Jätergitschen bedeutet ebenfalls, sich mit „sozialen Härtefällen“ der Vergangenheit auseinanderzusetzen: Der Alltag dieser Frauen war geprägt von hoher Arbeitsbelastung und sehr geringem Verdienst. Nicht viel besser hatten es damals viele Sennerinnen auf den Hochalmen. Manche notleidende Frau ging dort sogar illegal auf die Pirsch. Damit befand sich die wildernde Sennerin in bester Gesellschaft mit den Gämswilderern und Gämsjägern, welche gerne mit ihr jodelten und das eine oder andere lustige Almlied in der entlegenen Sennhütte sangen.
Über den Autor:
Georg Jäger, geboren 1963 in Innsbruck, entstammt einer kleinbäuerlichen Familie aus dem Sellraintal und interessierte sich schon immer für die Arbeit der Bergbauern und Kleinhäusler sowie für das Leben der ländlichen Schichten dort.
An der Universität Innsbruck studierte er Geographie und Geschichte, dort promovierte und habilitierte er auch. Neben seiner Tätigkeit als Bibliothekar hat er zum Thema „Vergessene Zeugen des Alpenraums“ drei Bücher veröffentlicht (die beim Kral Verlag erschienen sind und hier zu bestellen) und auch weitere Artikel publiziert – z.B. in den Tiroler Heimatblättern. Er lebt zwar in der Nähe von Innsbruck, aber seine Wochenenden verbringt er nach wie vor am liebsten in Sellrain, seiner Heimat.
Dieser Artikel ist Teil einer Serie zum Thema Landleben – in dieser Einführung finden sich die Links zu weiteren Artikeln, z.B. zum bäuerlichen Leben in Thüringen, im Odenwald, Bayrischen Wald und auf den Halligen.