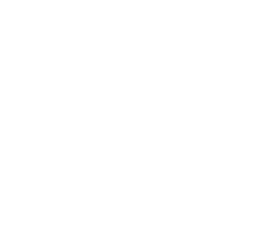Feuer in der Hafenstadt (Anja Marschall)
Feuer in der Hafenstadt – ein historischer Kriminalroman von Anja Marschall (Hauke Sötjes 1. Fall)
Der historische Krimi, als Anfang der 3-teiligen Serie rund um den Kapitän Hauke Sötje, ist im hohen Norden angesiedelt. Er spielt in Glückstadt im Jahre 1894.
Hauke Sötje will nicht mehr – sein Schiff ist untergegangen und seine Mannschaft -54 Männer- ertrunken. Als einziger Überlebender möchte er den Schuldigen für den Untergang finden und zur Rechenschaft ziehen. Als er in Glückstadt ankommt, wird er zunächst irrtümlich festgenommen. Gerettet wird er vom kaiserlichen Gesandten Grafen von Lahn, der seine eigene Agenda verfolgt, in der dem (Ex-)Kapitän Sötje eine Schlüsselrolle zugedacht ist.
Parallel dazu wird von der Fabrikantenfamilie Struwe erzählt. Tochter Sophie fühlt sich von ihrer Tante Dora, die sie an Stelle ihrer verstorbenen Mutter erzieht, gegängelt. Sie hat Ambitionen, möchte studieren und mehr lernen. Die ihr zugedachte Rolle, eine möglichst gute Partie zu heiraten und ihr alleiniges Glück als Ehefrau und zukünftige Mutter zu betrachten, behagt ihr nicht.
Ihr Vater, Inhaber einer Möbelfabrik, ist um ihr Wohl besorgt, möchte aber nicht, dass sie aus der für sie vorgesehenen Rolle ausbricht. Sophie soll sich fügen und heiraten – und zwar bald!
Struwe ist einer der Vorstände der neugegründeten Heringsfischerei AG. Sie ist wichtig für ganz Glückstadt – durch die Fischerei soll der Ort prosperieren, dazu sollen vier Logger (Fangschiffe) gekauft werden. Hermann Struwe steckt allerdings in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Lage eskaliert, als seine Fabrik in der Nacht abbrennt. Brandstiftung? Kurz darauf begeht er Selbstmord. Sein Vermögen ist verloren und seine Tochter Sophie plötzlich auf sich alleine gestellt.
Im weiteren Verlauf laufen sich Sophie und Hauke Sötje über den Weg. Sie versuchen, die Fäden der Geschehnisse zu entwirren und kommen schließlich einer Verschwörung auf die Spur.
Es ist manchmal nicht ganz einfach, den komplexen Handlungssträngen und den damit verbundenen Personen zu folgen, bei der die Spannung manchmal etwas auf der Strecke bleibt – aber die Konzentration lohnt sich, am Ende wird gelüftet, wie alles zusammenhängt!
Persönlich besonders gut haben mir einige Details des Krimis gefallen – sehr lustig (da authentisch!) sind z.B. die Auszüge aus dem Lokalblatt „Glückstädter Fortuna“ aus dem Handlungsjahr, die jedem Kapitel vorangestellt sind. In der Handlung hat die Autorin einige realexistierende Personen verarbeitet, die am Schluss des Buches vorgestellt werden, wie auch Straßen und Gebäude und deren historischer Hintergrund. Für alle, die ansonsten nicht viel mit Schifffahrt zu tun haben (wie mich z.B.), ist das Glossar am Ende gleichfalls hilfreich.
Textauszug (S. 23-33):
…
Jemand ergriff Hauke und zerrte ihn zu Boden.
»Verdammt! Wo kommen die denn her?«, rief Hinnerk. Er eilte zu dem Uniformierten, der Hauke auf die Planken drückte. »Lass den Mann los, sag ich!«, brüllte er. »Der wollte nur ein Unglück verhindern!« Er versuchte, den Beamten von Hauke wegzuzerren, doch ein zweiter schlug ihm die Hand mit dem Knüppel fort.
Jetzt griff der Rest der Mannschaft ein.
Verschwitzte, nach Fisch stinkende Körper wälzten sich zusammen mit blauen Uniformen zwischen Taurollen und Netzen. Es hagelte Stockschläge. Doch je mehr Prügel die Fischer von den Polizisten bezogen, umso wütender schienen sie zu werden.
Da kam vom Kai Kampfgeschrei. Grölend rannten die Männer der anderen Schiffe herbei, um sich in das Getümmel zu werfen. Bald darauf war auf dem Ewer kaum noch Platz, um zum Schlag auszuholen. Ein heftiges Stoßen und Schubsen, ein paar Faustschläge.
Solange keiner ein Messer zieht, dachte Hauke zwischen zwei Hieben, die er einem der Hilfspolizisten verpasste, könnte die Sache vielleicht noch glimpflich ausgehen. Er war zornig, weil er sich hatte hinreißen lassen. Jensen und die anderen gingen ihn doch eigentlich nichts mehr an. Es war dumm gewesen, sich in diese Situation zu bringen. Er gab dem Mann vor sich einen besonders heftigen Hieb, sodass dieser über die Reling ins Wasser fiel.
Aus den Augenwinkeln sah Hauke, wie Kapitän Jensen auf allen vieren inmitten der Prügelnden zum Niedergang kroch und eilig unter Deck verschwand.
Kurze Zeit später war alles vorbei.
Die Polizisten verhafteten die Aufwiegler und zerrten sie den Deich hoch.
Dort stand der vergitterte Pferdewagen, auf dessen Bock ein Beamter saß. Aufgeregt schnatternd, aber dennoch genüsslich hatten Schaulustige dem Spektakel vor der Heringsfischerei zugesehen. Hauke hatte man die Hände auf den Rücken gebunden. Eine Wunde am Kopf blutete, und er humpelte leicht. Kurz suchte er unter den Umstehenden die junge Frau. Erleichtert stellte er fest, dass sie fort war.
Jemand öffnete den Verschlag des Gefangenenwagens. Hauke zögerte, als es an ihm war einzusteigen. Sofort stieß ein Sergeant ihm den Knüppel zwischen die Schulterblätter. »Zu fein für unsere Kutsche, was? Los, weiter!« Man bugsierte sie alle in den Wagen. Dann fiel die Gittertür ins Schloss, und der Karren fuhr an Richtung Polizeigefängnis, das hinter dem Rathaus lag.
***
Die steinernen Wände der Zelle waren mit einer glänzenden Schicht aus Eis überdeckt. Hauke umklammerte die Fensterstäbe. Eine der vier Glasscheiben fehlte. Mit jeder Minute, die er sich an den Eisenstangen festhielt, verloren seine Finger an Gefühl, doch er bemerkte es nicht, starrte hinaus in den grauen Himmel.
Die anderen Männer saßen so weit wie möglich vom Fenster entfernt um einen kleinen Ofen herum, den einer der Schutzleute mit nur einem Holzscheit angeheizt hatte. Bald würde auch dieses bisschen Wärme verloren sein.
Hauke zitterte, während die Wände der Zelle unaufhaltsam näher auf ihn zurückten. Er spürte sie in seinem verschwitzten Rücken, wusste, dass sie auf ihn einstürzen würden, ihn unter sich begraben, sobald er den Blick in ihre Richtung wandte.
Seit er hier eingesperrt war, mussten bereits Stunden vergangen sein. Nur mit größter Anstrengung hatte er die Angst von sich fernhalten können.
Wie ein Ertrinkender krallte er sich an die eisigen Stäbe und versuchte, langsam die kalte Winterluft einzuatmen. Sobald er die Luft, nach einem Moment erzwungener Ruhe, wieder ausstieß, bildete sich weißer Hauch vor seinem Mund. Indes suchte sein Kopf zwischen all den wirren Bildern und dem tiefen Entsetzen seiner Seele einen einzelnen Blitz der Klarheit zu finden.
Unordnung konnte nur mit Ordnung bekämpft werden, das wusste er. Darum murmelte Hauke immer wieder die Besegelung seines Schiffes vor sich hin: »Klüver, Binnenklüver, Vor-Stag, Focksegel, Vor-Untermarssegel, Vor-Obermars, Vor-Bram, Vor-Royal …« Er sah jedes einzelne Segel, ihre ausgebesserten Stellen, ihre weiße und graue Färbung, ihre zerfetzten Fäden, wenn ein Sturm sie zerrissen hatte. »Großmast: Stagsegel, Großsegel, Groß-Untermars, Obermars, Bramstag …«
»Halt endlich das Maul!«, brüllte einer der Männer. »Du machst mich ganz irre!«
Doch Hauke hörte ihn nicht. »… Groß-Royal, Groß-Sky, Groß-Spencer.« Wenn er mit den Segeln fertig war, würde er zur Takelung übergehen.
Die beruhigende Wirkung der Worte hatte er erkannt, als sie ihn damals in eine Irrenanstalt nahe London gebracht hatten, wo er auf den Ausgang seines Prozesses hatte warten müssen. Die Anklage des Crown Court hatte ihm den Untergang der »Revenge« und den Tod seiner dreiundfünfzig Männer angelastet. Das war nur rechtens gewesen, wie Hauke fand, denn er hatte das Kommando gehabt. Er, der einzig Überlebende.
Hauke löste die kalte Hand von den Gitterstäben und rieb sich die schmerzenden Augen.
Sie hatten ihm Fragen gestellt. Dutzende Fragen. Immer wieder wollten sie wissen, wo er war, als seine Männer starben, er aber nicht.
Er hatte sich an nichts erinnern können, was in jener Nacht vor Margate passiert war. Es schien ihm, als hätte jemand all seine Erinnerungen an das Ereignis fortgewischt.
»Warum segelten Sie in Richtung Norden statt in den Golf von Biskaya, wie es Ihnen befohlen war?«
Er hatte dem Gericht von der Depesche erzählt, die ihn kurz vor Auslaufen aus Portsmouth erreicht hatte. Sie war vom Privatsekretär Sir Rupert Cunninghams, einem gewissen William Fergusson, unterzeichnet worden. Darin hatte unmissverständlich gestanden, dass Kurs auf Helgoland zu nehmen sei.
Das Gericht hatte Hauke nicht geglaubt, denn natürlich war die Depesche mit dem Schiff untergegangen. Auch Rupert Cunningham konnte nicht bestätigen, dass ein derartiger Befehl jemals erteilt worden war.
»Simulant« und Schlimmeres hatten die Leute im Gerichtssaal geschrien. Er hatte es ihnen nicht verübeln können, denn fast alle toten Matrosen und Offiziere waren Briten gewesen. Hauke selbst hatte sich die größten Vorwürfe gemacht. Wenn ein solches Unglück geschah, dann hatte ein Kapitän als Letzter das Schiff zu verlassen oder aber mit ihm unterzugehen.
Bevor das Urteil erging, hatte das Gericht sicherstellen wollen, dass der Deutsche sich wieder erinnerte. Man hatte ihn vom Gefängnis in die Irrenanstalt geschickt. Dort hatten die Ärzte gemeint, man könnte den Delinquenten mit Hilfe von Sturzbädern die verlorene Erinnerung zurückbringen, sofern er nicht simulierte. Monatelang hatte Hauke in einem Meer aus Angst vor den eigenen Träumen getrieben. Nur Anfälle der Ohnmacht hatten ihn ab und an erlöst. Tage und Nächte waren zu einem zähen Brei verschwommen, und er hatte nichts dagegen tun können.
Wieder und wieder waren die Wärter des Nachts in seine Zelle gestürmt und hatten ihn herausgeholt, ihm die Kleider vom Leib gerissen und ihn in eisiges Wasser getaucht, bis der Tod nur noch einen Hauch von ihm entfernt gewesen war. In jeder einzelnen dieser Nächte war Hauke ein ums andere Mal gestorben. Doch die Wärter hatten ihre Arbeit verstanden. Immer dann, wenn er den Tod herbeigesehnt und sich nicht mehr gewehrt hatte, ließen sie von ihm ab. Sie wollten nicht, dass er sich in die Arme des Todes flüchtete.
Man hatte ihn zurück in die Zelle gebracht, wo er bitterlich fror. Dort war er allein mit seiner Angst gewesen, die ihn bis ins tiefe Mark erschütterte, sobald er die Augen schloss. Plötzlich war es ihm unmöglich gewesen zu atmen, Luft in seine Lunge zu saugen.
Irgendwann hatte Hauke erkannt, dass er die Angstanfälle durch eiserne Kontrolle der Gedanken halbwegs in den Griff bekommen konnte. »Kreuz-Bram, Kreuz-Royal, Besansegel.«
Zur Urteilsverkündung hatten sie ihn in einen schäbigen Anzug gesteckt und in den übervollen Gerichtssaal gebracht.
Es hatte nach Tabak und Schmierseife, Schweiß und Hass gerochen.
Im Namen Ihrer Majestät Königin Victoria von Großbritannien und Irland war ein mildes Urteil gegen den feigen deutschen Kapitän ergangen, dem faktisch kein Vergehen hatte zur Last gelegt werden können, weil die Zeugen fehlten. Auch konnte ihm keine Trunksucht nachgewiesen werden oder anderes tadelnswertes Verhalten. Trotz des Verlustes von Ladung, Schiff und Mannschaft stellte Reeder Cunningham seinem Kapitän einen guten Leumund aus. Dem »Preußen ohne Ehre«, wie er damals in den Zeitungen genannt worden war, hatte das Gericht das britische Kapitänspatent entzogen und ihn außer Landes verwiesen.
Vor dem Gerichtsgebäude hatten aufgebrachte Engländer seinen Tod gefordert. Doch nicht nur sie. Ein Vertreter des deutschen Kaisers, ein gewisser Graf von Lahn, besuchte Hauke kurz vor der Urteilsverkündung im Gefängnis. Seine Worte waren unmissverständlich gewesen. »Sie wissen, was die Ehre gebietet und was der Kaiser von Ihnen erwartet.« Dann legte er den Revolver auf die Pritsche und ging.
Ja, Hauke wusste, was zu tun war, doch zuvor musste er sich von einer noch älteren Schuld befreien.
Kapitel 2
Vermischtes. Folgen zu engen Schnürens. Das Mitglied des Carl-Theaters in Wien, Fräulein Bellini, ist im Rudolphinum an den Folgen allzu starken Schnürens gestorben. Die Schauspielerin, eine bekannte Schönheit, hatte die Gewohnheit, ihrer Taille durch Schnüren nachzuhelfen. Der Druck auf die Nieren hatte eine Entzündung zur Folge und nunmehr ist die junge Künstlerin ihrem überaus schmerzvollen Leiden erlegen. Fräulein Bellini war erst 24 Jahre alt.
Original: Glückstädter Fortuna, Januar 1894
Die schrille Stimme Tante Doras drang durch die geschlossene Tür des Arbeitszimmers auf den Flur hinaus. Sophie, die vor der Tür stand und wartete, knetete nervös ihre Hände. Sie wusste, was dort drinnen vor sich ging. Soeben trug die hagere Schwägerin ihres Vaters Vorwurf um Vorwurf gegen das undankbare Kind vor. Und dieses Mal konnte Sophie sich nicht sicher sein, dass ihr Benehmen ungestraft bleiben würde.
Tante Dora hatte in ihrem Schrank eine Ausgabe von Henrik Ibsens Theaterstück »Nora oder Ein Puppenheim« entdeckt, in dem eine Ehefrau und Mutter, die nichts weiter als der Besitz ihres Mannes war, auszubrechen versuchte. Dora hatte von diesem schändlichen Werk in den guten Salons der Stadt gehört. Sie hatte kein Wort gesagt, als sie das Machwerk in Sophies Zimmer entdeckt hatte. Mit steinerner Miene und spitzen Fingern hatte sie das Beweisstück an sich genommen und den Raum verlassen.
Sophie wusste, sie hätte vorsichtiger sein müssen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie die Seiten in den Umschlag von »Backfischchens Leiden und Freuden« gewickelt oder in die neuste Ausgabe der »Gartenlaube« gelegt hätte. Diese und andere seichte Druckwerke kaufte Tante Dora ihr ständig. Bücher, in denen die werte Leserin unerbittlich auf ihre Stellung als Frau reduziert wurde. Magazine, die die jungen Dinger auf ihre natürliche Berufung als Gattin und Mutter vorbereiteten.
Dabei fand Sophie, dass Doras Lektüren allesamt vertanes Papier waren. Ausschließlich gedacht, dumme Mädchen zu dummen Frauen zu machen, sie ohne Meinung und ohne Hirn in die Welt zu entlassen, damit sie in jeder Hinsicht folgsam waren.
So aber wollte Sophie, die Tochter des Möbelfabrikanten Hermann Struwe, nicht enden. Wozu hatte sie alle verfügbaren Bücher der Antike und der zeitgenössischen Literatur verschlungen? Wozu las sie heimlich Berichte über die wissenschaftlichen Entdeckungen ihrer Zeit, verfolgte aufmerksam die politischen Bewegungen im Kaiserreich? Seit drei Jahren durften Frauen sogar in der Schweiz ein Medizinstudium absolvieren. Und hatte nicht Dorothea Erxleben bereits vor über einhundert Jahren als Medizinerin promoviert? Es war Sophie unverständlich, warum sich die Welt im Deutschen Reich weiterhin ohne die Frauen drehen sollte.
Einen Verbündeten hatte Sophie jedoch. Es war der Direktor des örtlichen Gymnasiums, Dr. Detlef Detlefsen, den die Schüler hinter seinem Rücken Detel nannten. Er selbst war ein brillanter Kopf und hatte Sophie immer wieder ermutigt, eine eigene Meinung zu haben. Sie solle sie aber möglichst nicht allzu laut kundtun, schließlich sei sie eine Frau und man würde in einer kleinen Stadt leben.
Die Welt schien Sophie Struwe schon seit Langem verrückt. Je älter sie wurde, umso unfreier fühlte sie sich. Vielleicht würde alles einfacher, wenn sie endlich verlobt wäre. Doch anders als ihre Freundinnen hatte sich für Sophie bisher kein Galan gefunden. Aus diesem Grund hatte ihr Vater Tante Dora ins Haus geholt. Sie sollte sie unter die Haube bringen. Und so musste Sophie die immer drängender werdenden Bemühungen ihrer Tante, sie zu verscherbeln, aushalten: ein schnelles Jawort gegen eine solvente Fabrik und eine störrische Tochter. Sophie schüttelte sich.
Die Standuhr tickte.
Hinter der Tür fielen Worte wie »liederlich« und »unfolgsam«, »eigensinnig« und »Pflicht«.
Deutlich war Doras Stimme zu hören, die ihres Vaters hingegen war nur ein Gemurmel. Sophie versagte sich den Wunsch, ihr Ohr an die Tür zu halten, um seine Antworten zu hören. Würde Tante Dora ihm sagen, dass Sophie sich geweigert hatte, ein Mieder zu tragen?
Es gab gute Gründe, dies zu tun. Erst letzte Woche war eine ihrer Freundinnen ins Hospital gekommen. Beim Binden des Mieders war eine Rippe gebrochen und hatte die Lunge verletzt. Alles eingeschnürt, das konnte nicht gut sein, davon war Sophie überzeugt. Das aber schien niemanden zu interessieren.
Sophies Hände wurden feucht, und sie begann, im Halbdunkeln den getäfelten Flur auf und ab zu wandern.
Wohl eine gute Viertelstunde später wurde die Tür zum Arbeitszimmer aufgerissen, und Tante Dora rauschte heraus. Sofort erkannte Sophie, dass ihre Sterne nicht gut standen. Ein zufriedenes Lächeln lag auf Tante Doras faltigem Gesicht.
Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend trat Sophie in das Zimmer ihres Vaters.
Das Arbeitszimmer Hermann Struwes war weniger düster als der Flur. Moderne Gaslampen an den Wänden warfen warmes Licht auf Möbel und Seidentapeten. Auf dem mächtigen Schreibtisch im angedeuteten Barockstil stand eine alte Petroleumlampe aus den ersten Tagen der Möbelfabrik Struwe. Sophies Vater legte Wert darauf, einen Tisch zu besitzen, der nicht kleiner war als der des Grafen von Brockdorff-Ahlefeldt. Und so dominierte das Möbelstück den Raum und herrschte über ihn. Man müsse als Mann wissen, wo man stehe, sagte Hermann Struwe stets. Ihm war es völlig egal, dass das schwerlastige Möbel für sein Arbeitszimmer viel zu groß war.
Überhaupt bestand die Einrichtung des ganzen Hauses aus einem Konglomerat nachgemachter Einrichtungsstücke aus verschiedenen Adelshäusern und Epochen. Diese weitverbreitete Mode, die Sophies Mutter bis zu ihrem Tod gepflegt hatte, führte Dora ganz im Sinne ihrer verstorbenen Schwester fort. Und so füllte sich die Wohnstatt zusehends, sodass Dora in letzter Zeit immer wieder anbrachte, man müsse über eine neue Villa am Stadtrand nachdenken. Sophie indes liebte ihr Elternhaus in der Königstraße. Und sollte sie eines Tages das Haus erben, würde sie es von Grund auf neu einrichten.
Sophie trat vor den Schreibtisch ihres Vaters und zwang sich, auf den Teppich zu schauen, den Mund zu halten und möglichst bescheiden zu wirken. Mit gefalteten Händen wartete sie, dass der Vater das Wort an sie richten würde.
Doch er schwieg. Vor ihm lag ein Journal mit schwarzem Einband. Konzentriert schrieb er Zeile um Zeile hinein, machte auf einem Extrazettel eine kurze Rechnung auf und notierte einige Namen.
Dann endlich schaute er auf. »Nun, mein Kind, was hast du mir zu sagen?« Streng sah er ihr in die Augen.
»Ich bin zu jung zum Heiraten, Papa!«, wollte Sophie schreien und von ihrer Freundin und dem Mieder erzählen. Auch die Besuche bei Apotheker Behrmanns Frau wollte sie erwähnen. Immer starrte dessen Sohn Karl Sophie an, als sei sie ein Stück Torte, in das er gleich hineinbeißen wollte. Tante Doras Versuche, sie unter die Haube zu bringen, waren unwürdig.
Wie immer schien es, als könne Hermann Struwe ihre Gedanken lesen.
»Tante Dora versucht, so gut es geht, deine Mutter zu vertreten. Dazu gehört es, dass sie deine Stellung in der Gesellschaft festigt. Insbesondere nach dem Fiasko in London.«
Betreten schwieg Sophie. Sie hatte sechs wunderbare Monate in der englischen Hauptstadt verbracht. Museen, Theaterbesuche, Vernissagen und Bälle hatten ihr junges Leben versüßt. Doch dann war es zu einem kleinen Tête‑à-Tête gekommen, das nicht unbemerkt geblieben war. James wäre eine prächtige Partie gewesen, wenn das Schicksal es anders mit ihnen gemeint hätte. So aber hatte man Sophie vorzeitig und in Unehren nach Hause zurückgeschickt. Ihr Vater hatte sich drei Monate geweigert, ob dieser Schande mit ihr zu sprechen.
Hermann Struwe klappte das Heft vor sich zu. Dann erhob er sich. »Es ist unmöglich, einen Mann für dich zu finden, Kind, wenn du frei plappernd wie ein Fischweib herumläufst und Bücher liest, die deinen Kopf nur verwirren. Wo hast du bloß diese renitente Art her?«
Sophie spürte, wie sich ihr Hals zuschnürte.
Ihr Vater holte tief Luft. »Es gibt Dinge, die muss eine junge Frau tun.« Unbestimmt wedelte er mit der Hand in Richtung Sophies Körper, und sie wusste, jetzt sprach er von dem Mieder. »So ein Ding zu tragen gehört dazu. Es befördert eine elegante Figur und zeigt, wie selbstbeherrscht eine Frau sein kann. Es macht den Unterschied zwischen Kind und Frau aus.« Er versuchte ein Lächeln. »Kindchen, ich kenne mich mit so etwas nicht aus. Ich bin nur dein Vater. Mütter sind besser geeignet, ihren Mädchen beizubringen …«
»Sie ist nicht meine Mutter!«, fauchte Sophie und bereute es sofort.
Das Gesicht ihres Vaters verdunkelte sich. »Du weißt, dass ich mir von deinem Aufenthalt bei Worthing & Sons mehr versprochen hatte.« Sichtlich verärgert nahm er wieder Platz. »Alle deine Freundinnen sind in der Zwischenzeit wenn nicht verheiratet, so doch wenigstens verlobt. Du hingegen hast nicht einmal die Aussicht auf einen geeigneten Anwärter. Es wird für Dora immer schwieriger, einen …« Er stockte.
»… Abnehmer zu finden?«, fragte Sophie bissig.
Ihr Vater fuhr hoch. »Nein, einen Mann, der Manns genug ist, sich auf eine Ehe mit dir einzulassen. Ich werde deine Mitgift verdoppeln müssen, eine gleichrangige Partnerschaft in unserer Fabrik anbieten und noch einiges mehr.« Er tippte auf das Buch. »Aber all das ist wenig erfolgversprechend, wenn meine hochfeine Tochter die Kandidaten mit ihren modernen Reden verschreckt und die Herren verjagt, weil sie ihr nicht gut genug sind.« Seine Stimme hob sich bei jedem Wort, grollte wie Donner.
»Nun, wenn diese Männer sich so schnell verjagen lassen, fehlt ihnen vieles, was dein Nachfolger in der Firma haben sollte«, versuchte Sophie ihren Vater zu versöhnen.
Doch der drohte ihr mit ausgestreckter Hand. »Du wirst drei Tage nicht das Haus verlassen, Sophie-Louise! Ich wünsche, dass du dich bei Dora entschuldigst. Ich wünsche des Weiteren nicht, dass mir irgendwelche Klagen über dein Benehmen zu Ohren kommen.« Er ließ sich zurück auf den Stuhl sinken und griff zum Füller. »Und wenn Dora es für opportun hält, dich in den Familien der Gegend vorzustellen, wo heiratsfähige junge Männer …«, er überlegte, »vorrätig sind, dann wirst du dort hingehen und unsere Familie aufs Beste repräsentieren! Du bist eine Struwe, denke daran.«
Damit schien er genug von diesem Thema zu haben. Er schlug das Journal wieder auf und begann mit neuen Eintragungen.
Sophie war entlassen. Also machte sie einen Knicks und wünschte murmelnd eine gute Nacht. Bevor sie jedoch hinausging, richtete ihr Vater nochmals das Wort an sie.
»Vergiss niemals, Sophie: Die Möbelfabrik Struwe ist ein florierendes Unternehmen. Nur wenige können es mit uns aufnehmen. Der Name Struwe gehört in dieser Stadt zur guten Gesellschaft. Wir sind Teil der Zukunft von Glückstadt. Meine Verpflichtung als Vorstand für die neue Aktiengesellschaft festigt unsere Position weiter und bringt den Glückstädtern Einkommen und Wohlstand. Schon bald wird unsere Stadt es mit Hamburg oder Altona aufnehmen können. Der Reichtum wird zurück nach Glückstadt kommen, und wir Struwes werden dabei ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Die neue Heringsfischerei ist nur der Anfang, glaube mir. Großes liegt vor uns, und deine Kinder werden dieses Erbe fortführen und mehren müssen.« Jetzt lächelte er. »Kürzlich ist mir ein Sitz im Stadtrat angediehen worden, und ich gedenke, diese Ehre anzunehmen.«
»Das ist wunderbar, Vater!« Sophie wollte zu ihm eilen, um ihn zu umarmen. Doch schon war das Lächeln wieder verschwunden, und ihr Vater blickte erneut ernst drein.
»Wegen deines frechen Mundwerks aber, so fürchte ich, finden, trotz bester Reputation der Familie, nur noch wenige junge Männer den Weg zu uns. Du solltest somit Dora für ihre unendlichen Bemühungen dankbar sein.« Er beugte sich wieder über sein Journal. »Dora und ich werden übrigens im Frühling heiraten«, sagte er, ohne seiner Tochter in die Augen zu schauen.
Heiraten? Sophie wollte etwas erwidern, aber sie konnte es nicht. Sie war sprachlos.
»Du kannst jetzt gehen.«
Fassungslos trat Sophie auf den Flur. Dort stand Tante Dora. Der Triumph in ihren Augen schmerzte Sophie mehr, als sie ertragen konnte. Diese Person sollte ihre neue Mutter werden?
Sie straffte ihren Körper und hoffte, eine würdevolle Gestalt abzugeben, als sie mit erhobenem Haupt an ihr vorbeiging und gemessenen Schrittes die Treppe zu ihrem Zimmer erklomm.
Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, warf Sophie sich auf ihr Bett und weinte. Seit dem Tod ihrer Mutter war sie sich niemals wieder so hilflos vorgekommen.
…
.
***
Gretes Fazit
(für alle, die…mögen) :
+ zeithistorisch gut eingebettet
+ norddeutsches Flair und Kolorit
+ für alle Fans von Polit- und Wirtschaftsthrillern (inklusive Verwicklungen und Verschwörungen)
***
Über die Autorin
Text folgt
Die Reihe rund um Ex-Kapitän Hauke Sötje umfasst drei weitere Bände, erschienen im emons: Verlag.