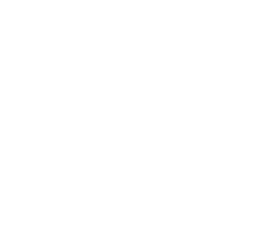Josephine Zürcher – Schweizer Ärztin im Orient
Ein Gastbeitrag von Helmut Stalder
Josephine Zürcher war eine zweifache Pionierin: Sie war eine der ersten Schweizer Ärztinnen. Und sie praktizierte ein Leben lang ausgerechnet dort, wo sie es als Frau am schwersten hatte – in der Männergesellschaft des Osmanischen Reiches.
Die Gerüchte verfolgen sie nun schon seit der Abreise in Alexandrette im östlichen Mittelmeer, und mehr noch seit sie die syrische Provinzstadt Aleppo hinter sich gelassen hat. In allen Karawansereien wird erzählt, der berüchtigte Kurdenfürst Ibrahim Pascha mache mit seiner Reitermiliz die Gegend zwischen Euphrat und Urfa unsicher. Genau dorthin ist Josephine Zürcher unterwegs. Es ist Juli 1897 und die 31-jährige Ärztin ist nun schon seit Wochen auf der Reise. Im Mai ist sie in Zürich aufgebrochen, um im türkischen Urfa ein Spital aufzubauen. Decken, Kleider, medizinisches Besteck, Apotheke, Mikroskop und eine Pistole mit 100 Schuss hat sie in ihre zwei Koffer gepackt, ist mit dem Schiff nach Beirut gefahren und weiter der Küste entlang Richtung Norden nach Alexandrette (heute Iskenderun), wo der deutsche Handelsgehilfe und Lehrer Henry Fallscheer sie abgeholt hat. Wegen der Gerüchte um den unberechenbaren Kurdenchef Ibrahim Pascha haben sich in Aleppo immer mehr Karawanen vereint, um unter Geleitschutz nach Urfa zu gelangen.
Kurzhaarschnitt und Männerkleider
Josephine Zürcher hatte kurz vor ihrer Abreise in Genf bei einem Reitunfall einen Schädelbruch mit klaffender Wunde erlitten. Deshalb trug sie nun einen Kurzhaarschnitt. Zudem hatte die «Hohe Pforte» (die Verwaltung des Sultans im Osmanischen Reich) bestimmt, dass die junge Ärztin östlich von Aleppo Männerkleidung zu tragen und draussen wie in der Klinik als Mann aufzutreten habe; nur bei Visiten in Harems sollte sie Frauenkleider anziehen. Diese osmanische Bestimmung hatte es wiederum erforderlich gemacht, bei den schweizerischen und deutschen Behörden die Erlaubnis zum Tragen von Hosen zu erwirken. So absonderlich dies scheint – aber in der Kleiderfrage kam zum Ausdruck, wie schwer sich die Behörden hier wie dort damit taten, dass diese Frau sich in den Kopf gesetzt hatte, im Männerberuf des Arztes und erst noch im Orient tätig zu sein. Für Josephine hingegen ging es bei Haaren und Hosen vor allem ums Praktische, denn es reitet sich nun mal leichter im Herrensitz und ohne heikle Frisur.
Eben haben die Reisenden den Euphrat überquert, haben in Birecik Logis bezogen und sind müde ins Bett gesunken, da preschen ein paar Dutzend Reiter in den Hof der Karawanserei. Ihr Herr, Ibrahim Pascha, habe einen schlimmen Arm und hohes Fieber, verkünden die Kerle, er müsse sofort behandelt werden. In aller Eile richtet Frau Dr. Zürcher einen Operationsplatz her, kocht Wasser ab und desinfiziert die Instrumente. Dann Hufgetrappel, Trommeln, Kommandos – der gefürchtete Pascha mit Gefolge trifft ein.
Der Räuberhauptmann fällt in Ohnmacht
Josephine Zürcher weiss, dass eine Ärztin in dieser archaischen Männerwelt befremdend wirkt. Statt einen Mann zu spielen, legt sie es nun aber darauf an, dass der Kurdenfürst sie als weiblichen Arzt akzeptiert. «Ich hatte den weissen Operationsmantel umgelegt und ein weisses Kopftuch um die Haare gelegt, sodass ich durchaus weiblich erscheinen musste, worauf ich stets Wert legte», schrieb sie später. Ibrahims rechter Arm ist stark geschwollen, eine wüste Entzündung. «Dieser hartgesottene Koloss, dem ein oder mehrere Menschenleben nichts galten, zeigte den rührenden, hilfeflehenden Blick eines schwerverwundeten Tieres, das auf den Arzt wie auf seine Vorsehung schaut und bedingungslose Unterwerfung und blindes Zutrauen verspricht.» Als sie dem Pascha den Arm rasiert, taucht er weg. «Ich griff nach meinem schärfsten tiefbauchigen Messer – es war ein wahrer Türkensäbel – und machte einen tiefen Schnitt von der Schulterhöhe herunter. Seitlich stiess ich in einen prallen Abszess, dessen Inhalt, ein dicker Eiter, wie eine gewaltige Flüssigkeitssäule am Skalpell vorbeidrängte.»
Nach wenigen Stunden ist der Räuberhauptmann wieder reisefähig. Er schenkt ihr einen Gebetsteppich und sagt: «O meine Tochter, mit deinen Seiden- und Samthänden, verschmähe nicht meinen Rat: Du hast eine gottgesegnete Kunst, aber die grösste Wichtigkeit des Lebens ist für das Weib die Ehe! Die Zuneigung, der Schutz eines Mannes, die Anhänglichkeit der Kinder, die sie ihm bringt, ist tausendmal wertvoller und besser als jede Kunst und alle Ehre der Welt. Inschallah!» Genau diese zwiespältige Haltung wird Josephine Zürcher auf all ihren Stationen im Orient begleiten: Die Menschen schätzen ihren ärztlichen Beistand, aber die Mächtigen wollen sie nicht machen lassen, weil sie eine Frau ist. Im ganzen Osmanischen Reich ist sie eine der ersten Ärztinnen, im türkischen Nahen Osten die erste überhaupt.
Kindheit im Waisenhaus
Dass sie Ärztin wurde, war nicht selbstverständlich. Sie kam am 1. Oktober 1866 in Zürich zur Welt. Ihr Vater Eduard arbeitete sich aus armen Verhältnissen hoch. Er war Soldat für den König von Neapel, dann Schweizer Gardist, stellvertretender Stationsvorstand bei der Spanisch-Brötli-Bahn und schliesslich Hausmeister am Polytechnikum (ETH). Ihre frühe Kindheit in der Dienstwohnung am Poly war glücklich. Aber als Sephy – so wurde sie genannt – acht Jahre alt war, stürzte der Vater eine Treppe hinunter und erholte sich nie mehr. Er musste die Arbeit aufgeben und starb 1875 mit 52 Jahren. Ihre Mutter Barbara (geb. Hirt) eröffnete ein Kolonialwarengeschäft in Zürich-Hottingen und arbeitete hart, um die Kinder durchzubringen. Zwei ältere Geschwister lebten bei ihren Lehrmeistern. 1979 riet der Vormund, Josephine und ihren kleineren Bruder Max ins städtische Waisenhaus zu geben.
Die vier Jahre im Waisenhaus sind hart. Sephy berichtet von kargem Essen, harter Arbeit, strenger Zucht. Aber im Nachhinein ist sie dankbar für die Lebensschule. «Lernen dürfen ist das schönste Geschenk des Lebens», sagte ihre Mutter oft. Mit fünfzehneinhalb Jahren schliesst sie mit guten Noten die Sekundarschule ab. Vor der Waisenpflege darf sie ihre Wünsche äussern. Ärztin wolle sie werden, sagt sie bestimmt, dafür bete sie täglich. Alle schweigen betroffen. Man erklärt ihr, Arzt sei ein Männerberuf, aber Sephy beharrt. Hatte nicht Marie Heim-Vögtlin als erste Schweizerin sich das Arztstudium erkämpft, jene Frau Doktor mit der Praxis in Hottingen? Die Waisenpflege beschliesst, Sephy zunächst ans Lehrerinnenseminar zu lassen, die einzige Schule für Mädchen, die bis zur Matur führt; das Gymnasium ist noch den Knaben vorbehalten.
Sie ist eine gute Schülerin, Latein liebt sie, Mathematik weniger und Naturwissenschaften gar nicht. Ein Lehrer spricht sie konsequent mit «Joseph» an und lässt sie fühlen, dass sie hier fehl am Platz sei. Sie beschwert sich und beschliesst, ihm nicht mehr zu antworten. Schliesslich weist der Rektor den Lehrer an, sie mit richtigem Namen anzusprechen, aber sie schweigt beharrlich und wird nur deshalb nicht ausgeschlossen, weil sie gute Noten macht. 1886 besteht sie die Matur und tritt euphorisch das Medizinstudium an.
Ärztin aus Leidenschaft
Die Universität Zürich lässt Frauen seit 1867 zur Prüfung zu und ist damit eine der ersten Universitäten, ausser jenen in Frankreich und den USA. Der Durchbruch gelang der Russin Nadeschda Suslowa, die 1867 den Doktor in Medizin gemacht hatte. Die ersten Studentinnen waren fast alle Medizinerinnen, vor allem aus Russland, Deutschland und England. Von 62 Medizinstudentinnen in den ersten dreissig Jahren bis 1897 waren bloss 13 Schweizerinnen. Sephy Zürcher ist die einzige Frau in ihrem Semester. Nach fünf Semestern besteht sie die Vorprüfungen mit gut bis sehr gut, auch in den Naturwissenschaften. Und nach nur zehn Semestern macht sie 1891 mit Bravour das Staatsexamen – als fünfte Schweizerin überhaupt.
Eine Anstellung an einer Klinik ist ihr verwehrt, die akademische Laufbahn sowieso. So geht sie nach Paris, mit einer Empfehlung ihres Professors Auguste Forel, Chefarzt der Irrenanstalt Burghölzli und Begründer der Psychiatrie in der Schweiz. In Paris studiert sie Nervenkrankheiten. Eine Assistenzstelle in einer Irrenanstalt in der Schweiz ist aber undenkbar. So arbeitet sie in Davos als Militärärztin und in Bern als Praxisvertretung. Dann beginnt sie ihre Dissertation. Forel schlägt ihr als Thema die französische Nationalheldin Jeanne d’Arc vor. Ihre Studie Jeanne d’Arc. Vom psychologischen und psychopathologischen Standpunkte aus kommt zum Schluss, die Jungfrau von Orléans sei nicht geisteskrank oder hysterisch gewesen, sondern habe an «habitueller hallucinatorischer Ekstase» gelitten. Sie sei eine pathologische Persönlichkeit, wie die meisten Genies, wenn man Genie wie Wahnsinn als Abweichung von der Norm verstehe. 1895 promoviert Josephine Zürcher zum Doktor der Medizin, als 13. Schweizerin.
Da sie keine Stellung findet, folgt sie ihrem Bruder Max, Kunststudent, nach Florenz und belegt medizinische Kurse. Dann sieht sie die Anzeige: Ein Sanatorium in Dresden sucht eine Ärztin. Eine Weile arbeitet sie dort in der Klinik. Doch unverhofft meldet sich ein gewisser Alfred Ilg, Minister am Hof von Kaiser Menilek von Abessinien. Ilg sucht eine Ärztin für die Hofdamen in Addis Abeba und hat von ihr gehört. Sephy ist sofort Feuer und Flamme, wünscht sie sich doch schon lang, fremde Länder zu bereisen und zugleich ihren Beruf auszuüben. Sie ist mit Ilg fast handelseinig. Da erfährt sie, dass Menilek nicht mit Geld honoriert, sondern mit Grundbesitz. Darauf will sie sich nicht einlassen und sagt schweren Herzens ab. Fast gleichzeitig lernt sie den Berliner Theologen Johannes Lepsius kennen. Von 1894 bis 1896 ist es in der Türkei zu Massakern an der christlichen Minderheit der Armenier gekommen. Die Not ist gross, vor allem braucht es Ärzte, um Verletzte zu versorgen und Seuchen zu bekämpfen. Vergeblich hatte Lepsius einen Arzt gesucht, der für sein Armenierhilfswerk «Deutsche Orientmission» nach Urfa geht. Josephine zögert keine Sekunde, es treibt sie die Leidenschaft für den Beruf und Abenteuerlust.
Berufsverbot in Urfa
In Urfa sind überall die Folgen der Armenier-Pogrome sichtbar. Sephy Zürcher richtet sofort ihr Spital ein. Am 22. Juli 1897 wird es eröffnet, bald drängen sich bis zu 200 Patienten im Hof. Unterstützt wird sie von einem armenischen Arzt, einem Apotheker, einem Diener, einem Leibgardisten und dem in Palästina aufgewachsenen Henry Fallscheer, der die Administration erledigt. Kein halbes Jahr später trifft jedoch ein Brief vom Sultanshof ein: Die «Hohe Pforte» verbietet ihr jede ärztliche Tätigkeit, weil sie kein türkisches Diplom hat. Das türkische Examen kann sie aber nicht nachholen, weil Frauen nicht zugelassen sind. Sie reist sofort nach Konstantinopel, ihr Gesuch wird abgelehnt. Laut Statistik hat ihr Spital in gut fünf Monaten 11 970 Konsultationen und 142 chirurgische Eingriffe durchgeführt. Ein Basler Arzt wird ihr Nachfolger in Urfa. Sie selbst erhält vom Innenministerium gegen eine horrende Summe immerhin einen «Permis» für den Bezirk Aleppo weiter südlich. In Aleppo findet Henry Fallscheer, mit dem Josephine inzwischen verlobt ist, eine Stelle als Kaufmann bei der Schweizer Handelsfirma Schüepp & Co. Im Juni 1899 heiraten sie, auch weil Josephine als Frau nicht rechtskräftig entscheiden und mit Ämtern verhandeln darf. Kurz nach der Heirat richtet sie ihre Praxis ein, die einzige europäische weit und breit. Und 1901 bringt sie in einer Zangengeburt, bei der sie selbst den Geburtshelfer instruiert, ihre einzige Tochter Gerda zur Welt.
Die Praxis bringt kaum etwas ein, denn nach Landessitte bezahlt jeder, was er vermag, Reiche mehr, damit Arme gratis behandelt werden können. Während einer Cholera-Epidemie eröffnet Josephine eine Apotheke. Dem Chef der Cholera-Kommission ist die «Provinzhebamme» jedoch ein Dorn im Auge: Er sucht Wege, um ihre Zulassung für ungültig zu erklären. Er zwingt sie, für die Klinik eine neue Bewilligung zu kaufen. Er veranlasst ein Gesetz, wonach Apotheken nur mit türkischem Diplom geführt werden dürfen. Und als Henry ein solches erlangt, erlässt er eine auf sie gemünzte Klausel, wonach Arzt und Apotheker nicht verwandt sein dürfen. Eine Frau, die das Vertrauen der Bevölkerung gewinnt, besser Bescheid weiss und anders als türkische Ärzte Zutritt zu den Harems hat – das darf aus der Sicht der Oberen nicht sein. Wieder muss Josephine aufgeben. Sie hadert mit ihrem Schicksal in diesem Land, wo Einsatz und Pflichterfüllung nichts helfen, wenn sie als Frau dem Sultan nicht genehm ist.
Im Dauerprovisorium
Für Sephy und Henry heisst es packen für eine Odyssee von einem Provisorium zum nächsten. In Marasch nördlich von Aleppo kann Sephy im Deutschen Missionsspital ein Jahr den Chefarzt vertreten, behandelt viele Verstümmelte der Armenier-Massaker und Patienten mit Infektionen und Schlangenbissen. Henry unterrichtet sechs Tagesreisen entfernt an der Amerikanischen Universität in Beirut. Dann ziehen die beiden nach Antiochia westlich von Aleppo, wo Sephy eine Praxis und Henry ein Handelsgeschäft eröffnet. Kaum eingerichtet, erhält er eine Stelle als Buchhalter bei der Deutschen Palästina-Bank in Haifa. Sephy setzt sich wortlos hin und bricht in Tränen aus. Für Henry bedeutet es ein grosses Glück und die Rückkehr ins Land seiner Kindheit, für sie eine weitere Entwurzelung.
In Haifa treffen sie 1905 ein und kommen etwas zur Ruhe. Die Stadt mit dem einzigen Hafen der Küste ist kosmopolitisch und moderner als die Provinz. Palästina gehört zum Osmanischen Reich, aber die Bevölkerung ist halb christlich, halb mohammedanisch; westliche Staaten spenden viel, um die bedrängten Christen zu schützen und Kirchen, Missionen und Spitäler als Bollwerke gegen den Islam zu halten. Sephy richtet eine Praxis ein und behandelt Epidemienkranke, hält Sprechstunden in den nahen Dörfern und verarztet zudem über 100 Pferde zweier deutscher Fuhrhaltereien. 1909 wird Henry nach Nazareth versetzt. Sephy, nach einer Malaria geschwächt, reduziert die Praxis in Haifa und hat nun Zeit zum Schreiben. Sie legt ihre Erfahrung in Fachartikeln nieder und stellt sich in einem aufsehenerregenden Artikel gegen ihren ehemaligen Professor Auguste Forel, der die Unsterblichkeit der Seele als Humbug bezeichnet hatte. 1912 wird Henry zum Bankleiter in Nablus befördert, wo auch christliche Frauen den Schleier tragen müssen. Als Ehefrau muss sich Sephy dem Mann unterordnen, die Berufsausübung wird ihr untersagt, nur zu Notfällen wird sie geholt. «Warum bin ich als Frau geboren und nicht als Mann!», ruft sie aus.
Kaum sind die beiden sesshaft, kündigt sich im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg an. Alles ist in Aufruhr, Kriegsvorbereitungen, Soldatenkolonnen, Flüchtlingsströme. Sie bleiben, bis die Bank liquidiert wird. Dann ziehen sie nach Jerusalem, wo Henry als Lehrer arbeitet und Sephy die Leitung des Deutschen Spitals übernimmt. Die Lage spitzt sich zu, Lebensmittel werden knapp, Seuchen brechen aus, Sephy erkrankt erneut an Malaria. Und in den Provinzen kommt es zur Verfolgung und planmässigen Vernichtung der Armenier mit Massakern und Todesmärschen.
Zurück in Europa
Im März 1917 wird Henry zum Wehrdienst nach Deutschland einberufen. Das Paar reist nach Esslingen am Neckar. Sephy stellt sich als Ärztin zur Verfügung, Henry wird nach wenigen Wochen aus der Armee entlassen, weil der Lehrermangel gross ist. Als nach dem Krieg die Frauen in Deutschland die politische Gleichstellung erhalten, wird Josephine Zürcher deutlich: In der Stuttgarter Zeitung schreibt sie: «Wenn mir nun im 53. Lebensjahr nicht nur Staatspflichten auferlegt werden, sondern mir auch Staatsrechte erwachsen, so vermag ich darin nicht etwa ein ganz unverdientes, gnädig bewilligtes Geschenk zu erblicken, sondern nur die reichlich spät erfolgte Aufhebung einer Rechtsverkürzung, einer sozialen Ungerechtigkeit, einer politischen Benachteiligung, einer wirtschaftlichen Schädigung.»
1921 planen Sephy und Henry eine Reise nach Jerusalem, um der betagten Schwiegermutter beizustehen. Doch da hustet Sephy plötzlich Blut. Das Röntgenbild zeigt eine abgeheilte Tuberkulose, die wieder aufflackert. Sie erholt sich in Herisau, dann im Tessin, bleibt aber schwach. «Nur im Orient kann ich gesund werden», schreibt sie Henry. Anfang 1922 fährt sie mit Tochter Gerda nach Haifa. Die Familie lässt sich in Bethlehem nieder, in einem umgebauten Stall voll Ungeziefer. Sie führt keine Praxis mehr und behandelt vor allem Schlangenbisse. Später ziehen sie in eine Dienstwohnung im Schulhaus. Von 1925 bis 1930 leben sie wieder in Jerusalem, wo Henry unterrichtet. Weil die Schule aber keine Altersversorgung bietet und sie in all den Jahren nichts sparen konnten, muss Henry in den deutschen Schuldienst übertreten. Schweren Herzens nimmt Sephy Abschied vom Orient.
Sie ziehen nach Stuttgart, wo Sephy Kranke besucht und seelsorgerisch tätig ist. Dann zwingt sie hohes Fieber ins Bett. Sie stirbt 66-jährig am 10. Juli 1932. Ihr Leben sei «farbig und abenteuerlich» gewesen, wie sie es sich gewünscht habe, sagte sie einmal. Sie bereue nichts. Josephine Zürcher war eine Pionierin, die ihren Weg ging – da, wo sie als Arzt am meisten gebraucht wurde und es als Ärztin am schwersten hatte.
Über den Autor:
Dr. Helmut Stalder, geboren 1966, ist ein Schweizer Journalist und Buchautor. Er studierte Germanistik, Geschichte und Politische Wissenschaften in Zürich, Frankfurt am Main und an der Columbia University in New York und promovierte über das journalistische Werk von Siegfried Kracauer. Er war als Redakteur bei einigen bedeutenden Tageszeitungen, u.a. der Neuen Zürcher Zeitung tätig. 2021 hat er die Verlagsleitung von NZZ Libro übernommen. Helmut Stalder ist verheiratet, Vater von drei Söhnen und lebt in Winterthur.
Thematisch beschäftigt er sich unter anderem mit der Wirtschaft- und Technikgeschichte, schweizerische Identität und politische Mythen. Dazu hat er mehrere erfolgreiche Sachbücher geschrieben, u.a. „Verkannte Visionäre – 25 Schweizer Lebensgeschichten“. Der Artikel über Josephine Zürcher ist ein Kapitel aus dem Buch, 24 weitere spannende Geschichten zu Schweizer Visionären aus ganz unterschiedlichen Gebieten, ob Wirtschaft, Literatur oder Technik, sind im Buch zu finden, das 2011 erschien und 2020 neu aufgelegt wurde. Hier kann man es online bestellen.
Unter diesen Links findet Ihr weitere Artikel zu Frauen, die als Pionierinnen Geschichte schrieben: „Asta Nielsen – erster Stummfilmstar und Ikone“ (Barbara Beuys); „Die Erste – eine Rubrik, die Mut machte“ (Grete Otto) sowie „Julie Ryff und die Geschichte der Schweizerinnen“ (Franziska Rogger).