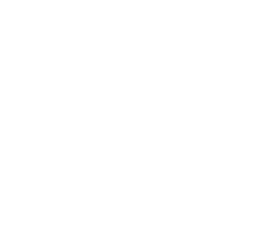„Bretter, die die Welt bedeuten“
Bretter, die die Welt bedeuten
geschrieben von Hanns von Zobeltitz (erschienen 1908/09)
Hier erfahrt Ihr etwas über den Autor des Romans Hanns von Zobeltitz und hier geht es zur einer Einführung zum Roman.
Erstes Kapitel.
„Seine Exzellenz sind sehr beschäftigt,“ hatte der alte Emke zuerst gesagt, als er die Visitenkarte in Empfang nahm. Emke war im Laufe seiner langen Dienstzeit ein Menschenkenner geworden. – Eine Dame in Trauerkleidung! Trauerkleider liebten Exzellenz nicht gerade, Trauerkleider deuteten fast immer auf ein Anliegen hin. So etwas musste nach Möglichkeit ferngehalten werden. Aber er blinzelte doch unter seinen buschigen, weißen Brauen auf die Karte herunter: „Dorothea von Lindenbug“.
Bittstellerinnen mit adligem Namen waren eigentlich doppelt vorsichtig anzunehmen. Die hatten immer gleich Tränen in den Augen, und Exzellenz waren so weichherzig – und nachher schimpften Exzellenz.
„Seine Exzellenz sind wirklich sehr beschäftigt – “
„Bringen Sie nur die Karte hinein. Exzellenz wird mich schon empfangen.“
Emke hob etwas verwundert die Augenlider.
Die Stimme tat’s ihm an. Er hörte ja hier im Vorzimmer des Intendanten tagaus, tagein die verschiedensten Stimmen, er kannte sich aus. Eine gewöhnliche Bittstellerin war das nicht. Es lag etwas eigen Sicheres in ihrer Stimme.
Er trat vom rechten Fuß auf den linken, und dann wieder vom linken auf den rechten. Immer, wenn er schwankend in seinen Entschlüssen wurde, verlegte er das Schwergewicht seines Körpers von dem einen Fuß auf den anderen.
„Gnädiges Fräulein werden aber sehr lange warten müssen.“
„Das tut nichts. Ich habe Zeit.“ –
Am Ende hatte diese hübsche junge Dame gar nichts mit der Bühne zu tun? Hübsch war sie. Auch darin kannte Emke sich aus. Man ist doch nicht umsonst zwanzig Jahre bei der Intendanz des Hoftheaters!
Groß war sie und schlank. Und ein paar Augen hatte sie, schwarz wie die Nacht. Exzellenz sahen so etwas außergewöhnlich Hübsches auch nicht ungern.
„Wollen gnädiges Fräulein Platz nehmen? Ich will mal zuschauen, was sich machen lässt!“
Dorothea ließ sich auf den nächsten Stuhl nieder. Sie war todmüde. Nicht so körperlich, wie geistig. Die Spannkraft ihrer Seele war am Erlöschen.
Sie schloss auf ein paar Momente unwillkürlich die Augen.
Vor knapp zwei Stunden war sie in Gemar angekommen, noch zu früh, um sofort zu Exzellenz von Rakolski zu gehen. So ging sie langsam durch die Straßen, in denen ihr jede Ecke, jedes Haus so wohlbekannt, so vertraut war. Und da kamen die Erinnerungen! Vor dem altersgrauen Schloss stand sie und sah hinauf zu den Fenstern des Damastsaales, auf dessen Parkettboden sie ihre ersten Triumphe gefeiert hatte. Vor dem Hause, in dem ihre Eltern gewohnt hatten, stand sie, und die Bilder von Vater und Mutter stiegen wieder vor ihr auf: der goldige, leichtlebige, elegante Vater, der die Sorgen von sich abzuschütteln wusste wie ein paar Regentropfen; die ernste, gütige Mutter, die so schwer trug und doch immer ein liebes, mildes Lächeln auf dem Gesicht hatte. Nun ruhten sie beide in der kühlen Erde, hatten ihr Kind, das sie so heiß geliebt und so verzogen hatten, allein zurückgelassen – allein und hilflos.
Und dann war Dorothea hinausgegangen in den weiten Park an der Elm. Dort hatte sie sich die stille Bank unter den Buchen ausgesucht, auf der sie Abschied genommen von dem einen, den sie nie vergessen konnte; der um ihretwillen in die Ferne gegangen war, und der nun auch den ewigen Schlaf schlief, in fremdem Boden, niedergeworfen von einer heimtückischen Kugel.
Drei Jahre nur, dass sie dort im Park mit ihm gesessen! Im Frühling war’s! – Und nun herbstete es schon leicht, zum dritten Male. Achtzehn Jahre war sie damals gewesen – und seitdem hatte jedes Jahr ihr einen Trauerfall gebracht, bis sie nun allein, ganz allein und hilflos im Leben stand.
Nein! Nicht hilflos! Hilflos ist nur, wer mutlos ist!
Dorothea öffnete die Augen weit, fast gewaltsam.
Sie war doch nicht mutlos! Sie war doch fest entschlossen, den Kampf aufzunehmen – den harten Kampf mit dem Leben. Sie hatte doch ein Ziel vor sich, ein großes, schönes Ziel. Wo ein Ziel war, musste auch ein Weg sein. Musste –
Gerade über alle Leid und alle Schmerzen führte dieser Weg zum Ziel. Ihr fiel ein, was Goethe in der „Iphigenie“ den Arkas sagen lässt:
„Die Schmerzen sind’s, die ich zu Hilfe rufe;
Denn es sind Freunde, Gutes raten sie.“
Ihre Auge wurden wieder hell. Sie sah sich um.
Nicht viel anders war dies Wartezimmer des Intendanten als das Sprechzimmer eines großen Arztes. Aber doch wieder eine besondere Prägung, wenn man genauer zusah. Drüben an der Wand die Bilder des verstorbenen Herzogs und der Herzogin-Witwe – natürlich, wie hätte diese leidenschaftliche Theaterfreundin hier fehlen dürfen. Darunter eine lange, mit rotem Samt gepolsterte Bank. Da saßen, wie es schien, die minder Anspruchsvollen oder die minder Beachteten. Ihr hatte der alte, weißhaarige Diener einen besseren Platz angewiesen, ein zierliches Rokokostühlchen mit goldener Lehne vor dem einzigen Tisch im Raum, einem mächtigen Renaissancetisch.
Auf Dorotheens Seite war es fast leer, nur in einer Fensternische saß ein blasser Jüngling, der eine rote Mappe umklammert hielt. Drüben auf der Wartebank harrten vier weibliche Gestalten. Rechts eine junge, leidlich hübsche Person mit großem Hut und im eleganten Bolerojäckchen. Links, auf Armeslänge fast wie absichtlich getrennt, drei ehrwürdige Matronen. Sehr ehrsam; die mittelste hatte sogar eine Handarbeit herausgenommen und häkelte. Häkelte im Vorzimmer. Seiner Exzellenz, musste also wohl Erfahrung haben, wie lange man hier warten durfte.
Die junge, leidlich hübsche Gestalt hatte wohl weniger Geduld. Sie schlenkerte mit den Füßen, die in schicken Chevreaustiefeletten staken. Die drei älteren Damen tuschelten eifrig. Ab und zu fing Dorothea ein Wort auf. Die eine sprach von ihren Kindern, die andre von der Küche; dazwischen wisperten sie über den Inspizienten, wie es schien, einen sehr gestrengen Herrn. Und bisweilen schoss ein Seitenblick auf die leidlich Junge, leidlich Hübsche, der von der andern Hälfte mit einem maliziösen Lächeln erwidert wurde.
Ein paarmal ging die Tür drüben. Ein Bote hastete mit einer Aktenmappe quer durch das Zimmer, um im „Allerheiligsten“ – nach diskretem Anklopfen – zu verschwinden. Einmal kam ein Offizier. Dorothea erschrak, denn sie meinte, sie müsse ihn kennen; es war ein Irrtum. Er schritt aber, ohne sich umzusehen, sporenklirrend durch den Raum, blieb eine ganze Weile bei dem Intendanten und kam, ohne rechts und links zu blicken, zurück. Jetzt erst bemerkte Dorothea, dass er die Abzeichen der Flügeladjudanten trug. Dann tauchte ein Mann mit wallenden Künstlerlocken und einer großen Rolle unter dem Arm auf, setzte sich selbstbewusst an den Tisch und starrte sie recht herausfordernd an. Er schien sogar nicht übel Lust zu haben, ein Gespräch zu beginnen und rollte seine Papiere auseinander. „Die Entwürfe für die neuen Dekorationen zum ‚Sommernachtstraum‘, wenn es Sie interessiert – “ Nein, es interessierte sie nicht. Oder doch, es interessierte sie, aber eine Unterhaltung mit dem fremden Manne, das ging doch nicht! Dann musste sie leise über sich selber lächeln; das saß gar zu fest im Blut, diese peinliche Rücksichtnahme auf Form und Sitte – und so manches davon musste gewiss aufgegeben und abgestreift werden.
„Frau Bächthold!“ Der alte Diener steckte den Kopf ins Zimmer und rief den Namen. Es musste ähnlich wie auf dem Gericht sein, wenn die Parteien aufgerufen wurden.
Die Mittelste, Ehrwürdigste stopfte eilfertig ihre Häkelarbeit in den Pompadour und trat in das „Allerheiligste“.
„Fräulein Kretzing und Madame Wiederstein! Aber’n bissel schnell, meine Damen!“
Und zum dritten MaleL „Fräulein Gerdini!“, worauf die leidlich Junge, leidlich Hübsche wie eine Bachstelze durch das Zimmer hüpfte.
Drinnen schien es eine etwas erregte Auseinandersetzung zu geben. Trotz der doppelten Tür schallten die Frauenstimmen in das Wartezimmer, bis dann eine starke, männliche irgendein Machtwort zu sprechen schien.
„Seine Exzellenz glätten mal wieder die erregten Wogen,“ meinte der Dekorationsmaler mit dem lockigen Haupt. „Diese Choristen liegen sich ewig in den Haaren, und die alten sind die Schlimmsten.“
Es dauerte eine Weile. Dann tat sich wieder die Tür auf, die drei älteren Damen kamen im Gänsemarsche heraus, gefolgt von der leidlich Jungen, leidlich Hübschen. Alle vier hatten hochgerötete Gesichter. Kaum waren sie aus dem Bereich des gestrengen Herrn, so machten die drei Ehrwürdigen vor der leidlich Jungen einen tiefen Knicks, ganz tief, ganz devot und voll bitteren Hohns: „Ihre Dienerin, Fräulein Gert“ – „Wolh bekomm’s Mademoiselle Gerdini!“ – „Verzehren Sie’s in Gesundheit, Jungfer Adelheid!“
Und die leidlich Junge, leidlich Hübsche knickste wieder: „Ganz nach Ihren Wünschen, meine Damen!“
Da kam gerade der alte Diener zurück. „Seine Exzellenz lassen bitten, gnädiges Fräulein!“ meldete er respektvoll.
Gleich darauf stand Dorothea vor dem Intendanten.
Der Verdruss schien seiner Exzellenz noch auf der hohen Stirn geschrieben. Er erhob sich jedoch sofort und streckte Dorothea beide Hände entgegen. „Fräulein Diedel! Wahrhaftig – Fräulein Diedel! Verzeihen Sie, dass ich Sie warten lassen musste. Diese unangenehmen Zänkereien des Personals, Neid, Eifersucht, Klatschereien – ah, Sie können das ja doch nicht verstehen! Aber willkommen, herzlich willkommen! Lassen Sie sich mal ansehen – famos, großartig! Ich freue mich so herzlich, Sie zu sehen –„
Plötzlich stutzte er und wurde ein wenig verlegen. Er hatte erst jetzt bemerkt, dass Dorothea Trauerkleider trug, und es schoss ihm plötzlich durch die Erinnerung, dass ihm vor zwei oder drei Monaten, oder war’s noch länger her, die Todesanzeige von Frau Oberstleutnant von Lindenbug zugegangen war? Aber woher nur? – Man kann doch unmöglich alles behalten, und schließlich war man seit der Versetzung Lindenbugs und seinem Tode ja auch gesellschaftlich ziemlich auseinandergekommen. Aber leid tat einem das arme, hübsche Ding da – solch eine vater- und mutterlose Waise – sehr leid. Viel Vermögen war gewiss auch nicht vorhanden.
„Mein armes, liebes Kind!“ Er änderte seinen Ton. „Sie haben Schweres durchzumachen gehabt.“ Nochmals drückte er ihr die Hand. „Nun setzen Sie sich aber endlich. Hat die Mama sehr gelitten?“
„Der Tod war ihr eine Erlösung – “ Dorothea musste alle Kraft zusammennehmen, um antworten zu können. Die Tränen wollten ihr in die Augen schiessen. Aber sie überwand sich. „Noch nicht fünfzig Jahre ist Mama alt geworden – “
„Sie kommen von Blankenburg?“ Der Intendant hatte sich jetzt endlich erinnert. „Nicht wahr, Mama lebte doch zuletzt in Blankenburg im Harz?“
„Jawohl, Exzellenz. Mama wollte dort ein Pensionat gründen. Aber ihre Hoffnungen schlugen fehl, wie so vieles im Leben – “
„Und Sie stehen nun ganz allein?“
„Es ist so, Exzellenz.“ Wieder fasste Dorothea all ihre Kraft zusammen. Einmal musste es doch gesagt werden. „Ich komme mit einer Bitte – mit einer großen Bitte, Exzellenz!“
Herr von Rakolski hatte sich schon etwas Ähnliches gedacht. Ihm wurde ungemütlich zumute. Was konnte das junge Mädchen von ihm wollen? Eine Unterstützung? Die Lindenbugs waren immer sehr stolz gewesen. Seine Fürsprache? Nun ja – man musste zusehen, was zu machen war. Schon aus alter Freundschaft. Und dann war Dorothea wirklich ein liebes Mädel. Vielleicht konnte man Hoheit für sie interessieren. Hoheit hatten sie ja schon ausgezeichnet, als sie noch ein halber Backfisch war.
„Was ich tun kann, liebes Kind, was in meinen Kräften steht, das soll ganz gewiss geschehen,“ sagte er eifrig.
Sie schöpfte tief Atem. Über ihr blasses, schönes Gesicht flog eine leichte Röte. Es war doch sehr schwer, sich so ganz offen auszusprechen. Unsagbar peinlich war es.
„Ich muss etwas weit ausholen, Exzellenz,“ begann sie dann. „Als Papa zu kränkeln anfing und den Abschied einreichen musste, kaum ein halbes Jahr nach seiner Versetzung von hier, erfuhren wir, Mama, und ich, eigentlich erst, wie trübe es mit unseren pekuniären Verhältnissen bestellt war. Exzellenz haben Papa ja gekannt in seinem sonnigen Optimismus. Er glaubte den Generalsrang sicher in der Tasche zu haben, und so hatte er im Vertrauen auf seine glänzende Laufbahn das kleine Vermögen Mamas bis auf einen kleinen Rest aufgebraucht. Auch den verschlang seine Krankheit. Wir waren dann auf Mamas Witwenpension angewiesen, und wenn Mama gesund geblieben wäre, würde sie bei ihrer Umsicht und Sparsamkeit wohl ausgekommen sein. Aber da wurde auch sie krank. Es kamen sehr, sehr schlimme Tage – Wochen – Monate, bis sie dann die Augen schloss, mit der Sorge um meine Zukunft im Herzen – “
Der Intendant war aufgestanden. Er ging ein paarmal durch das Zimmer und blieb dann wieder vor Dorothea stehen. „Sie armes Hascherl! Lieber Gott, wie traurig das doch ist! Aber es ist recht, dass Sie zu mir gekommen sind. Wir wollen überlegen, was zu tun ist. Natürlich muss für Sie ein standesgemäßes Unterkommen gefunden werden.“ Nur nicht verzweifeln, liebe Diedel! Sie sind noch so jung, ich darf auch das sagen: Sie sind hübsch, sehr hübsch sogar, das Leben liegt vor Ihnen. Gewiss, es wird alles noch gut werden. Lassen Sie nur hören: Haben Sie schon irgendwelche Pläne, irgendwelche bestimmten Wünsche?“
Das sagte sie es schnell und kurz: „Ich will zur Bühne, Exzellenz!“
Und wieder flutete das Rot, diesmal in einer dunklen Welle, über ihr Gesicht.
„Unsinn – !“
Herr von Rakolski war erstaunt, war geradezu erschrocken.
„Pardon! Fräulein Diedel! Es ist aber wirklich eine ganz unsinnige Idee!“ erklärte er eifrig. „Damit dürfen Sie mir nicht kommen. Das sind Phantastereien, und ich würde unverantwortlich handeln, wenn ich diese unterstützen wollte. Ich denke gar nicht daran! Das ist für mich abgetan. Da habe ich denn doch etwas Vernünftigeres für die Tochter meines alten Freundes und Kameraden. Im Frühjahr verheiratet sich Fräulein von Wächtern, und damit wird die Stellung der Hofdame bei Prinzess Elisabeth frei. Nun – was würden Sie dazu sagen?“
Das Blut war aus dem edlen, schönen Mädchengesicht gewichen. Blass und traurig sah Dorothea aus. Dabei lag ein Zug entschiedener Ablehnung um den feingeschnittenen Mund.
„Exzellenz sind sehr gütig,“ sagte sie. „Aber ich eigne mich so gar nicht zu einer solchen Stellung. Ich muss es ehrlich gestehen: ich bin eine viel zu selbständige Natur, um mich so in eine fremde Persönlichkeit hineinfinden zu können, wie es eine Hofdame muss.“
Sie hatte bescheiden, aber sehr bestimmt gesprochen. Der Intendant hörte und sah ihren festen Willen. Er war verdrossen. Lächerlich, eine solche Chance auszuschlagen – in ihrer Lage! Aber es war doch etwas in ihrer Art, das ihn fesselte und ihm imponierte.
„Liebes Kind,“ meinte er, „Sie sind eine kleine Törin. Wer muss sich denn nicht in fremde Persönlichkeiten finden, und muss sich fremden Verhältnissen unterordnen? Jeder muss das, ich auch, und zwar mehr, als Sie ahnen. Aber des Menschen Wille soll ja wohl sein Himmelreich sein. Wenn Sie also von der guten Prinzessin Elisabeth nichts wissen wollen, werden wir etwas andres für Sie suchen.“
„Exzellenz, ich möchte zur Bühne!“
Wieder sagte sie es ganz kurz und knapp, mit scharfer Bestimmtheit.
Jetzt wurde der Intendant wirklich ärgerlich.
„Und ich will davon nichts hören. Verstehen Sie mich, Sie sprechen wie der Blinde von der Farbe! Was ahnen Sie von den Widerwärtigkeiten dieses Berufs, von den hundert Gefahren und Fallstricken, die er stellt? Was wissen Sie von den Brettern, die die Welt bedeuten – bedeuten sollen! Großer Gott! Was wissen Sie davon, wie viele sich berufen fühlen und wie wenige auserwählt sind! Das bißchen Tand und Schimmer blendet Sie einfach.“
Dorothea hatte sich erhoben.
„Dann muss ich gehen, Exzellenz – vielen herzlichen Dank für alle Güte – “
„Ach was! Dank hin – Dank her! Von Dank ist gar nicht die Rede! Und gehen? Wahrhaftig wie eine verletzte Tragödin – “
„Nein! Nein, Exzellenz!“
„Da setzen Sie sich wieder hin, und wir unterhandeln weiter wie zwei vernünftige Menschen. Wie in aller Welt kommen Sie denn nur auf diese unselige Idee?“
Sie hatte ihn gar nicht angesehen während des letzten Teils der Unterredung. Nun hob sie die Augen.
„Exzellenz, Sie tun mir wirklich unrecht,“ sagte sie offen. „Das bißchen Tand und Flitter tut es bei mir nicht. Und alles, was Sie mir von den Widerwärtigkeiten und Gefahren sagten, habe ich mir selber schon gesagt. Aber den Gefahren, meine ich, kann man aus dem Wege gehen, und Widerwärtigkeiten kann man überwinden. Hier sitzt es, Exzellenz, im Herzen sitzt es mir: da ist der große Drang in mir lebendig geworden, der unwiderstehliche Trieb!“
„Das sagen Sie alle! Und jedes kleine Lichtlein glaubt ein großer Leuchter zu werden. Fräulein Diedel, Fräulein Diedel, wissen Sie denn überhaupt, ob Sie auch nur eine Spur von Talent haben? Wer in aller Welt hat Ihnen denn das in das allerliebste Köpfchen gesetzt?“
Zum ersten Male huschte ein leichtes Lächeln über ihr Gesicht, als sie etwas schalkhaft erwiderte: „Ein sehr kompetenter Beurteiler, glaube ich, es war der Intendant des Herzoglichen Hoftheaters, Exzellenz von Rakolski.“
„Aber – na hören Sie – ich dächte doch – “
„Vor vier Jahren debütierte hier ein Backfisch im Offizierskasino. Man gab die ‚Zärtlichen Verwandten‘. Seine Hoheit der Herzog beehrten die Vorstellung mit seiner Gegenwart. Vielleicht würde er sich erinnern, dass, nachdem der Vorhang gefallen war, Seine Exzellenz, der Intendant, dem jungen Ding über sein Spiel einige ganz besondere Schmeicheleien sagte – und sogar sagte: ‚Diedelchen, ich engagiere Sie vom Fleck weg!’“
Herr von Rakolski musste denn doch lachen, herzlich lachen. „Da sieht man wieder einmal, wie vorsichtig unsereiner sein muss,“ meinte er. „Das hatte ich freilich vergessen. Ja, Fräulein Diedel, Sie wissen ja aber selbst, dass es nicht ernst gemeint war. Allerdings, jetzt besinne ich mich auch, dass Sie Ihre Sache famos machten – für solch eine blutjunge Dilettantin nämlich.“
„Ich habe seitdem viel an mir gearbeitet, Exzellenz.“
„Sprechen Sie doch mal was, Fräulein Diedel!“
Es war fast, als ob sie darauf gewartet hätte. Und wenn es ihn auch jetzt ärgerte, dass er sie in einer augenblicklichen Eingebung aufgefordert hatte, so half das nichts mehr. Dorothea war schon aufgestanden, einige Schritte seitwärts getreten und begann die berühmten Einleitungsworte aus Goethes „Iphigenie“:
„Heraus in eure Schatten, rege Wipfel
Des alten, heil’gen, dichtbelaubten Haines – “
Er war überrascht. Welch prachtvolles Organ hatte Dorothea, wie Glockenton klang ihre Stimme. Aber das war es nicht allein. Es war Auffassung in ihrem Vortrag. Dies junge Mädchen hatte sich wirklich in die Gestalt der Iphigenie hineingedacht. Freilich, die Schulung fehlte; hier und dort kam ein Wort nicht klar genug heraus, dann und wann ging eine Endsilbe verloren. Aber wie sah dafür das Mädel aus! Hübsch, sehr hübsch hatte er Sie vorhin gefunden. Jetzt erst erkannte er, wie schön sie war. Nicht zu leugnen: eine blendende Bühnenerscheinung mit ihrer ebenmäßigen, hohen, schlanken Gestalt, dem klassischen Profil, den dunklen, leuchtenden Augen und der Fülle ebenholzschwarzen Haares, das der kleine Trauerhut kaum zu bergen wusste.
Bis zum Schluss ließ er sie sprechen:
„So gib auch mich den Meinen endlich wieder,
Und rette mich, die du vom Tod errettet,
Auch von dem Leben hier, dem zweiten Tode!“
„Bravo!“ Unwillkürlich klatschte der Intendant in die Hände. „Das heißt, Fräulein Diedel“ – er musste ja doch einschränken, wenn er nicht unnötige Hoffnungen in ihr erwecken wollte – „das heißt, recht brav für eine Dilettantin. Das Tippelchen auf dem i fehlt aber noch überall.“
Über ihr Gesicht leuchtete es.
„Ich weiß, wie wenig ich kann und wieviel ich noch zu lernen habe,“ sagte sie. Aber dann kam sie auf ihn zu und hob beide Hände bittend vor die Brust. „Exzellenz, raten Sie mir, helfen Sie mir! Lassen Sie mich nicht gehen! Ich muss zur Bühne! Es gibt keinen andern Weg für mich. Erzieherin – ich habe ja das Examen nicht gemacht. Diakonissin – der Beruf, der dazu gehört, fehlt mir so ganz und gar. Stütze – um Gottes willen! Das so wenig wie Hofdame. Und dann, Exzellenz, ich fühle es doch, der Himmelsfunke lebt und lodert in mir. Ich muss – ich muss!“
Da stand sie nun dicht vor ihm, sah ihn mit ihren großen, dunklen Wunderaugen flehend an, und er wurde schwankend; schalt mit sich, dass er’s wurde, und überlegte doch schon, wie er raten und helfen könnte.
„Es ist ja Unfug, Fräulein Diedel! Es ist ja unverantwortlich!“ brummte er. Aber er fuhr fort: „Übrigens bin ich wirklich nicht genug Fachmann, um Ihnen gut raten zu können. Da müsste man mal – ich will mal hören, ob der Ecker noch drüben im Bureau ist. Kennen Sie ihn? Nein, natürlich nicht – er ist erst hergekommen, nachdem Papa versetzt war. Unser erster Regisseur.“
Während er sprach, hatte er schon geschellt. Der alte Diener kam. Jawohl, Herr Ecker war noch im Bureau. „Ich lasse ihn auf ein paar Minuten bitten. Wer ist noch im Vorzimmer?“
„Herr Klingelberg.“
„Um aller guten Götter willen. Sagen Sie ihm, ich hätte keine Zeit. Sagen Sie dem blonden Jüngling, ich sei schwerkrank. Emke, sagen Sie ihm, ich sei gestorben! Fräulein Diedel, das ist nämlich ein Dichter, der alle Monate einmal mit einem neuen Drama bei mir erscheint und mir persönlich daraus vorlesen will, und dazu ist er ein Protegé der Prinzessin Elisabeth – schrecklich! – Wer sonst noch, Emke?“
„Herr Wiedehold, Exzellenz.“
Der Intendant stöhnte. „Ja, das hilft nichts. Die neuen Prospekte muss ich begutachten. Lassen Sie ihn herein, Emke. Sie müssen entschuldigen, Fräulein Diedel.“
Dorothea trat ganz tief in eine der Fensternischen.
Ihr Herz war so voll. Nach aller Ermutigung war jetzt etwas wie frohe Siegesgewissheit in ihr. Sie fühlte ja deutlich, welchen Eindruck sie gemacht, dass sie schrittweise Terrain gewonnen hatte. Der gute alte Rokolski! Dankbar sah sie zu ihm hinüber. Er stand jetzt neben dem Dekorationsmaler am Arbeitstisch, hatte den Zwicker aufgesetzt und beugte sich über die Zeichnungen. Die letzten vier Jahre waren auch nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Die Fältchen in dem glattrasierten Gesicht hatten sich vertieft, das Haar war fast weiss geworden. Und Dorothea erinnerte sich plötzlich, dass er schon vor Jahren einmal zu ihrem Vater gesagt hatte: „Theaterjahre sind Kriegsjahre und sollten von Rechts wegen doppelt zählen!“
Theaterjahre sind Kriegsjahre! Der Kampf würde auch ihr nicht erspart werden. Das Ringen würde schwer werden. Aber hinter Kampf und Ringen stand der Sieg – der herrliche, große Sieg!
Dann pochte es, und Herr Ecker erschien. Ein langer, hagerer Mann mit einem finsteren, blassen Gesicht. Man konnte ihm nicht ansehen, wie alt er sein mochte, vielleicht zählte er kaum dreissig, vielleicht schon fünfzig Jahre. Wie ein Fanatiker sah er aus.
Wieder schlich die zage Unsicherheit in Dorotheens Herz. Sie fürchtete sich fast vor dem Mann in dem eng anliegenden, schwarzen Gehrock, der nun zum Urteil über sie aufgerufen war.
Der Intendant entließ den Zeichner und sprach leise mit dem Regisseur. Von ihr war die Rede. Ein paarmal blickte Rakolski zur Fensternische herüber. Dann rief er sie. Nicht mehr „Fräulein Diedel“, sondern „Fräulein von Lindenbug“.
„Herr Ecker will Sie sprechen hören.“
Sie fühlte, ohne ihn anzusehen, die Augen des fremden Mannes musternd auf sich ruhen. Es war, als zergliedere er sie.
Langsam kam sie näher. „Was soll ich sprechen?“ fragte sie beklommen.
Aber im gleichen Moment sah sie in den Augen des Regisseurs ein helles Aufleuchten, gleich einem Ausdruck der Zufriedenheit, des Wohlwollens, das ihr ihre Sicherheit wiedergab. Und es klang nicht unfreundlich, als er erwiderte: „Bitte – es kommt zunächst nicht so darauf an. Sprechen Sie irgend etwas, von dem Sie glauben, dass es Ihnen liegt. Prosa, wenn möglich.“
Sie sann einige Augenblicke nach. Prosa – Prosa? Das lag ihr eigentlich weniger. Schließlich fielen ihr die Worte der Amelia aus den „Räubern“ ein:
„Du weinst, Amelia?“ Bis zum Schluss sprach sie, bis: „Ha, ich will ihn fliehen! Fliehen! Nimmer sehen soll mein Auge diesen Fremdling!“
„Und nun Verse, bitte, gnädiges Fräulein. Vielleicht den großen Monolog der Jungfrau.“
Das glückte ihr, wie sie fühlte, besser. Sie merkte auch während des Sprechens, dass Ecker sehr aufmerksam folgte.
Dann entstand eine Pause, bis der Intendant fragte: „Nun, lieber Ecker, Ihr Urteil?“
Der Regisseur machte Dorothea eine kleine, höfliche Verbeugung. „Ohne Zweifel ein schönes Talent. Dass die Begabung noch nicht entwickelt ist, wird sich das gnädige Fräulein gewiss selbst sagen. Ob sie ganz hält, was sie heute verspricht – wer vermag das mit Bestimmtheit zu sagen – “
„Weiter, weiter!“ drängte der Intendant.
Ecker sah auf Dorothea. Es war, als ob er etwas in ihrem Gesicht zu lesen versuchte, als forschte er nach den Regungen ihrer Seele. Wie in Blut getaucht stand sie da. Aber auch sie bat: „Sagen Sie mir ganz offen, was Sie denken. Ich bin ja so dankbar.“
Er überlegte noch einen Moment. Dann sagte er: „Gnädiges Fräulein, Sie haben so vieles, was für Sie eine erfolgreiche Laufbahn zu prädestinieren scheint. Eine glänzende Erscheinung – bitte, ich muss das betonen, denn es ist für unsern Beruf wichtig – ein schönes, ausdrucksvolles Antlitz, ein paar sprechende Augen, ein herrliches Organ, das Sie immerhin schon recht anerkennenswert geschult haben. Aber, wenn ich ganz ehrlich sein soll, zureden kann ich dennoch nicht.“
„Bravo!“ rief Rakolski.
„Und warum nicht?“ fragte Dorothea tonlos.
„Es ist schwer zu erklären, dies Warum, denn eigentlich spricht nur eine innere Stimme zu mir: Rate ab! Unser Beruf ist so voller Dornen, gerade für ein junges Mädchen aus Ihren Kreisen, er birgt so viele Enttäuschungen, dass nur ein eiserner Wille und nur der übergewaltige Trieb der Seele darüber hinwegtragen können.
„Das habe ich mir auch selber gesagt. Das hat mir Exzellenz auch schon, mit andern Worten, vorgehalten. Ich bitte Sie, nehmen Sie an, ich hätte diesen eisernen Willen, es lebte in mir der Himmelsfunken – ich fühle ihn ja! – und dann entscheiden Sie. Sie entscheiden über mein Lebensschicksal!“
Wieder sah er sie aus seinen seltsamen Augen forschend, prüfend an.
„Wie alt sind Sie, gnädiges Fräulein? Verzeihen Sie die unter andern Verhältnissen unhöfliche Frage.“
„Ich wurde im Sommer einundzwanzig Jahre.“
„Waren Sie immer ganz gesund? Haben Ihre Nerven je versagt?“
„Ich habe Nerven wie Stahl. Ich bin nie krank gewesen, ich entsinne mich wenigstens nicht.“
„Wissen Sie, dass Sie noch völlig Anfängerin sind? Dass Sie von Grund aus lernen müssen? Dass es sich dabei erst zeigen kann, ob Sie auch das Temperament für unsre Kunst besitzen?“
„Ich weiss es. Ich werde nie kleinmütig sein.“
Es war gleichsam Schlag auf Schlag gefallen: Rede und Widerrede.
Noch einmal ruhte der forschende Blick des Regisseurs auf Dorothea. Vielleicht mochte Ecker die Antwort auf seine letzte Frage zu ergründen suchen, die sie nicht beantwortet hatte.
Dann sagte er plötzlich: „Gut also. Ich glaube jetzt, man kann es verantworten. Versuchen Sie es – und Göttin Thalia sei Ihnen gnädig!“
„Sie sind ein Verräter!“ schrie der Intendant auf.
Aber Dorothea stürzte auf Ecker zu, mit ausgestreckten Händen. „Ich danke Ihnen! Wie danke ich Ihnen!“ rief sie mit bebender Stimme.
Sie war fieberhaft erregt, ihr Gesicht glühte, ihre Augen strahlten. ‚Wie wunderschön ist sie!‘ dachten die beiden Herren wieder, und beide sagten sich zugleich, welch köstliche Mitgift diese Schönheit gerade für die Bühne bedeutete. Sagten sich, wie selten die Theatergeschichte von hässlichen Schauspielerinnen berichtet, die Triumphe feiern konnten. Das waren dann wahrhaft große Genies. Aber selbst starke Talente brechen sich ohne die Wundergabe der Schönheit nur schwer Bahn. Das Publikum will schöne Frauengestalten auf den Brettern sehen, die die Welt bedeuten. Und das Publikum ist allmächtig.
Der Intendant hatte sich wieder auf den Sessel vor seinem Arbeitstisch gesetzt und bat Ecker und Dorothea, auch Platz zu nehmen. Er war, nun die Würfel gefallen schienen, selbst gehobener Stimmung, lächelte Dorothea zu und klopfte dem Regisseur auf die Schulter. „Na ja, mein Lieber, ein Verräter sind Sie, dabei bleibt es. Aber ich verstehe Ihre Entscheidung, verstehe Sie vollkommen. Nun müssen wir jedoch weiter beraten: Was soll Fräulein von Lindenbug zunächst tun?“
Vorhin hatte Dorothea einen sehnsuchtsvollen Blick aus dem Fenster geworfen. Drüben, jenseits der Straße, breitete sich die stattliche Front des Herzoglichen Theaters. Das Denkmal der beiden Dichterfürsten Goethe und Schiller erhob sich davor. Ihr träumte, aber sie wagte den Gedanken kaum völlig auszudenken: ‚Dort, gesegnet von ihnen, wirst du deinen Einzug in Thaliens Reich halten.‘
Da begann Ecker: „Eine gründliche Schule muss die Grundlage bilden. Exzellenz wissen das besser als ich. Bringt man eine Anfängerin gleich auf einer größeren Bühne unter, so ergibt sich fast immer ein Misserfolg, der nicht wieder gutzumachen ist. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine gute Theaterschule – Berlin bietet ja gerade jetzt die reichste Gelegenheit – oder der Anfang auf einer ganz kleinen Bühnen, die sozusagen das Handwerk in der Praxis lehrt. Ich denke, das gnädige Fräulein wird zweifellos den ersten Weg wählen.“
Das war die erste Enttäuschung auf der neuen Laufbahn. Ade, du Traum– du schöner Traum –
Und die Enttäuschung, auf ein Engagement in Gemar verzichten zu müssen, tat’s nicht allein. Der Besuch einer Theaterschule in dem teuren Berlin, wie sollte sie den erschwingen?
Sie schwieg und senkte traurig den Kopf.
Der Intendant suchte ihr zu Hilfe zu kommen. „Sie können vor Herrn Ecker ganz offen sprechen, Fräulein von Lindenbug,“ sagte er. „Auch über Ihre pekuniäre Lage. Es ist ja wahrhaftig keine Schande, arm zu sein. Wie steht es: Werden Sie den Besuch einer Theaterschule ermöglichen können?“
„Nein,“ kam es gepresst von Dorotheens Lippen. „Wenn ich alles zusammennehme, was mir bleibt, sind es kaum dreitausend Mark. Ein letzter Notgroschen – ich müsste ja doch auch wohl daran denken, dass ich ihn mir möglichst für meine Bühnenausstattung reserviere.“
Es entstand eine Pause.
Ecker sah wieder prüfend auf das junge Mädchen. Er dachte: ‚Du hättest doch wohl abraten sollen. Du würdest gewiss abgeraten haben, wenn Du das gewusst hättest.‘
Mit gesenktem Kopf saß Dorothea da. Aber plötzlich hob sie die Augen. Ihr Entschluss war gefasst. Es musste ja sein.
„So raten Sie mir, wie und wo ich ein Unterkommen an einer kleinen Bühne finde,“ sagte sie entschlossen. „An einer Bühne, an der ich wirklich lernen kann.“
Die Blicke der beiden Herren begegneten sich.
„Exzellenz haben vielleicht von dem alten Reesemann gehört, bei dem Herr Maurer begann. Er ist ein alter Praktikus, um den es eigentlich schade ist. Augenblicklich gondelt er mit seiner Truppe zwischen einigen kleinen, holsteinischen Städten herum. Wenn ich einmal bei ihm anfrage, und wenn Exzellenz einige empfehlende Worte hinzufügten – “
„Das ist ein guter Gedanke!“ Der Intendant nickte lebhaft Beifall. „Der Mann ist nicht übel, soviel ich weiss. Ist jedenfalls einer der Besseren. Wir können es wenigstens versuchen.“
Ecker stand auf und bot Dorothea die Hand. Ein paar Augenblicke hielt er sie fest in der seinen. „Glückauf, gnädiges Fräulein!“ sagte er ernst. „Und möge es Sie niemals gereuen – “
Dorothea hatte sich von dem Intendanten, Exzellenz von Rakolski, verabschieden wollen. Aber er ließ es nicht zu. Sie musste heute sein Gast sein. „Meine Frau würde es mir nie verzeihen, wenn ich die kleine, liebe Diedel, die nun ein großes, schönes Mädchen geworden ist und eine große Künstlerin werden will, ihr nicht brächte. Fräulein Diedel, machen Sie sich übrigens auf eine Strafpredigt gefasst. Dass Sie nicht zuerst zu meiner Frau gekommen sind, verzeiht sie Ihnen so leicht nicht.“ –
Es wurde nicht so schlimm. Die gute Exzellenz konnte ja überhaupt nie ernstlich böse werden. Sie war viel zu beliebt und viel zu bequem dazu. Wie eine Kugel rollte sie sich tagsüber, wenn es sein musste, durch die lange Zimmerreihe der Dienstwohnung; wie ein kleiner Pudding thronte sie fast allabendlich in der Indentanturloge und folgte ohne sonderliches Verständnis, aber mit brennendem Interesse den Vorgängen auf der Bühne. Ehedem, als Marienbad ihr noch jährlich ein paar Pfund abnahm, sollte sie von starker Eifersucht auf jede hübsche Erscheinung zwischen den Kulissen beseelt gewesen sein – wer kann das der Gattin eines Intendanten verdenken! – jetzt hatte sie sich auch das abgewöhnt. So konnte sie ohne Herzenskämpfe für das Theater im allgemeinen und für das Hoftheater im besonderen schwärmen und bald eine junge Schauspielerin, bald einen ersten Helden begönnern. Aus der großen Geselligkeit machte sie sich nichts, fast zu wenig für die Frau eines Mannes, der zu den oberen Hofchargen zählte. Die Hofgesellschaften selbst waren ihr sogar eine Qual. Aber den freundschaftlichen Verkehr im eigenen Hause pflegte und liebte „Tante Pummelchen“, wie Ihre Exzellenz heimlich von halb Gemar genannt wurde. Ganz Gemar aber kannte sie mit ihren drei Möpsen, die sich so ähnlich sahen, dass angeblich nur sie selber die kugelrunden Vierfüßler mit Sicherheit zu unterscheiden vermochte; sogar der Intendant musste sich darauf beschränken, zu wissen, dass Siddy ein rosarotes, Liddy ein marineblaues und Piddy ein stahlgrünes Seidenbändchen um den Hals trugen und daran zu erkennen waren.
Ihre Exzellenz hatte vor hellem Vergnügen in die Hände geklatscht, als sie „Diedelchen“, das „süße Diedelchen“ wiedersah. Sie hatte Dorothea, die ihr die Hand küssen wollte, sofort stürmisch an ihr Herz gezogen; und als Siddy, Liddy und Piddy sich dem jungen Mädchen wohlgeneigt erwiesen, hatte Ihre Exzellenz schmunzelnd gemeint: „Ja, diese klugen Tiere wissen, was schön ist.“
Aber nachdem Ihre Exzellenz erfahren hatte, was Diedel nach Gemar führte, was heute Vormittag auf dem Intendanturbüro erwogen und beschlossen worden war, hob sie die Hände beschwörend gen Himmel. Trotz all ihrer Schwärmerei für die Bühne konnte sie Dorotheens Wille und Absicht nicht verstehen, nicht billigen. „Kindle – das Theater! Kindle, es ist was Herrliches darum! Aber für dich – großer Gott, mir graust bei dem Gedanken, dass Du Komödie spielen sollst. Ich kenne das doch! Über fünfzehn Jahre kenne ich das nun.“
„Fritzle.“ wandte sie sich dann an ihren Mann, „bist du denn ganz von Sinnen, dass du das zugibst? Unser Diedelchen! Wo nimmst du denn nur den Mut der Verantwortung her? Du weisst doch am allerbesten, wie viele Fallgruben solch armem Ding gestellt werden – Du weisst es sozusagen aus eigenster Anschauung. Was? – Anfangen an einem kleinen Theater? Fritzle, ich kenne dich nicht wieder. Ich bin wahrhaftig nicht adelstolz, aber unser Diedelchen – Fritzle, das Herz dreht sich mir im Leibe um – “
Herr von Rakolski tat, was er stets tat, wenn Ihre Exzellenz sehr lebhaft wurde: Er tat nämlich gar nichts. Er saß ihr gegenüber, drehte die Daumen übereinander, eine Weile links- und eine Weile rechtsherum, und schwieg, bis der Sturm sich ausgetobt hatte, was nach seiner langjährigen Erfahrung bei der Kurzatmigkeit seiner Gattin nie allzulange auf sich warten ließ.
Sonst sah er dabei immer abwechselnd auf Siddy, Liddy und Piddy und stellte vergleichende Beobachtungen über den geistreichen Ausdruck der drei Mopsgesichter an, die in solchen Momenten starr und steif zu ihrer Gebieterin hinaufzublicken pflegten. Heute aber sah er nur auf Dorothea. Es war ein Zug in ihrem schönen Antlitz, von dem er nicht loskommen konnte. Je länger seine Frau sprach, desto mehr vertiefte er sich. Die starken Brauen zogen sich zusammen, dass sie sich oberhalb des feinen Nasenrückens fast berührten, und die großen Augen sahen starr und wie trotzig vor sich hin. Trotzig – wahrhaftig ja! Und gewissermaßen beruhigte ihn das: es war ganz gut, sehr gut war es, wenn das Mädchen einen Trotzkopf hatte. Sie würde ihn brauchen können in der harten Lebensschule, die vor ihr lag. Trotz war ja doch wohl der Stiefbruder von Willensstärke.
Endlich ging nun Ihrer Exzellenz doch die Luft aus. Sie holte noch ein paarmal tief Atem, stieß noch einmal hervor: „Fritzle, das vergebe ich dir nie!“ und dann schwieg sie.
„Ja,“ wollte er da sagen, „ja, Trudel, du hast vollkommen recht – “ Das war nämlich sein in langer Erfahrung erprobtes Rezept. Wenn er seiner Frau beweisen wollte, dass sie unrecht hätte, begann er stets mit der starken Versicherung, dass sie absolut im Rechte wäre; daran ließen sich dann die „Wenn“ und „Aber“ desto bequemer anfügen.
Er kam jedoch diesmal nicht zu Worte, denn Dorothea sagte sofort: „Exzellenz sind so gütig!“
„Du sollst Tante zu mir sagen, Diedelchen – “
„Liebe Tante, du bist so gütig, und ich bin dir so dankbar. Ich habe das ja auch alles schon hundertfach erwogen und überlegt, auch heute morgen wieder, als mir Seine Exzellenz fast die gleichen Vorstellungen machte – “
„Hat das der Fritz wirklich getan?“
„Gewiss, liebe Tante, und sehr ernst. Aber ich habe mir nun einmal meinen Weg und mein Ziel vorgezeichnet, und ich will den Weg gehen, und ich werde mein Ziel erreichen.“
„Ach, du Törin!“
„Vielleicht bin ich das. Nur weiss ich bestimmt, dass ich auf jedem andern Wege gewiss nicht glücklich werden würde.“
Sie hatte so bestimmt gesprochen, dass Frau von Rakolski nicht sofort eine Erwiderung fand. Aber doch nicht allein deshalb, weil Dorothea so eigen fest sprach. Es kam noch etwas andres hinzu. Aus der Stimme des jungen Mädchens war ihr ein Unterton entgegengeklungen, der sie rührte. So sprechen Frauen, die irgendwin großes Unglück, irgendeinen großen Schmerz noch nicht völlig überwunden haben. Nun freilich – das arme Diedelchen hatte beide Eltern verloren –
„Trudel, können wir nicht endlich Kaffee trinken?“ fragte Rakolski dazwischen.
Diese Männer waren doch entsetzlich materiell. Aber man tat am besten, ihnen in allen Kleinigkeiten den Willen zu tun, und man liebte doch auch selbst den gemütlichen Kaffeetisch. Es hatte sich heute sowieso schon alles verschoben.
So erhob sich denn Frau von Rakolski und kugelte ins Nebenzimmer. Hinter ihr her kugelten sich Siddy, Liddy und Piddy. Dann erst folgten der Intendant und Dorothea. „Das alles werde ich noch öfter hören müssen, Fräulein Diedel,“ raunte er unterwegs ihr leise zu. Sie antwortete nicht.
Dann saß man um den runden Tisch, auf dem die silbernen Kannen, ein Geschenk Ihrer Hoheit der Herzogin-Witwe zur silbernen Hochzeit, blinkten. Umständlich und mit betonter Behaglichkeit schenkte Frau von Rakolski den Kaffee ein. „Natürlich doch Kaffee, Diedelchen, und nicht Tee, zu dem mein Fritzle schwört, seit der ‚Fünfuhrtee‘ bei den Allerhöchsten Herrschaften modern geworden ist – “ Umständlich kreisten die silbernen Schalen mit dem Napfkuchen und den gebutterten Grahambrotschnitten. Ihre Exzellenz teilte an Siddy, Liddy und Piddy aus und genehmigte sich selber ein reichliches Portiönchen.
„Aber, liebe Trudel, denke daran, was der Arzt gesagt hat,“ wagte Seine Exzellenz schüchtern zu bemerken.
„Der Doktor kann mir gestohlen bleiben. Ich werd‘ halt doch nicht dünner, ob ich mich kasteie oder nicht. Gottlob, seien wir froh, wenn’s mir noch schmeckt.“
Bei der zweiten Tasse Kaffee begann Frau von Rakolski plötzlich wieder vom Theater und Dorotheens Plänen zu sprechen. Aber ihr lebhafter Geist hatte, wie sie es bei andrer Gelegenheit wohl auszudrücken liebte, inzwischen einen „Hopfer“ gemacht. Sie sprach nicht mehr von Widerwärtigkeiten, Fallstricken, Schwierigkeiten, sondern sie rechnete mit Tatsachen.
„Kindl, hast du ’nen Begriff, was die Kostüme kosten, wenn du dich nur so halbwegs anständig herausbringen willst? Ich sag‘ dir, das rennt ins Geld. Aber da erlaub‘ nur, du armes Hascherl, dass ich an dein liebes Mütterl denk‘ und ein bissel für dich mit sorge. Weißt, Fritzle,“ fuhr sie in ihrem halben Schwäbisch fort, dass ihr immer noch aus der Kinderzeit anhaftete, „ich werd‘ mal mit der Ehlinger ein vernünftiges Wort reden. Die wollt‘ halt so schon allerlei Kostüme ausrangieren. Und dann will ich mich hinter die lange Karoline stecken. Nämlich, Diedel, das ist, wenn du’s vergessen hast, die Kammerfrau von der Prinzessin Elisabeth. Also mit der will ich reden. Die hat immer Staat von der Hochzeit zu verkaufen, nur einmal, höchstens zweimal getragen. Und eh’s der Trödler kauft, ist’s doch besser, man verschafft’s so ’nem lieben, armen Mädel wie unserm Diedelchen. Was wirst denn rot, Diedel? ’s ist noch nimmer eine Schand‘ gewesen, wenn man kein‘ vollen Geldsack hat.“
Die gute Exzellenz kam am Kaffeetisch immer etwas ins Schwatzen, heute aber besonders. Es währte nicht lange, und sie stak mitten in alten Erinnerungen. Von der Herzogin-Witwe und der Prinzess Elisabeth samt der langen Karoline ging es auf die Zeiten, in denen Dorotheens Vater als junger Hauptmann nach Gemar versetzt worden war, in die Tage zurück, in denen sich die Freundschaft mit Rakolskis wieder angesponnen hatte. Dorothea vergaß fast, dass diese Freundschaft eigentlich gar nicht recht über die Gemarer Zeit der Eltern hinausgedauert hatte, so lebhaft schilderte sie Ihre Exzellenz. Dorothea sah dabei gleichsam sich selber wieder aufwachsen, vom Schulröckchen an bis zum ersten langen Kleide und dem ersten Jahr, in dem sie in die Geselligkeit eingeführt wurde, in dem Himmel und Erde ihr mit duftenden Rosen bestreut schienen.
„Weißt noch, Diedel? Kannst dich noch erinnern?“
Und dann fiel plötzlich ein Name, der Dorothea das Blut ins Gesicht schießen und sie gleich darauf wieder sehr bleich werden ließ.
„Wenn ich so denk‘, wie hübsch du immer ausgeschaut hast, du holde Siebzehn damals. Einmal besonders – das hab‘ ich nimmer vergessen. Das war bei Kratz – ja, der gute Oberst Kratz, der ist nun auch schon in die himmlischen Heerscharen versetzt worden. Ganz deutlich seh‘ ich dich noch, Diedelchen, in deinem rosa Fähnchen den ersten Lancier tanzen mit dem armen Kastrop. Ach, du meine Güte, das arme liebe Kerlchen. Muss den der Ehrgeiz packen, meldet sich nach Deutsch-Südwest, und kaum ist er drüben, grad‘ noch im Anfang des Krieges, da bekommt er einen Schuss in die Stirn. Von oben herab, aus ’nem Baum hat ihn ein Schwarzer erschossen.“
Ganz tief in den Sessel hatte sich Dorothea zurückgelehnt, hatte die Augen geschlossen und dankte dem Himmel, dass die Dämmerung sich schon leise ins Zimmer schlich.
„Ja, der Kastrop! Etwas leicht soll er ja gewesen sein und ’s Herz immer in der Hand. Aber solch hübsches, flottes Kerlchen, man hat ihn doch halt liebhaben müssen. Nachher ist der Bruder noch mal hier gewesen – weisst du, Diedelchen, der Älteste, der Majoratsherr – und hat bezahlt, was so zu zahlen war. Ein paar Schulden hat ja halt jeder Leutnant. Der Fritzle da, wie wir geheiratet haben, der hatte auch Schulden. Gelt, Fritzle, wenn ich nicht so gut Ordnung gehalten hätt‘!“
Aber Fritzle hörte nicht mehr. Der Diener hatte ihm gerade eine Visitenkarte gebracht. „Der Herr bittet in einer ganz dringenden Angelegenheit – “ Fritzle hatte das Monokel und das Intendantengesicht aufgesetzt.
„Es ist wahrhaftig zu toll! Denkt man mal, dass man einen ruhigen Abend hat! Aber nein – bis hierher wird man verfolgt. Als ob dazu nicht das Büro da wäre?“
„Wer ist’s denn?“ fragte Ihre Exzellenz. „So reg‘ dich doch nicht so auf, Fritzle. Du kriegst noch mal ’nen Schlaganfall.“
„Maurer – Herr Edgar Maurer – “
„Unser neuer erster Held, Diedelchen. Großartig! So nimm ihn doch an, Fritzle. Er käme halt doch sicher nicht, wenn’s nicht ein‘ ganz besondre Ursach‘ wär‘.“
Der Intendant erhob sich. „Führen Sie Herrn Maurer in mein Zimmer. Ich lasse bitten,“ beschied er den Diener. „Ja – großartig. Das sagt meine Frau so. Er ist aber auch sehr anspruchsvoll, Fräulein Diedel, über alle Maßen anspruchsvoll. Ich bin doch wahrhaftig neugierig. Na – man wird ja hören. Übrigens,“ schloss er schon halb im Hinausgehen, „der Maurer hat auch an einer kleinen Bühne angefangen – “
Es dauerte ein Viertelstündchen. Der Diener brachte die Lampen. Frau von Rakolski schwatzte und schwatzte, spielte und schalt dazwischen ein wenig mit den Möpsen und schlürfte langsam die letzten Schlucke aus ihrer Tasse.
Und Dorothea saß mit halbgeschlossenen Lidern und sann der Vergangenheit nach. Was hatte der eine Name wieder alles in ihr aufgewühlt: Seligkeit der Seligkeiten, maigrünes Hoffen, jubelnde Gewissheit, Harren und Bangen, bittere Enttäuschung, Trauer und Schmerz! „Ein bißchen leicht,“ sagte Frau von Rakolski, „sei der Geliebte gewesen!“ Ja! Ja doch: Ein Philister war er nicht. Er ging nicht dem Schema nach, er konnte wohl auch nicht mit dem Pfennig rechnen. Er überlegte auch nicht, wo sein Herz jubelte, ob das Mädchen, das er liebte, den „richtigen goldenen Hintergrund“ besaß. Was hatten sie denn beide damals überlegt? Schulden hatte er gehabt. Aber, was bedeuten diese paar hundert, diese paar tausend Mark vielleicht für den Bruder, dem der Zufall der Geburt die großen Familiengüter in den Schoß geworfen hatte? Was hätte es für diesen Bruder bedeutet, wenn er von seinem Überfluss dem jüngeren die bescheidene Rente würde sichergestellt haben, die sie beide zur Verheiratung gebraucht hätten? Wie sicher hatten sie beide auf ein frohes Ja gehofft, auf ein Ja gerechnet, bis dann das kühle, ablehnende Nein kam, das sie trennte und Robert hinaustrieb in die Ferne, in den unglückseligen Krieg –
Draußen klangen Schritte, klang die Stimme des Intendanten und eine andre, fremde, wohlklingende. Der Schauspieler verabschiedete sich wohl, der „Kollege“, der auch an einer kleinen Bühne angefangen hatte.
Dann ging plötzlich die Tür.
„Erlaube, Getrud, ich glaube, du kennst Herrn Maurer noch nicht persönlich – Herr Edgar Mauer! – Fräulein von Lindenbug! – Herr Maurer kann uns einiges von Herrn Reesemann erzählen, Fräulein Diedel – “
Dorothea war aufgeschreckt.
Sie sah jenseits des Tisches, im Lichtkreis der großen Lampe, einen schlanken jungen Mann mit scharfgeschnittenem bartlosen Gesicht, einem Profil von wahrhaft klassischen Linien und einem Paar großen, leuchtenden Augen, die fragend auf sie gerichtet waren. Um den weichen Mund spielte ein leichtes Lächeln.
Sie sah, wie er Ihrer Exzellenz die Hand küsste, sah, wie er ihr selber eine tadellose Verbeugung machte.
Und sie empfand und wusste im gleichen Augenblick mit prophetischer Gewissheit, dass dieser Mann in ihrem Leben eine große Rolle spielen würde. Es warihr nicht anders, als ob ihr Schicksal in der weißen, schmalen, wohlgepflegten Hand liege, die er ihr entgegenstreckte: „Ich darf Sie als Kollegin begrüßen, gnädiges Fräulein. Per aspera ad astra!“ (Übersetzung: Zu den Sternen durch Schwierigkeiten).
Zweites Kapitel
„Eine Minute Aufenthalt!“ riefen die Schaffner.
„Schnell, schnell, Minna! Der Zug fährt gleich wieder ab.“
Recht hilflos stand Dorothea auf dem Bahnsteig. Hinter ihr kramte Minna, die treue, alte Minna, die die Eltern schon durch ein halbes Dutzend Garnisonen begleitet hatte, aus den unergründlichen Tiefen des Abteils dritter Klasse ein Stück Handgepäck nach dem andern heraus. Mit aller Seelenruhe, das war von ihren vielen guten Eigenschaften vielleicht die beste, denn aus ihrer Ruhe ließ Minna sich nicht bringen.
Der Ostwind pfiff über den Bahnhof, und es war bitterkalt, doppelt kalt nach der langen Fahrt in dem überheizten Wagen. Dorothea fröstelte, und zum ersten Male durchzuckte sie der beängstigende Gedanke: „Nur sich nicht erkälten. Nur nicht heiser werden.“
„Hast du alles, Minna? Liebe Minna, so eil‘ dich doch!“
„Man bloß noch die Plaidhülle, gnä‘ Fräulein – “
Dann fuhr der Zug weiter in die Winternacht hinaus. Das helle Licht, das aus den Wagenfenstern auf den Bahnsteig gefallen war, verblich. Der Wagen, aus dem sie gestiegen, war einer der letzten gewesen; nun standen sie, ganz am Ende des Perrons, im Dunkeln. Nur von fern leuchteten, vom Bahnhofsgebäude her, ein paar trübselige Gaslaternen.
„Gepäckträger scheint’s in Neumöller noch nicht zu geben,“ meinte Minna gelassen, „Ich werde man gehen und sehn, dass ich ’ne Mannsperson krieg‘. Alleine schaff‘ ich’s doch nich. Aber Sie müssen derweil hierbleiben, gnä‘ Fräulein, und aufpassen. Acht Stück sind’s.“
Dorothea schlug den Kragen der Pelzjacke hoch. Jetzt fröstelte sie nicht mehr, sie fror. Acht Stück, natürlich, die gute Minna hatte ja möglichst wenig Gepäck aufgeben wollen, um zu sparen. Es kostete sowieso noch genug. Sparen, sparen war jetzt die Losung. Sparen, wieder sparen und noch einmal sparen! Eine erste Liebhaberin mit ganzen fünfundsiebzig Mark Monatsgage muss wohl sparen! –
Es begann leicht zu graupeln. Dorothea sah mit Schrecken, wie sich die Flocken auf den kleinen Berg des Handgepäcks legten. Wenn die Hüte litten! Und in der Plaidhülle hatte Minna das Kostüm der Maria Stuart untergebracht, weil der große Koffer schon fort war, als die gute Frau von Rakolski es endlich schickte. Abgelegter Kram aus Gemar! Ach, und doch wie willkommen für die erste Liebhaberin an den vereinigten Stadttheatern von Neumöller, Herte und Tenburg, Direktion Eduard Reesemann. Du lieber Gott! Und Neumöller, dies Neumöller sollte die größte Stadt unter den dreien sein!
Wo nur Minna blieb?
Direktion Eduard Reesemann! Immer, wenn Dorothea an den Namen dachte, fiel ihr der Kontrakt wieder auf die Seele, den sie hatte unterzeichnen müssen. Vier enggedruckte Seiten und – so schien es ihr – auf jeder Seite ein halbes Dutzend Wolfsgruben. Vater hatte manchmal von den militärischen Kriegsartikeln erzählt, dass fast jeder Artikel den Tod androhte. In diesem Vertrag aber hieß es immer wieder: Die Direktion ist berechtigt, das Mitglied sofort zu entlassen – , die Bühnenleitung kann den Vertrag an jedem Tage der vereinbarten Probezeit lösen – , die Bühnenleitung ist nur zur Zahlung eines Drittels der Gage verpflichtet, wenn – , der Bühnenleitung steht an jedem Tage eine achttägige Kündigung frei, wenn –
Wo blieb nur Minna?
Überhaupt dieser Vertrag! Wie das alles werden sollte? Was man für Verpflichtungen auf sich nehmen musste – für fünfundsiebzig Mark Monatsgage. Die männlichen Mitglieder hatten es noch gut, denen wurden wenigstens die historischen Kostüme geliefert. Aber die armen Frauen waren verpflichtet, für alle ihre Kostüme selbst zu sorgen – bei fünfundsiebzig Mark Monatsgage! Wozu war man überhaupt nicht verpflichtet? Fiel es Herrn Direktor Reesemann ein, lebende Bilder zu stellen: man musste mitwirken. Gab es ein Ballett: man musste mitwirken. § 6 schrieb es vor.
Endlich – endlich kam Minna. Ihre lange, hagere Gestalt tauchte schattengleich im fallenden Schnee auf, hinter ihr her hastete ein Bahnangestellter, den sie irgendwie aufgetrieben hatte. Sie kommandierte schon von weitem: „Die Plaidhülle müssen Sie nehmen, gnä‘ Fräulein. Den einen Hutkarton und die Schirmtasche nehme ich – Mann, Menschenkind, fassen Sie doch den Koffer nicht so ungeschickt an.“
Draußen vor dem Bahnhofsgebäude hielt zum Glück noch ein vereinsamter Hotelomnibus. „Zum schwarzen Raben.“ Richtig, so hieß ja die Karawanserei, die ihr Edgar Maurer namhaft gemacht hatte.
Edgar Maurer! Immer, wenn sie an ihn denken musste, geschah’s mit einer Empfindung der Scheu. Und doch fühlte sie, dass sie allen Grund hatte, ihm dankbar zu sein. Denn eigentlich war es wohl seine Empfehlung gewesen, die Herrn Direktor Reesemann bewog, eine gänzlich „Neue“ zu engagieren – mit fünfundsiebzig Mark Monatsgage! Herr Reesemann hatte es klipp und klar geschrieben: „Nur auf die Empfehlung von Herrn Edgar Maurer, den mein Kunstinstitut zu seinen Mitgliedern gezählt zu haben sich allzeit zur besonderen Ehre anrechnet.“
Der Hotelomnibus wackelte langsam über das entsetzliche Pflaster. Dann und wann suchten die beiden einzigen Insassen, Dorothea rechts, Minna links, durch die beschlagenen Scheiben zu spähen. Es war nicht viel zu sehen. Kleine, ein- und zweistöckige Häuser, ab und zu eine trüb brennende Gaslaterne, ab und zu ein Schaufensterchen, ein paar durch das Schneegeriesel hastende Menschen.
Sie saßen sich schweigsam gegenüber; Dorothea in tiefen Gedanken; Minna mit ihrem unzufriedensten Gesicht. Wenn Dorothea einmal zu ihr hinübersah, las sie immer wieder in den alten Zügen: „Warum tust du mir das an?“ Und dann biss das junge Mädchen die Zähne zusammen, zwang ein Lächeln der Zuversicht herauf und nickte der Getreuen zu, als wollte sie ihr versichern: Jetzt aber kommen wir in einen Palast!
Ein Palast war nun freilich das Hotel „Zum schwarzen Raben“ nicht. Als der Rumpelkasten endlich nach einem letzten gewaltigen Ruck vor seinem Stammhause hielt, als Dorothea herauskletterte, sah sie zuerst nur das Haus wie eine schwarze, unfreundliche Masse vor sich stehen; nur ein paar Fenster zu ebener Erde waren erleuchtet, und aus dem Flur drang ein schwacher Lichtschimmer.
Eilig hatte man es hier augenscheinlich nicht. Der Kutscher musste erst einige Mal mit der Peitsche knallen, bis die Tür ging. Ein Etwas, das halb Kellnerlehrling, halb Hausdiener zu sein schien, kam und machte sich wortlos an den Koffern zu schaffen. Dann folgte ein kleines Männchen in einem grauen Rock mit Pantoffeln an den Füßen, schlürfte bis fast an die Tür und wartete hier auf die Gäste.
„Ich möchte ein Zimmer mit zwei Betten.“
„Schön – das kann wohl angehen,“ sagte der kleine, graue Mann, rührte sich aber nicht vom Flecke,betrachtete vielmehr erst noch ein Weilchen musternd die beiden Frauen; vielleicht wog er auch das Gepäck in Gedanken ab. Was die beiden wohl hier in Neumöller wollten, schien er zu überlegen. Jetzt, im Winter?
Als Dorothea ziemlich scharf wiederholte: „Ein Zimmer mit zwei Betten!“ riss er sich ein wenig zusammen. Dies junge Ding da hatte ja solch eignen Befehlston. War wahrscheinlich eine Dame vom Lande, eine Gutsbesitzerstochter, oder kam zum Besuch auf ein Gut in der Nachbarschaft? Man konnte nicht wissen.
„Jawohl, das kann schon angehen,“ sagte er noch einmal und begann sehr gemessenen Schritts durch den Flur und dann eine schmale Holztreppe voranzugehen. Im ersten Stock öffnete er eine Tür, ging in das Zimmer, strich ein Streichholz an und entzündete ein Licht. „So, meine Damens, Nummer vier. Wenn’s so recht ist.“
„Ja – nur muss gleich tüchtig geheizt werden.“
„Das kann wohl angehen. Wenn die Damens noch was essen woll’n, komm’n sie wohl herunter.“
Er ging immer noch nicht. Er schien zu überlegen. Dann holte er endlich aus der Brusttasche ein Papierblatt und einen kurzen Bleistift heraus. „Die Anmeldung – “
Bei dem trüben Licht der Kerze schrieb Dorothea eiligst ihren Namen: „Fräulein Linden und Begleitung.“ Einen Moment zögerte sie. Da wurde auf dem vorgedruckten Zettel auch nach dem Stand gefragt. Also: „Schauspielerin.“ Es war ihr ganz eigen zumute, als sie es hinschrieb – zum ersten Male.
Der Herr des „Schwarzen Raben“ musste sehr neugierig sein. Er las in aller Gemütsruhe.
„Ach, Sie sind von den Speelers!“ meinte er dann. Es klang interessiert, aber auch ein wenig verächtlich, und Dorothea glaubte etwas wie einen Seitenblick auf das Gepäck zu bemerken, das inzwischen mit vielem Geräusch erschienen war. Jedenfalls hatten die beiden stattlichen Koffer eine beruhigende Wirkung. Der „Schwarze Rabe“ nickte gnädig, mit einem wohlwollenden Lächeln sogar, breitete seine Fittiche und verschwand, nachdem er noch einmal versichert hatte, es würde sofort tüchtig geheizt werden.
Über Dorothea kam plötzlich, als sie mit Minna allein war, etwas wie eine totale Ermüdung. War’s eine Folge der langen Fahrt, war’s der unfreundliche Empfang? Sie wusste es selbst nicht. Hilflos ließ sie sich auf den nächsten Stuhl sinken. Es fehlte nicht viel, und die Tränen wären ihr in die Augen geschossen.
Aber da sah sie auf Minna. Sah, wie die schon im Zimmer umherräumte, wie sie schon die Betten einer Prüfung unterwarf, schon einen Koffer geöffnet hatte und ein Paar warme Schuhe herausnahm –
Und sie straffte sich: Nur nicht mutlos werden! Nur den Kopf hochhalten!
Sie sprang auf. „Nun wollen wir es uns aber gemütlich machen, Minna! Alte, gute, liebe Minna! Ein paar Tage werden wir doch hier im ‚Schwarzen Raben‘ logieren müssen. Übrigens – das Zimmer ist gar nicht so unübel – “
Minna bückte sich noch tiefer über den Koffer. „Wenn’s nur nicht zu teuer ist, gnä‘ Fräulein,“ sagte sie mit ihrem unverwüstlichen Phlegma.
„Wenn’s nur nicht zu teuer ist – “ Das sagte sie jetzt immer. Zwanzigmal am Tage. Denn sie führte die Kasse und rechnete sich immer wieder vor: Fünfundsiebzig Mark monatlich! –
Eine Stunde später ging Dorothea nach unten. Es war inzwischen im Zimmer wirklich nicht so „unübel“ geworden; der Hausdiener hatte tüchtig eingekachelt, der Ofen sprühte, und Minna hatte dem großen Zimmer einen Anstrich der Behaglichkeit gegeben. Die Welt sah mit einem Male für Dorothea wieder sonniger aus. Und gerade darum hatte sie Hunger, wirklichen Hunger. Den hatte Minna auch; aber Minna weigerte sich, mit ihrem „gnä‘ Fräulein“ hinunter in das Restaurationszimmer zu gehen. Einmal hielt sie das nicht für recht passend, denn trotzdem sie von der einstigen Dienerin zur „Begleitung“ avanciert war, wollte sie ihre richtige Stellung von früher immer gewahrt wissen; und dann lebte in ihr ein Abscheu vor den teuren, dünnen Restaurationsbrötchen mit den noch dünneren Schinkenscheibchen darauf; die unergründlichen Tiefen des Handgepäcks bargen bessere Schätze, die sie noch aus der Heimat mit führten.
Als Dorothea in die Gaststube eintrat, gereute sie’s fast. Dichter Tabaksqualm schlug ihr entgegen. Am liebsten wäre sie umgekehrt und zu Minnas Buttertopf zurückgeflüchtet. Doch da stand schon der „Schwarze Rabe“ in höchsteigener Person und komplimentierte sie zu einem kleinen Tisch in der Ecke, versicherte, dass die Schnitzel vorzüglich und das Bier ganz frisch angesteckt wäre.
Nicht rechts noch links hatte sie gesehen. Nun sie aber saß, ließ sie die Blicke doch vorsichtig umherschweifen, freilich nur, um sie gleich wieder auf einen großen grauen Fleck auf dem Tischtuch zu konzentrieren. Denn sie war von allen Seiten neugierigen Männeraugen begegnet, die sie alle anstarrten wie ein Tier im Zoologischen Garten; und überall hatten sich die Männerhäupter, alte und junge, zueinander geneigt; sie fühlte förmlich, wie man über sie tuschelte: „Das soll wohl die Neue von die Speelers sein?“
Es war eine ganz impertinente Empfindung, die ihr das Blut in die Wangen trieb.
Aber dann kam das Schnitzel; und alles, was wahr ist, es machte dem „Schwarzen Raben“ Ehre, und Dorothea erwies ihm auch Ehre. Sogar vom Bier nippte sie. Und wieder kam ihr die Welt sonniger vor. Das war ja nun nicht anders! Wenn Rosa Poppe in Berlin in das Restaurant Adlon getreten wäre, hätten sich sicher auch aller Augen auf sie gerichtet, und die Männerhäupter, alte und junge, hätten sich auch tuschelnd zueinander gebeugt. Mochten die Neumöller ihr Vergnügen auch haben. Man musste sich daran gewöhnen. Man musste sich ja voraussichtlich noch an vieles gewöhnen – an sehr vieles! Unwillkürlich schossen Dorothea wieder ein paar Worte von Edgar Maurer durch den Sinn: „Mein gnädiges Fräulein, lassen Sie sich durch nichts überraschen, durch nichts verblüffen, lassen Sie sich aber auch nichts gefallen und wahren Sie sich immer den Humor. Denken Sie stets daran, was für uns vom Bau besonders gilt, dass das ganze Leben auch nur eine einzige große Komödie ist – gerade wie auf den Brettern, die die Welt bedeuten.“
Am andern Morgen schien die Sonne ins Hotelzimmer. Dorothea hatte vorzüglich geschlafen, wie eben solch junger Mensch nach einem anstrengenden Reisetag schläft. Sie sprang auf und lief zum Fenster: Wahrhaftig, die Sonne leuchtete strahlend über den weißen Schnee, der sich über den ganzen Marktplatz in unberührter Reinheit breitete, die Dächer krönte und die Gesimse der netten, niedrigen Häuser. Die Bäume zu beiden Seiten des Platzes waren wie versilbert vom Rauhreif, und darunter tummelten sich ein paar fröhliche Buben mit Pelzkappen über den blonden Haaren auf einer langen Schlittenbahn. Ein herrlicher Wintermorgen! Alles sah so freundlich, so hell, leuchtend hell aus. Vielleicht war Neumöller so unübel nicht!
Die fröhliche Stimmung hielt an. Sie trotzte sogar Minna, die sich mit der Hotelakkuratesse oder vielmehr dem Mangel an Akkuratesse so wenig anfreunden konnte wie mit dem Kaffee des „Schwarzen Raben“. Sie hielt sogar an, als Minna ihre Hornbrille und das Wirtschaftsbuch herauskramte, um mit ihren wenig schönen, aber desto zuverlässigeren Zahlen die Reisekosten einzutragen. „Nur heut‘ nicht stöhnen, Minna – liebste Minna, nur heut‘ nicht! Es kommt ja doch alles, wie es kommen muss, und du wirst sehen, es kommt alles besser als du denkst!“
Die gute Stimmung hielt an bis zur Mittagsstunde, bis Dorothea sich anschickte, den Gang zum Direktor zu machen, um sich vorzustellen. Da sank ihr das Herz ein wenig, aber sie schraubte es gleich wieder , förmlich gewaltsam, in die Höhe. „Auf nach Balencia!“
Der Weg nach dem Heim des Direktors war nicht weit, nur „um die Ecke“. Hier in Neumöller lag wahrscheinlich alles nur „um die Ecke“.
Aber der Herr Direktor war nicht zu Hause. Dafür empfing sie die Frau Direktor, das heißt, sie öffnete Dorothea selbst die Flurtür.
„Fräulein Linden? Nur herein in die gute Stube. Der Direktor ist im Schützenhaus. Aber ich freue mich, Sie zu sehen. Bitte, hier – hier – “
Eine große, starke Frau war’s. Der „Grenadier“, hatte Edgar Maurer erzählt, hieß sie bei der Truppe. Der „Grenadier“ oder „die Alte“. „Stellen Sie sich gut mit dem Grenadier, gnädiges Fräulein. Sie hat nicht nur das Kassenwesen unter sich, sie regiert überhaupt.“
Der Grenadier hatte eine mächtige Stimme. Es dröhnte in den kleinen Zimmer, wenn sie sprach. „Ein Wagnis mit Ihnen, Fräulein Linden, ein Wagnis vom Direktor. Ich weiß alles, vollständige Anfängerin – ja! Aber von unserm großen Edgar Maurer so warm empfohlen. Und wie sagt doch Raupach in ‚Kaiser Friedrichs Tod‘? ‚Wer niemals wagt, vollbringt kein Meisterstück!‘ So, bitte, hier setzen Sie sich. Verzeihen Sie, wenn ich weiter arbeite. ‚Eine Arbeit, die uns Vergnügen macht, heilt ihre Mühe‘, heißt’s beim großen Kollegen Shakespeare. Na, ja – Vergnügen ist’s freilich nicht immer – “ Und sie lachte auch wieder, dass das Zimmer dröhnte.
Aber diese gewaltige Frau, fand Dorothea, hatte ein gutes Gesicht, matronenhaft zerfurcht und doch mit den Spuren einstiger Schönheit. Und sie hatte fast zierliche Hände, denen man die fleißige Arbeit kaum ansah.
Ein großer Haufen von Kleidungsstücken lag vor ihr auf dem Fußboden. Mäntel, Theatergarderobe, alter Tand, den sie stopfte und flickte. Es musste eine Sisyphusarbeit sein. Dabei stand ihr Mund nicht still, und was sie sprach, war wohlwollend und hatte Hand und Fuß, wenn es auch oft komisch klang.
„Über die Komödie wird der Direktor mit Ihnen sprechen. Mulier taceat in ecclesia – das Weib soll sich um das Geschäftliche nicht scheren. Ja, wenn das so ginge. Wo’s geht, sprech‘ ich wirklich nicht mit, wenn die guten Herren und Damen auch oft das Gegenteil behaupten. Aber um das allgemein Menschliche muss ich mich schon kümmern. Wo wohnen Sie? Im ‚Schwarzen Raben‘. Ja, Fräulein Linden, das wird Ihnen doch auf die Dauer zu teuer werden. Das liebe Geld! ‚Was, wenn ich’s hab‘, mir so überflüssig, und hab ich’s nicht, so unentbehrlich scheint,‘ wie der weise Nathan spricht. Sie müssen sich ein Privatquartier suchen. Warten Sie mal, ich hab‘ noch ein paar Adressen, die besten Zimmer sind freilich schon fort.“
Die Frau Direktor schleuderte die Landsknechtspluderhose, an der sie gearbeitet hatte, zu ihren Genossen und suchte nach ihrem Notizbuch. – „Hier, Frau Malermeister Thomser, Breite Straße 54. Das wird am Ende was für Sie sein. Können Sie sich die Adresse merken?“
„Ich habe ein gutes Gedächtnis, Frau Direktor.“
„So! So! Na, das werden Sie brauchen können. Denn wissen Sie, Fräulein Linden, hier bei uns gilt’s, Rollen lernen! Unser Publikum verlangt alle Neuheiten. Das Repertoire kann gar nicht abwechselnd genug sein. Die Kleinstädter sind noch toller wie die Großstädter, sie denken auch, was der verrückte Grabbe im ‚Don Juan‘ und ‚Faust‘ sagt – was sagt er doch gleich? – : ‚Nur Abwechslung gibt dem Leben Reiz und läst uns seine Unerträglichkeiten vergessen.‘ Immer will das Publikum was Neues – ‚Verleg‘ Sie sich auf Neuigkeiten! Nur Neuigkeiten ziehn uns an,‘ heißt’s im ‚Faust‘ – dem von Goethe – und so heißt’s auch bei uns. Ja – das Repertoire macht Ansprüche hier – auch an die Toilette der Damen.“ Das letzte begleitete ein etwas forschender Blick.
„Ich bin so leidlich gerüstet – “
„Na, das ist schön. ‚Die Kleidung kostbar, wie’s dein Beutel kann, doch nicht ins Grillenhafte; reich, nicht bunt; denn es verkündigt oft die Tracht den– ‚ Shakespeare sagt, ‚den Mann‘, aber es passt auch, passt erst recht auf ‚die Frau‘. So – und nun gehen Sie nur nach dem Schützenhaus und suchen Sie sich den Direktor auf. Sie müssen entschuldigen, ich muss nämlich auch an das Mittagessen denken, denn der Direktor denkt auch, wie’s im Götz heißt: ‚Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neu geboren.“
Dorothea machte sich auf den Weg, um den Theaterdirektor aufzusuchen. Ihr schwante schon: Im Schützenhaus befand sich das Theater. Der Weg schien ziemlich weit. Sie musste sich mehrfach zurecht fragen; es lag hier doch wohl nicht alles „um die Ecke“. Das Schützenhaus lag sogar vor dem Tor. Und die getretene Bahn hörte bald auf, Dorothea musste das Kleid ordentlich raffen; ein Glück, dass ihr Minna fürsorglich die Gummigaloschen übergezogen hatte. — Aber das tat ja nichts. Im Gegenteil, der tiefe Schnee hatte seine Reize. Und die Luft war so frisch und erquickend. Dorothea lächelte vor sich hin. Wenn alle so waren wie die zitatenreiche Frau Direktor, so musste sich’s mit den Leuten leben lassen. Das war ja in ihrer Art eine geradezu prächtige Frau. Resolut und tatkräftig, und das Herz auf dem rechten Fleck!
Hatte der Schulbub, den sie zuletzt nach dem Schützenhaus gefragt, nicht gemeint: „Gleich rechts!“ — Wahrscheinlich das große Gebäude dort. Hm — leidlich stattlich, aber schön ist anders. Die reine Kaserne! Viel Geschmack hatte der Neumöller Architekt nicht entwickelt. — Im eiskalten Korridor lungerte ein Arbeiter herum. „Wo treffe ich den Herrn Direktor?“
„Von de Speelers? Da müssen Sie hintenherum. Vorne is allens geschlossen.“
Also noch einmal durch den Schnee. Und dann ein vergebliches Pochen an drei, vier Türen, bis Dorothea endlich die Klinke der fünften Tür entschlossen, ohne zu klopfen, aufdrückte.
Wahrhaftig — der Theatersaal!
Dorothea sah geradeaus auf die Bühne.
Der Vorhang war nur zu dreiviertel aufgezogen. Dämmerlicht füllte den leeren Raum. Dort oben aber stand, agierte, sprach eine kleine Gruppe Menschen. Was sie sprachen, was sie agierten, konnte Dorothea zunächst nicht erkennen. Der und jener sprach laut, der und dieser murmelte nur — er „markierte“ seine Rolle, wie es in der Theatersprache heißt. Die Leutchen trugen Straßenkleidung. Aber es musste doch wohl ein Kostümstück sein, denn es war von einem Omar die Rede und von einer Krone. Dann wusste sie’s mit einem Male —
„Nie war dein Haupt so würdig, sie zu tragen,
Als jetzt, da sich zum ersten Male
Die Kraft des Talismans in dir bewährte.“
Probe also zu Fuldas „Talisman“ war’s, zu der sie hinzugekommen. Ganz vorn, dicht neben dem Souffleurkasten, stand ein schlanker, sehr großer Mann. Das Gesicht konnte Dorothea nicht sehen, denn er drehte dem Zuschauerraum den Rücken zu. Aber er musste die Regie leiten. Dann und wann unterbrach er das Spiel. Auch jetzt wieder. Er schien sehr ungnädig.
„Herr Swarte, Sie befinden sich im Rahmen eines anständigen Ensembles. Mit solch einem Jammerlappen von Omar dürfen Sie mir nicht kommen. Das wird ja von Akt zu Akt schwächer — keine Auffassung — keine Spur von Auffassung! Und gelernt haben Sie Ihre Rolle auch nicht —“
Der große Mann hatte den Hut auf wallenden Silberlocken und paffte zwischen den einzelnen Sätzen an einer Zigarre. Dorothea sah’s an den Rauchwölklein, die in regelmäßigen Intervallen emporstiegen. Vor ihm stand, ziemlich eingeschüchtert, ein schlanker Jüngling. „Ich habe die Rolle aber doch gestern früh erst bekommen, Herr Direktor“, entschuldigte er sich kleinlaut. „Das bitte ich zu berücksichtigen.“ „Gar nichts ist zu berücksichtigen. Sie hatten den Omar ja angeblich auf Ihrem Repertoire. Ha! Repertoire! Wenn diese jungen Herren ihr Repertoire einreichen, dann steht eben alles Mögliche und noch einiges darauf. Papier ist ja geduldig. Und dann wird drauflos verzapft, dass es eine Schande ist. Da kennen Sie aber den alten Neesemann schlecht, Herr Swarte. Schwimmen gibt’s bei mir nicht, auf den Kastengeist da unten dürfen Sie bei uns nicht bauen. Beim großen Zeus: lernen heißt es — lernen — lernen — bis aufs Tippelchen! Weiter —“
Das Spiel begann wieder.
Dorothea schwirrte es im Kopf. Alles hatte sie von dem etwas einseitig geführten Zwiegespräch nicht verstanden. „Schwimmen“ — das war wohl ein Kunstausdruck für jemand, der nicht recht gelernt hat und sich auf den Souffleur allzu stark verlässt. Und dieser war wahrscheinlich unter dem „Kastengeist“ zu verstehen. Eins aber war ihr klar: Grob konnte Herr Direktor Neesemann sein. Und ein ganz reines Gewissen hatte sie auch nicht. Auch sie hatte auf dem eingesandten Repertoireverzeichnis eine Anzahl Rollen als studiert angegeben, die sie keineswegs beherrschte. Dazu hatte ihr freilich kein andrer als Edgar Maurer geraten, mit lachenden Lippen: „Das ist nun einmal allgemeiner Brauch!“
Da sprach der Omar dort oben: „Der Mut der Wahrheit ist der Talisman!“ Er sagte „Talisman“ und er machte dabei eine höchst merkwürdige Bewegung mit dem rechten Arm — aber das Wort hatte trotzdem seine starke Wirkung. Mindestens auf Dorothea. Am liebsten wäre sie ganz leise aus dem Theatersaal herausgeschlichen. Stand doch gerade die Rita auch auf ihrem Repertoire.
Plötzlich drehte sich der Direktor um. Es schien, als wollte er seinem Omar die grade eben verunglückte Geste vormachen, aber er ließ den schon erhobenen rechten Arm sinken, hob die linke Hand vor die Augen gleich einem Schirm und schnaubte in den Zuschauerraum herunter: „Wer kraucht denn in drei Deubels Namen wieder mal dort unten herum? Ich hab‘ doch hundertmal verboten, dass jemand in die Probe kommt! Da soll doch gleich —“
Jetzt galt es —
Dorothea fasste sich ein Herz, tat ein paar Schritte den Mittelgang hinunter und sagte: „Ich suchte Sie, Herr Direktor, und fand niemand, der mich zurechtwies — Dorothea Linden —“ Herr Neesemann antwortete nicht sofort. Er schien noch ein paar Sekunden lang das junge Mädchen unter dem Schutz seiner linken Hand zu mustern. Dann brummte er, verhältnismäßig gnädig: „Na, Fräulein Linden, da sind Sie gerade zu ’ner netten Komödie zurechtgekommen. Wir sind übrigens gleich fertig. Wollen Sie mich, bitte, in meinem Bureau erwarten. Draußen, dritte Türe links —“
Das „Bureau“ war ein winziges Zimmerchen, in dem eine unglaubliche Unordnung herrschte. In den Ecken lagen hochaufgetürmt die verschiedensten Requisiten, vom Schwert des Brutus bis zur Armbrust des Tell; Speere und Schilde, alte, rostige Pistolen, Papierrollen, schweinslederne Bände, ein Schachbrett, ein Eselskopf. An den Wänden lehnten Versatzstücke, die sich in der Ausbesserung zu befinden schienen; vielleicht malte der Herr Direktor in den Mußestunden, wenigstens prunkten ein paar große Farbentöpfe nebenbei auf dem Fußboden. Am Fenster stand ein Schreibtisch, dicht bedeckt mit Büchern, ausgeschriebenen Rollen und einem wirren Haufen von Briefen. Auch zwei Stühle gab es. Aber auf dem einen ruhte eine Königskrone, und auf dem zweiten stand ein höchst merkwürdiges Ding. Es war ohne Zweifel ein alter Blumentopf, mit buntem Papier beklebt. Er stand umgedreht, mit der Öffnung auf dem Stuhl; oben durch die kleinere Öffnung ragte eine dünne Holzstange hervor, und auf der stak eine große geschälte Kartoffel, die ganz grobkörnig zu einer Art von Menschenkopf zurechtgeschnitten schien, den drei kleine, bunte Hühnerfedern krönten.
Dorothea zog es vor, sich nicht zu setzen. Sie brauchte auch nicht lange zu warten, denn Herr Neesemann erschien sehr bald. Er schüttelte ihr kordial die Hand. „Willkommen im Grünen, Fräulein Linden. Den Namen ,Linden‘ haben Sie sich ja wohl als Bühnennamen erwählt. Früher hätte man eine Linderini vorgezogen. Aber Linden ist auch schön. Also nochmals, willkommen im Grünen, Fräulein Linden. Wenn’s jetzt draußen auch Schnee ist — grün ist ja die Farbe der Hoffnung, und wir beide hoffen doch wohl gegenseitig das Beste voneinander. Sie sind mir ja von meinem großen Schüler Edgar Maurer so warm empfohlen.“ Er paffte immer noch an seiner Zigarre und schien es auch nicht für nötig zu halten, deshalb um Entschuldigung zu bitten. „Mit Ihnen werd‘ ich gewiss nicht den Verdruss haben, wie mit diesem Herrn Swarte: Ist das ein Ignorant! Aber er geht, er geht — beim großen Zeus — er geht! Oder genauer genommen: er wird gegangen. Bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen? Ja so —“
Die Krone erhielt einen kleinen respektlosen Stoß mit der Fußspitze, so dass sie zur Erde polterte. Den Blumentopf aber fasste der Herr Direktor sorgsam mit beiden Händen und trug ihn zum Tisch am Fenster, wobei die Kartoffel rhythmisch hin und her pendelte. „Schön — nicht, Fräulein Linden? Ich seh’s an Ihrer allerliebsten Nasenspitze, Sie wissen gar nicht, was das ist. Das ist die Pagode, die in „Narciß“ auf dem Kamin von Doris Ouinault steht und dann zertrümmert wird. Man kann doch nicht jedesmal eine wirkliche Porzellanpagode anschaffen — na, da hilft man sich eben. Famos — was? Meine Erfindung —“
„Nun —“ sprach der Direktor weiter, „geschäftlich ist ja wohl zwischen uns alles klar? — Freut mich.“ Er zögerte ein wenig, fast als ob er auf irgendetwas, eine Frage, eine Bitte wartete. „Ja — morgen haben Sie noch einen freien Tag. Das heißt: um elf Uhr natürlich Probe. Warten Sie einmal“ — er kramte unter den Papieren auf dem Tisch und brachte endlich ein recht ansehnliches Heft zum Vorschein — „Hier, das ‚Rautendelein‘. Was — das ist doch mal nett von mir? So bin ich immer, wenn Ich nicht mal anders sein muss. Sie haben ja das ‚Rautendelein‘ auf Ihrem Repertoire — gehen Sie die Rolle gleich noch einmal ordentlich durch. Bitte, nehmen Sie sie gleich mit. So — und nun wollen wir gehen. Ich taxiere, draußen wartet so ziemlich das ganze Ensemble. Da kann ich Sie ja gleich bekannt machen —“
Es ging wie ein Mühlrad. Und Dorothea ging es auch wie ein Mühlrad im Kopfe herum. Kaum zwei Worte hatte sie gesprochen.
Dann, dicht vor der Tür, blieb Herr Direktor Neesemann noch einmal stehen. Er fasste Dorothea kordial am Ellbogen und sah ihr gerade ins Gesicht, bis ihr die dunkle Röte in die Wangen stieg. Da lachte er wohlwollend. »Sie brauchen nicht rot zu werden, wenn solch alter Mann sie mal ein bissel genau betrachtet. Ja — unser Edgar Maurer hat mir nicht zu viel geschrieben. Sie sind wirklich ein selten schönes Menschenkind! Und wenn der alte, vielgeschmähte Raupach sagt: ‚Die Schönheit bleibt im Kerker wie auf dem Throne immer Königin!‘, so gilt das erst recht für die Bühne. Allein tut sie es freilich nicht, Fräulein Linden. Die Hauptsache bleibt das Genie, der große Gottesfunke! Ja — oder doch mindestens das Talent, wenn es mit großem Fleiß verbunden ist. Ja — nun, wir werden ja sehen.“
Dorothea atmete tief aus, als sie die frische Winterluft einatmen konnte. Ihre Wangen glühten noch. Es war ja alles so freundlich gewesen, was der Direktor gesprochen halte, aber es kam alles wie aus einer fremden Welt. Und diese fremde Welt sollte nun ihre eigne werden! Draußen stand in der Tat eine kleine Gruppe Herren und Damen. Der unglückselige Herr Swarte war nicht darunter; man sah seine Silhouette mit dem tiefgebeugten Haupt noch auf der Chaussee, schon dicht an den ersten Häusern der Stadt. Der trug nun wohl auch Erwartungen und Hoffnungen zu Grabe. „Herrschaften — hier: Fräulein Dorothea Linden. Mir ganz besonders empfohlen von Seiner Exzellenz Herrn von Rakolski — Sie wissen, der Gemarer Intendant — und von meinem lieben Schüler und Freunde Edgar Maurer.“ Der Herr Direktor, der drinnen in dem kleinen Zimmer, zumal zuletzt, so menschlich natürlich gesprochen, hatte jetzt wieder einige großartige Gesten. „Hier — Herr Willibald Sickel, unser erster Held. Frau Bernhardine Rose — bei Frau Rose darf man ohne Zornesgluten zu wecken, sagen, unsre treffliche ‚komische Alte‘. — Fräulein Hanna Bargell, unsre Naive, vielleicht werden Sie sich bald einmal ins Gehege kommen, obwohl ich Rollenneid nicht dulde. Herr Kurt Baffer, Charakterspieler, Intrigant vom reinsten Wasser, und was er nie zugeben will, ein Komiker ersten Ranges. Und nun noch unsre liebe Frau Holder, unser getreuer ‚Kastengeist‘. Bauen Sie niemals aus diese Dame, Fräulein Linden. Nur das Bewusstsein darf in Ihnen sein, dass der Kasten nicht leer ist. Aber es ist kalt, Herrschaften, wir wollen uns in Trab setzen! Meine Alte wird sonst auch ungnädig.“ Allein war sie hinausgegangen zum Schützenhaus — nun wanderte Dorothea mitten in einem Trupp Kollegen zur Stadt zurück. „Kollegen!“ Wie das Wort sie berührte! Man hatte sich höchst freundschaftlich die Hände geschüttelt, man nahm die neue Kollegin gleichsam in die Mitte. Und sie gewann schon nach kurzer Zeit die Gewissheit: ein fröhliches Völkchen scheint das hier zu sein, das Völkchen der „Speelers“. Es fing sofort ein lebhaftes Plaudern an, ein Lachen und Kichern. Nur der Direktor wahrte etwas ernste Würde. Er schritt auch in seinem langen, freilich schon stark strapazierten Pelz an der Spitze; neben ihm die rundliche, komische Alte mit einem schier unglaublichen Hut auf dem grauen Kopfe. Links von Dorothea ging Herr Willibald Sickel, etwas ältlich schon für einen ersten Helden, aber stattlich und straff: nur dass das interessante Gesicht ganz eigen zerfurcht schien; rechts trippelte die Naive, ein hübsches, kleines Ding mit Quecksilberaugen. Und von rückwärts kamen die lustigen Stimmen des Charakterspielers, der zugleich Komiker sein sollte, und des „Kastengeistes“. Sie zankten sich beide scherzhaft: „Du sollst mir doch immer nur das erste Wort geben, Halderchen!“ — „Ja, aber wenn ich das zweite, dritte und alle folgenden nicht auch herausschreie, dann bleibst du eben stecken.“ — „In meinem ganzen, Leben blieb ich noch nicht stecken!“ — „Höre mal, Baffer, schon als wir vor zehn Jahren in Tilsit zusammen waren, hieß es allgemein: „Schlechter lernt niemand als Baffer!“ — „O, wie elend die Welt doch ist. Ein Hundefalle ist sie, und der bissigste Hund drinnen ist die Verleumdung!“
Dicht hinter den ersten Häusern trennte man sich wieder mit starkem Händeschütteln. Nur Herr Sickel blieb an Dorotheas Seite. Er war unter den Gesprächigen so ziemlich der Schweigsamste gewesen. Nun sagte er: „Sie sind im ‚Schwarzen Raben‘ abgestiegen Fräulein Linden ? Ich esse meistens dort. Wenn es Ihnen angenehm ist, könnten wir zusammen speisen. Wir werden ja doch wahrscheinlich viel zusammen zu tun haben.“ Es war Dorothea noch nicht aufgefallen, welch selten schönes Organ der Mann hatte. Wie ein voller, edler Metallton klang es darauf. Sie sah ihn, indem sie bejahte, interessierter an. Ein Charakterkopf, ohne Zweifel. Aber die Augen lagen seltsam tief und sie sah nun auch, wie eigen unordentlich der Herr Sickel gekleidet war. An dem Überzieher, der gewiss einst äußerst elegant gewesen, fehlten einige Knöpfe; der große Kalabreser schien seit Wochen keine Bürste gesehen zu haben; das dicke, blauseidende Halstuch war wüst umgeschlungen. Und trotzdem hatte das alles etwas Künstlerisches.
„Ich komme sofort wieder herunter, Herr — Kollege.“
Das „Kollege“ wollte noch gar nicht recht über die Lippen.
Und Herr Sickel lächelte. „Lassen wir es doch bei unserm ehrlichen Namen, Fräulein Linden, wie es in Ihren Kreisen Gebrauch ist.“ Fast etwas wie Mitleid tönte aus seinen Worten. Dorothea huschte heraus. Wenigstens ein gutes Wort sollte die arme Minna abbekommen, und für ihr leibliches Wohl musste doch auch gesorgt werden. Aber die alte „arme“ Minna schien gar nicht so armselig gestimmt. Sie stand inmitten der ausgepackten Koffer, hatte im schön geheizten Zimmer eine prächtige Ordnung hergestellt und aus dem Tisch prunkten die Reste ihrer scheinbar unergründlichen Wegzehrung. Nur von tiefstem Mitleid für ihr „gnä‘ Fräulein“ war sie ganz erfüllt. „Es war wohl grässlich?“ fragte sie. Und als Dorothea das Gegenteil versicherte, schüttelte sie missbilligend den grauen Kopf. Und dass das „gnä‘ Fräulein“ unten mit einer fremden Mannsperson allein essen wollte, schien sie erst gar nicht zu verstehen. Es sei doch ein Kollege, wagte Dorothea entschuldigend einzuwenden. Aber Minna wiederholte nur: „’n Kollege —“, und zwar dehnte sie das Wort so verächtlich und zog dabei die Achseln so hoch, dass das „gnä‘ Fräulein“ beinah gelacht hätte, obwohl ihr im Grunde auch nicht zum Lachen zumute war.
Unten saß Herr Sickel schon wartend an einem der kleinen Tische im allgemeinen Speisezimmer. Auf das Kuvert gegenüber hatte er eine rote Nelke gelegt — erstaunlich genug, wie und wo er die in der Schnelligkeit aufgetrieben haben mochte. Aber es war doch nett von ihm. Überhaupt: Dorothea fand ihn überraschend „annehmbar“, wie sie wohl früher gesagt haben würde. Er zeigte Manieren, hatte gewiss eine gute Kinderstube genossen, war unterhaltsam und chevaleresk. Und so vieles was er plauderte, war für die Novize überaus interessant.
Der Direktor? Ein Ehrenmann. Versteht sein Geschäft und hat darüber hinaus wirkliches Interesse für die Kunst. Zuviel vielleicht, sonst beackerte er nicht Neumöller, Herte und Tenburg, sondern leitete längst irgendwo ein größeres Stadttheater. Aber er hatte eine Vorliebe für das Klassische, und das erforderte immer Opfer. Am besten zog doch die leichteste, die seichteste Ware — hier und überall.
Dorothea berichtete kurz und vorsichtig über ihren Empfang, auch dass es ihr vorgekommen wäre, als ob Herr Neesemann auf irgendeine Frage, ein Anliegen ihrerseits gewartet hätte. Da schüttelte Herr Sickel den Kopf. „Ja. Fräulein Linden, haben Sie denn, die große Frage, die Frage aller Fragen, nicht gestellt?“ Er sah wohl, dass er nicht verstanden wurde. „Aber wirklich, Sie gehören ins naive Fach — ich meine natürlich die Frage, die jeder Neuankömmling zuerst stellt: die Bitte um Vorschuss.“ Und sie lachten beide.
Die Frau Direktor? Der lange Grenadier? Brav, etwas stark philisterhaft trotz ihres Zitatenreichtums. Aus den aller kleinsten Verhältnissen, und eigentlich wohl auch ein Hemmschuh für das Vorwärtskommen Neesemanns. „Bei uns, Fräulein Linden, gilt es, was fast überall gilt: die Frau kann dem Manne unendlich nützen, sie kann aber auch wie ein Ballast auf ihn wirken und leider ist dieser Fall namentlich in der Kunst der häufigere.“ Er brach jetzt ab, um dann doch schroff hinzuzusetzen: „Die Schauspielerehe ist ein Thema für sich, an dem man — an dem wir hier lieber nicht rühren wollen.“
„Die Komödie selber? Schlecht und recht; immerhin besser als der Durchschnitt. Wenn der gute Neesemann sich in die Brust wirft — er tut das gern — und erklärt: ‚Wir sind doch keine Meerschweinchen!‘ dann hat er gewiss recht. Ach, du lieber Gott! Meerschweinchen heißen die Kleinen der Kleinsten, die von Dorf zu Dorf ziehen, aus der Hand in den Mund leben. Nein! Den Ausdruck können wir uns mit Recht verbitten. Vielleicht“ — es klang etwas bitter, wie Sickel das sagte — „vielleicht sind wir auch keine Schmiere. Dazu ist Neesemann zu solid und hat, ich sagte es schon, seine eignen künstlerischen Instinkte. Aber trotzdem ist alles so klein — so klein — so klein.“
„Das Publikum?“
„Ein großes Kind, wie schließlich überall. Heute kindlich dankbar, morgen kindisch launisch. Spottwenig Verständnis im großen und ganzen, und die groben Instinkte der Masse. Immerhin selten so grausam, wie das überfütterte und überbildete Großstadtpublikum —“ Es hörte sich Sickel gut zu. Er sprach lebendig, in packenden Bildern, und dann musste Dorothea immer aufs neue sein wundervolles, seltsam modulationsfähiges Organ bewundern. Wie herrlich mochte das im großen Raume tönen! Und noch eins fiel ihr auf: welch wunderschöne Hände der Mann besaß. Schmal und doch nervig, klein fast wie eine Frauenhand und doch durchaus männlichen Charakters und auf das sorgsamste gepflegt. Das einzig Gepflegte beinahe an der ganzen Erscheinung. Als ob er sie hinübergerettet hätte aus einer besseren Vergangenheit in die trübe Gegenwart. Er gebrauchte diese wunderschönen Hände beim Essen mit einer gewissen Koketterie.
Beim Essen? Eigentlich berührte er die Speisen ja kaum. Er trank auch nichts. Ein Glas Wasser stand vor ihm. Dorothea empfand es sehr angenehm, dass er mit keinem Wort nach ihrer Vergangenheit fragte, wie er denn auch von der seinen nicht sprach. Ein einziges Mal fiel ein Wort, dass sie stutzen machte: „Als ich in Wien debütierte —“, aber er sprang sofort vom Thema ab und fuhr fast spöttisch fort: „Wien oder Posemuckel — es ist ja ganz gleichgültig.“ „Hat Ihnen der Alte — Pardon, ich meine natürlich den Direktor; man kommt doch unwillkürlich immer wieder in unser Rotwelsch — hat Ihnen der Direktor schon eine Rolle zuerteilt, wenn ich fragen darf?“ Sie berichtete, und mit einigem Zögern gestand sie, dass sie des Rautendeleins doch nicht ganz sicher sei — und morgen solle Probe sein. Da lächelte er gutmütig: „Sorgen Sie sich nicht allzu sehr, Fräulein Linden. Ich werde als Meister Heinrich schon helfen, wo ich kann, und unser kleiner ‚Kastengeist‘ ist vortrefflich. Sie haben ja auch noch einen halben Tag vor sich — und eine ganze Nacht. Solch junges Gedächtnis ist so über alle Maßen aufnahmefähig — zumal wenn die Not drängt.“
Es war eine angenehme Stunde gewesen, fand Dorothea nachher. Angenehmer jedenfalls, als die des Verhandelns mit Frau Malermeister Thomson, Breite Straße 54. An den beiden kleinen Zimmerchen war zwar nicht viel auszusetzen und der Preis erschien spottbillig. Aber die Frau Meisterin wollte von den Speelers nicht viel wissen, und sie musterte Dorothea immer wieder, als ob sie am wenigsten gern eine schöne Schauspielerin im Hause hätte. Bis Minna in die Erscheinung trat und ein kräftiges Wort deutsch sprach. Da war die Verständigung bald hergestellt. Minna besorgte auch den Umzug. Während Dorothea in einer Ecke auf einem wackligen Stuhl kauerte und lernte — lernte, dass ihr der Kopf brannte.
„Du Sumserin von Gold, wo kommst du her?
Du Zuckerschlüferin, Wachsmacherlein!
Du Sonnenvögelchen, bedräng‘ mich nicht!
Geh! Lass mich! Strählen muss ich mir
Mit meiner Muhme güldnem Kamm das Haar —“
Am Abend ging sie, trotz alles Memoriereifers, in die Komödie. An der Kasse saß die Frau Direktorin und nickte ihr freundlich zu. „Hab’s mir doch gedacht! ,Er ist neugierig wie ein Fisch‘, sagt Goethe im Faust. Hab’s nie begriffen, dass die Fische so neugierig sein sollen. Aber dass Sie’s sein würden, das wusste ich.“ Man gab den „Talisman“. Aber Herr Swarte mimte nicht mit, Sickel musste in letzter Stunde für ihn einspringen. Er kann ja nicht jung genug sein für den Omar, dachte Dorothea zuerst.
Doch bald sah sie, zum ersten Male eigentlich wie eine gute Bühnenmaske über dir Jahre hinwegzutäuschen vermag. Dann nahm sie wieder die Wunderpracht dieses modulationsfähigen Organs in Bann; wie Perlen an einer Schnur rollten die schönen, klingenden Verse. Es war ein Genuss, aufzuhorchen und immer wieder aufzuhorchen. Allmählich aber trat ihr über das Äußerliche hinaus die Gestaltungskraft des Schauspielers ins Bewusstsein, des Schauspielers, der eine Märchenfigur so völlig mit wirklichem Leben zu durchdringen verstand, dass man an sie glauben konnte, an sie glauben musste, fast wie der ganze Hof des König- Aftolf von Zypern an das von Omar gewebte Zauberkleid glaubte, das doch, in Wirklichkeit gar nicht existierte. Turmhoch ragte Sickel über alle übrigen Mitwirkenden empor, das fühlte Dorothea. Die andern dort oben waren im besten Falle leidlich gut eingespielte Komödianten. Er allein war in Wahrheit ein Künstler. Und wie ihr, so mochte es dem ganzen Publikum gehen, das sich ziemlich zahlreich eingefunden hatte: es vergaß über dieser einen Gestalt das Mindermaß der andern, vergaß die dürftige Ausstattung, die etwas armseligen Kostüme, die wunderlich zusammengesuchten Kulissen, die spärliche Beleuchtung. Es jubelte dem Omar und immer nur dem Omar zu.
Und Dorothea wieder vergaß über dieser einen großen künstlerischen Leistung dies harmlose Publikum, das in den Pausen seine Butterbrote auswickelte und Apfelsinen schälte. — Einsam ging Dorothea durch dichtes Schneegestöber nach Hause, immer nur den einen Gedanken im Sinne: Wie kommt dieser große Künstler hierher? Und als sie dann an der kleinen Lampe wieder über ihrer Rolle saß, dem Sinn der Worte nachsann und diese immer wieder aufs neue wog und wiederholte, da schob sich der andre Gedanke und der heiße Wunsch dazwischen: Sei ihm morgen nicht ganz unebenbürtig!
Bis tief in die Nacht saß sie. Und nach kurzem, unruhigem Schlaf, im grauenden Morgen stand sie wieder auf, bereitete sich selber eine Tasse starken Kaffee — so stark ihn die Maschine nur hergeben wollte — und begann aufs neue zu lernen. Dann kam Minna. Aber sie erfuhr nur ein kurzes „Lass mich!“ „Bitte störe mich nicht!“ Kopfschüttelnd verkroch sich die Alte wieder. Mit ihrer braunen Bunzlauer Kaffeekanne saß sie stumm in einer Ecke des Zimmers und sah, wie ihre junge Herrin bald still vor sich hinlas, bald aufsprang, um ein paar Tanzbewegungen auszuführen, bald vor dem Spiegel über der birkenen Kommode ihr schönes Gesicht in seltsame Erregungen zu steigern wusste. „Eine komische Welt — eine komische Welt —“ dachte sie wohl, „unser gnä‘ Fräulein macht mich Angst und bange.“
Dorothea hatte die kleine goldene Uhr, das Erbteil der Mutter, vor sich neben der Rolle liegen. Dann und wann sah sie auf das Ziffernblatt. Wie schnell der Zeiger sich drehte, wie die Zeit rann! Bisweilen schüttelte es sie wie ein Fieberanfall. Die Augen schmerzten, die Schläfen brannten. Die heiße Sorge kam: Wie sollst du dieser Rolle Herr werden? Sie hatte früher wohl schon den einen oder andern Teil in sich aufgenommen, geistig zu verarbeiten gesucht, aber überall fehlten die Verbindungsglieder. Manchmal war sie nahe daran, zu verzweifeln; auch daran zu verzweifeln, dass ihr Gedächtnis hinreiche, rein mechanisch die Worte festzuhalten. Dann wieder kam neues Hoffen. Sie versuchte, laut zu sprechen:
„Durchs Gebirge flog ich,
Bald wie ein Spinngeweb‘ im Winde treibend,
Bald wie ’ne Hummel schießend, taumelnd dann
Von Kelch zu Kelche wie ein Schmetterling.
Und jedem Pflänzlein, Blümchen, Gras und Moos,
Pechnelke, Anemone, Glockenblume,
Kurz allen nehm‘ ich Eid und Schwüre ab:
Sie mussten schwören, dir nichts anzutun —“
Es ging! Wahrhaftig, es ging!
Sie hätte jubeln mögen. Aber gleich kam wieder die Enttäuschung. Es glückte ihr der Klang nicht, den sie in die Worte hinein zu schmelzen strebte:
„— Du bist gefeit — ich sag‘ es dir: gefeit.
Und nun: wink‘ mit dem Auge, nicke nur —
Und weiche Klänge quellen auf wie Rauch,
Umgeben dich gleich einer kling’nden Mauer,
Dass weder Menschenruf noch Glockenschall,
Noch Lokis tück’sche Künste sie durchdringen —-
Zehn Uhr! Elf Uhr!
Schließlich kam es wie eine finstere Entschlossenheit über Dorothea — eine Entschlossenheit, der die Verzweiflung beigemischt war. Sie schloss die Rolle. Und mit düsterem Antlitz ging sie zu ihrer ersten Probe.
DRITTES KAPITEL
Das Personal war zur Theaterprobe vollständig versammelt. Selbst der „junge Mann“, Herr Swarte, der wieder in Gnaden aufgenommen war, hatte irgendeine kleine Rolle erhalten und stand mit gesenktem Kopf bescheiden beiseite. — Dorothea fühlte, wie aller Augen auf sie gerichtet waren. Vorn, neben dem Souffleurkasten, hatte der Direktor Posto gefasst (Platz genommen), mit der Zigarre zwischen den Zähnen und dem riesigen Kalabreser auf dem Haupt. Hinter dem Versatzstück, das den Brunnen vorstellte, kauerte der Nickelmann, der dicke Baffer, bereit, „aus der Tiefe“ herauf zu tauchen. Neben dem Direktor stand der kleine Regietisch. Das Inspizientenbuch lag darauf, eine Klingel daneben. Jetzt klopfte Direktor Neesemann in die Hände; dann griff er zur Klingel.
Noch einmal sank Dorothea das Herz — tief und immer tiefer. Aufschreien hätte sie mögen! Mit schrecklicher Klarheit stand ihr plötzlich vor dem Sinn, welch blutjunge Anfängerin sie war, dass sie nichts konnte, nichts mitbrachte als ehrlichen Willen und hohe Begeisterung.
Mit einem Male fühlte sie sich wieder so ganz fremd und verlassen, empfand jäh, fast abstoßend diese eigenartige Welt um sich her, den seltsamen, etwas modrig kalten Hauch aus den Kulissen, das wunderliche, unwirkliche, alle Illusion raubende Gemisch des bunten Theatertandes und der bürgerlichen Kleidung, in der die Probe stattfand. Ein eisiger Zug schlug von dem Saal zur Bühne hinauf, die im grauen Dämmerlicht lag.
Und wieder tönte die Klingel.
Dorothea raffte sich auf. Ihr Blick irrte umher. Auf einen Moment begegnete sie dem Auge Sickels. Er nickte ihr kurz zu, als wollte er sagen: Mut! Nur Mut!
So fing sie an zu sprechen:
„Du Sumserin von Gold, wo kommst du her?
Du Zuckerschlürferin, Wachsmacherlein!“ —
Sie fühlte, dass sie schlecht sprach. Und sie riss sich gewaltsam zusammen. Sie konnte es ja besser! Konnte schärfer akzentuieren, konnte ihrer Stimme einen innigen, klingenden Ausdruck geben, ihrem Gesicht verträumtere Züge leihen —
Mut! Nur Mut!
Und es ging. Die Kraft wuchs ihr im Weitersprechen. Die Schemen, vor denen sie sich gefürchtet, zerstoben. Noch ehe der Nickelmann auftauchte, war sie ganz eins mit ihrer Rolle, sie fand plötzlich den rechten Ton, sie jauchzte heraus:
„Will der Herr Oheim böse sein,
Tanz’ ich für mich den Ringelrhein!
Liebe Gesellen find’ ich genung,
Weil ich schön bin, lieblich und jung –
Eia, juchheia! Lieblich und jung!“
Es war wie eine Erlösung von einem ungeheuren Druck. Mit einem Schlage, wie aus tiefinnerster Eingebung heraus, kam ihr alles, kamen ihr die Worte, kamen ihr die Gebärden und Bewegungen, kam ihr die Auffassung. Es war kein Zagen und kein Schwanken mehr in ihr. Auch nicht, als der Glockengießer auf die Bühne trat. Ganz natürlich, als könne es gar nicht anders sein, kniete sie neben dem Zusammenbrechenden nieder und sprach auf seine Frage „Wie aber kam ich, sag‘ mir doch, hierher?“:
„Das, lieber Fremdling, wüsst‘ ich nicht zu sagen.
Doch lass es dich nicht kümmern, wie’s geschah.
Lehn‘ — hier ist Moos und Heu — darauf dein Haupt
Und ruh‘ dich aus! Der Ruh‘ wirst du bedürfen.“
Sie war „im Zuge“. Sie wusste selbst, es glückte! Es kümmerte sie nicht, dass man mit der Dichtung ziemlich willkürlich umgesprungen war, dass der Rotstift des Herrn Direktors unheimlich in ihr gewaltet hatte, dass der Pfarrer und der Schulmeister und der Barbier ihm zum Opfer gefallen waren, da wohl das Personal nicht ausreichte — sie merkte es kaum. Nur das fühlte sie, dass sie in dem Glockengießer Sickels einen ebenbürtigen Partner hatte, dass auch sie ihm gewachsen und dass der Nickelmann mindestens nicht schlecht war. Es musste — frohlockte es in ihr — ein Zusammenspiel geben, das sich sehen lassen konnte.
So ging fast ohne Unterbrechung durch den direktorialen Regisseur der erste Akt zu Ende. Jubelnd kündete sie auf des Nickelmanns Werbung:
„Und ist deine Krone von eitel Saphir,
So lass deine Töchter prunken mit ihr.
Meine güldenen Haare, die lieb‘ ich viel mehr,
Die sind meine Krone und drücken nicht schwer.
Und ist von Korallen dein Schrein und dein Tisch:
Was soll mir ein Leben bei Molch und bei Fisch —“
Und jubelnd warf sie die Arme hoch:
„— ins Menschenland!“
Als endlich das letzte wimmernde „Quorax — Brekekex“ des Nickelmanns verhallt war, lag auf einen Augenblick ein tiefes Schweigen über der Bühne. Dann kam der Direktor auf Dorothea zu, mit einer großartigen Geste, mit abgenommenem Hut.
„Ich gratuliere! Ich gratuliere! Ich wusste ja, dass unser Edgar Maurer mir keine Stümperin empfohlen hatte, ich hatte Vertrauen. Aber meine Erwartungen sind übertroffen. Meine Hochachtung, Fräulein Linden! Was, lieber Sickel? Nicht wahr, Baffer — sagt’s doch nur, sprecht’s doch nur aus: ihr seid gleich mir überrascht!“
Es war wie eine kleine Gratulationscour um Dorothea. Ein Lächeln der Verlegenheit auf den Lippen, wehrte sie in ihrer großen, inneren Erregtheit die Glückwünsche bescheiden ab. Als Sickel ihr die Hand drückte, neigte sie ein wenig den Kopf, fast wie demütig; aber sie hob ihn gleich wieder und sah mit großen, strahlenden Augen um sich: „War’s wirklich gut?“ —
Auch die anderen Akte spielten sich glatt herunter. Freilich nicht so ganz ohne Stockungen wie der erste. Dorothea selbst war nicht immer ganz sicher, der gute „Kastengeist“ musste hier helfen, dann und wann sprang ihr auch Sickel geschickt zu Hilfe. Aber sie empfand doch: es sind noch Lücken, die zu füllen blieben! Erst zum Schluss fand sie ganz die Sicherheit wieder, fand die aus dem Herzen quellenden, in die Herzen dringenden Töne.
„In tiefer Nacht mutterseelenallein
Kämm‘ ich mein goldenes Haar,
Schön, schön Rautendelein!
Die Vögel reisen, die Nebel ziehn,
Die Heidefeuer verlassen glühn —“
— bis zum letzten Abschied, bis zum letzten Kuss auf die Lippen des sterbenden Geliebten. —
Herr Neesemann hatte wiederholt mit Stentorstimme dazwischen gewettert, besonders die armen Elfen hatten eine schwere Viertelstunde durchzukosten gehabt. Es waren freilich ziemlich ehrwürdige Damen, die sich nur schwer in ihre lustigen Rollen hineindenken konnten. „Kinder, ihr seid wie die Mehlsäcke! Mehr Grazie, teure Mathilde! Noch einmal, Fräulein Gagert — bitte, nur heraus mit der Sprache! Hier wird nicht markiert! Lauter! Lauter!“ Auch die alte Wittichen hatte ihr Teil abbekommen. „Was murmeln Sie denn da eigentlich für einen Dialekt? Schlesisch hat’s der Dichter geschrieben! Schlesisch, Frau Hulbrich, schlesisch! Was, Sie können nicht Schlesisch? Eine Schauspielerin muss jeden Dialekt beherrschen, und wenn der Autor Botokudisch vorschreibt, so haben Sie eben Botokudisch zu lernen. Verstanden?!“
Aber als die letzten Worte gefallen waren, wurde Direktor Neesemann wieder eitel Zucker. „Herrschaften, das gibt eine Komödie, die uns ein Dutzend ausverkaufter Häuser bringt. Famos, lieber Sickel! Ausgezeichnet, Fräulein Linden! Morgen um zwölf Uhr Kostümprobe. Ich selbst freue mich darauf, Sie im Kostüm zu sehen, Fräulein Linden. Ihre schöne Gestalt muss zur Geltung kommen. Ja — ich glaube gar, Sie werden rot, mein Kind! Unsinn: eine Schauspielerin muss so schön aussehen wie nur immer möglich. Denken Sie an Goethe, der da sagt: Die Gestalt des Menschen ist der Text zu allem, was sich über ihn sagen und empfinden lässt! Unser gewaltiger Goethe! Ja — und hier habe ich für Sie noch eine Überraschung.“ Er griff in die Brusttasche. „Ich wollte die heutige Probe erst abwarten, ehe ich Ihnen diese Rolle anvertraute. Die ‚Fedora‘ von Sardou! Eine Bombenrolle — eine der großen Rollen der großen Duse. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Freuen sollten Sie sich!“
„Aber, Herr Direktor, die Fedora steht nicht auf meinem Repertoire.“
„Weiß ich! Ich will ja auch nicht drängen. Sie sollen Zeit haben — drei, vier Tage. Ja — addio, Herrschaften! Addio!“ —
* * *
So starke Sorge Dorothea vor der ersten Probe gehabt hatte, das eigentliche „Lampenfieber“, das dem Anfänger fast nie erspart bleibt, das aber auch manchen routinierten Schauspieler immer aufs Neue befällt, blieb ihr fern. Sie war ganz ruhig, sowohl am Tage vor der Aufführung wie am Abend selbst. Sie änderte noch einiges an ihrem Kostüm, das Minnas fleißige Hände schon vorbereitet hatten, ging zur Probe, speiste mit gutem Appetit, memorierte dann wieder — es war ihr fast ein Tag wie alle andern. Als Sickel sie fragte: „Gar keine Angst, Fräulein Linden?“, lächelte sie und schüttelte den Kopf: „Gar nicht!“ Fast wunderte sie sich selber, wie kühl sie dem Ereignis — ein Ereignis war es doch für sie! — gegenüberstand. Fast so, als ob etwas von Minnas stoischer Ruhe auch auf sie übergegangen wäre. — Minna saß auf einem Parkettplatz in der letzten Reihe und dachte nur: „Gnä‘ Fräulein wird’s schon schön machen. Schöner, als das dumme Volk verdient.“
Und doch sollte Dorotheas Ruhe an diesem Abend noch auf die stärkste Probe gestellt werden.
Während des ersten Aktes sah sie vom Publikum so gut wie nichts. Es erschien ihr wie eine schwarze Masse. Sie hörte nur beiläufig hinter den Kulissen, dass das Haus glänzend besucht wäre, und sie empfand mehr als sie’s direkt vernahm, dass sie Kontakt mit den Zuhörern gewann. Es war bisweilen wie ein Raunen, das aus dem Saale herausklang. Erst der lebhafte Beifall am Aktschluss packte sie stärker. Aber als der Glockengießer links, der Nickelmann rechts ihr Rautendelein zwischen sich nahmen und vor die Rampe zogen, als sie sich verneigte und der Beifall noch einmal anschwoll, auch da dachte sie eigentlich nicht an die vielköpfige Masse zu ihren Füßen, sondern es schoss ihr plötzlich durch den Sinn: „Wenn das mein Mütterchen erlebt hätte!“
In der ersten Hälfte des zweiten Aktes ist das Rautendelein nicht beschäftigt. Dorothea war in der kümmerlichen Damengarderobe und musste ihr phantastisches Gewand in Hast mit dem der schlesischen Magd vertauschen. Ihre Stimmung sank ein wenig. Auch das Wispern der drei, vier Frauen um sich herum störte sie; die eine kam und bat sie um ein Schminktuch. die zweite suchte geräuschvoll nach Nadeln, die dritte zankte sich mit dem Friseur. Dazwischen ging allerlei Klatsch und Lachen herüber und hinüber. So hörte sie auch, so wenig sie darauf achtete: – „Na ja, der ganze landwirtschaftliche Verein ist im Hause — hatte heute Sitzung — die Gutsbesitzer aus der Umgebung“ — ein paar Namen fielen — „nette Leutchen darunter — höchst spendabel — Vielleicht war’s auch eine leise Anspielung gegen sie: „Bilde dir nur nicht ein, dass das Haus so gut gefüllt ist, weil ausgerechnet Dorothea Linden als Debütantin auftritt!“
Auch als sie dann wieder auf die Bühne musste, achtete sie nicht auf das Publikum. Sie stand zuerst mit ihrem Beerenkorb bescheiden im Hintergrund; sie war dann ganz mit ihrer Rolle beschäftigt und hantierte am Herde
„Glimmerfunken im Aschenrauch,
Knistern unterm Lebensbauch,
Brich hervor, du roter Wind,
Bin, wie du, ein Heidekind –
Surre, surre, singe!
Dann kam das schöne Zwiegespräch mit Heinrich, dem kranken Glockengießer –
Mit einem Male aber, ganz plötzlich, als sie sich zufällig dem Zuschauerraum zuwandte, auf einen Augenblick nur, sah sie in der Mitte der ersten Reihe ein Gesicht! Sah nur das eine —
Es war wie ein Zauber! Es war wie ein Schlag!
Dort, gerade vor ihr, hart rechts hinter dem niedrigen Souffleurkasten, saß der, den sie geliebt! Der, der im fernen Südwest, auf öder Steppe, sein Blut gelassen, der in fremder Erde ruhte! Saß weit vornüber gebeugt, und seine Augen hasteten mit heißem Glanz auf ihr.
Sie hatte gerade gesprochen:
„Meister, schlummre ein,
Wachst Du auf, so bist du mein
Wünschlicher Gedanken Stärke
Wirk’ indes am Heilungswerke – „
So gewaltig war der Schreck, der sie durchraste, dass ihr die Sinne schwanden. Sie suchte mit den Händen nach einer Stütze; sie griff nach der Herdplatte, sie sank in die Knie — ;
Weitersprechen konnte sie nicht. Zweimal hörte sie, wie im Traum, daß die Souffleuse ihr das nächste Wort gab: „Schätze — Schätze, verwunschene —“ Es war ja nur ein Moment, war nur der Bruchteil einer Minute. Dan kam ihr die Besinnung zurück. Ein Phantom hatte sie getäuscht, eine flüchtige Ähnlichkeit hatte sie genarrt.
Sie richtete sich auf. Aber die Knie zitterten ihr. Mühselig zwang sie sich:
„Schätze, verwunschene, wollen zum Licht,
Unten in Tiefen leuchten sie nicht.
Glühende Hunde bellen umsonst,
Winseln und weichen mutiger Kunst.
Aber wir dienen froh und bereit.
Weil uns beherrschet, der uns befreit —“
Und dann stand sie und wagte die Augen nicht anfzuschlagen.
„Eins, zwei, drei: so bist du neu,
Und im Neuen bist du frei.“
Es war ein Glück, dass nun gleich Frau Magda eintrat, dass dann nach wenigen Worten der Vorhang fiel.
Dorothea stand noch immer, während draußen der Beifall brauste. Sickel — Meister Heinrich — war schon von seinem Lager aufgesprungen. Der Direktor kam quer über die Bühne: „Hören Sie doch nur, wie sie klatschen. Das gilt unserem Rautendelein! Famos waren Sie — und nun gar die feine Nuance, die Sie da zuletzt herausbrachten, mit der köstlichen Verwirrung, als Sie am Herd niedersanken. Einfach großartig! Vorhang hoch! — Die Leutchen wollen Sie sehen!“
„Eine köstliche Nuance“ nannte man das, was ihr innerstes Erleben war! Eine Nuance — einen schauspielerischen Trick vielleicht —
Da war Direktor Neesemann aber schon in großen Sprüngen hinter der rechten Seitenkulisse verschwunden. Der Vorhang rauschte empor, senkte sich, hob sich noch einmal und zum dritten Mal — wahrscheinlich stand jetzt der Direktor selbst neben dem Vorhangsmann und wies ihn an, durch beschleunigtes Heben und Senken des „Fetzens“ den Beifall des Publikums noch besonders „herauszukitzeln“.
Dorothea mußte sich immer wieder verneigen. Ganz mechanisch tat sie es, wieder und wieder. Ihre Augen irrten über den Saal, aber sie vermochte nichts dort unten zu unterscheiden. Ein Schleier lag vor ihrem Blick.
„Umkleiden! Fräulein Linden — bitte! Es ist höchste Zeit!“
Richtig, sie musste ja den Rock der schlesischen Magd für den nächsten Akt wieder mit dem wallenden Rautendeleinkostüm vertauschen. Jawohl! Natürlich! Großer Gott im Himmel — und dann weiterspielen —
Bei dem Umkleiden wurde sie doch ruhiger. Es war eine Wahnvorstellung gewesen, die sie erschreckt hatte. Ein Spuk ihrer erregten Phantasie! Von einer Zufallsähnlichkeit vielleicht geweckt! Dass man sich so täuschen lassen kann! Man musste dagegen ankämpfen. Mit festem Willen! Die Toten erstehen ja nimmer — nimmer —
Sie wollte über sich selber lächeln, aber das Lächeln erstarb immer auf’s Neue auf ihren Lippen.
Dann kurz, ehe das Klingelzeichen ertönte, schlich sie sich zum Vorhang und spähte durch das kleine, runde Loch in den Zuschauerraum.
Und da sah sie ihn wieder — Noch einmal überlief sie ein Schauer.
Aber nun sah sie auch, dass wirklich nur eine Ähnlichkeit sie genarrt hatte. Der Mann dort unten glich „ihm“ freilich in einer erstaunlichen Weise. Es war das gleiche, längliche Gesicht mit der scharfen Nase, dem kühn geschnittenen Lippenpaar, dem hellblonden, dichten Haar. Allein er war um Jahre — um mindestens fünf Jahre älter, als Konrad heute sein könnte. Und neben aller Ähnlichkeit doch auch sonst so viele Unterschiede! Das Kinn viel ausgeprägter, die Stirn von zwei waagerechten Falten durchfurcht, auch um die Augen kleine Falten und Fältchen, die sich fast bis zu den Schläfen hinziehen.
Ein schönes Männergesicht — gewiß! Der Zauber freilich, der auf Konrads Antlitz lag, der herzgewinnende Reiz — der fehlte! Hier ist alles schärfer, energischer —
Freier und unbefangener spielte Dorothea weiter, fühlte wieder, wie gut es ihr glückte, fühlte sich getragen durch jenes
geheimnisvolle Fluidum, das sich im Gelingen zwischen Darsteller und Zuschauer bildet. Wohl begegnete sie noch ein-, zweimal den Blicken des Mannes dort unten, der sie so stark an ihr erstorbenes Glück gemahnt hatte. Aber es konnte jetzt ihre Fassung nicht mehr gefährden. Im Gegenteil: Vielleicht klang durch diese Erinnerung geweckt gerade eine Saite in ihrer Seele auf, die ihrem Spiel besondere Stimmung gab. Die Stimmung, die zu dem Rautendelein des letzten Aktes, dem Rautendelein, das Abschied von dem Geliebten nehmen mußte, paßte —
„In tiefer Nacht mutterseelenallein kämm‘ ich mein goldenes Haar,
Schön, schön Rautendelein
Die Vöglein reisen, die Nebel ziehn,
Die Heidefeuer verlassen glühn —“
Fünf-, sechsmal musste nach dem Schluss der Vorhang hinauf. Der Erfolg wurde zu einem Triumph, und der Triumph galt in erster Linie ihr, der jungen Debütantin!
Als Dorothea endlich, wie in einem Glücksrausch, von der Bühne zur Garderobe ging, fand sie vor der Tür die Frau Direktorin. Hochaufgerichtet stand der „lange Grenadier“ und hielt ein paar Blumen in der Hand und sprach in ihrer seltsamen Betonung Grillparzers Worte: „Dein ist die Saat und der Fleiß — darum dein der Lohn des Bewusstseins! — Aber wie Regen und Tau — träuft aus der Höhe der Erfolg!“, sie machte dann eine kleine Kunstpause und zitierte mit starkem Schwung Tassos Spruch von den Lorbeerzweigen: „Wem einmal würdig sie das Haupt berührt, dem schweben sie auf ewig um die Stirn!“ — und schloss prosaisch, aber doch nicht ohne Rührung: „Na ja, Rautendelein — und wenn Sie mal irgendwo auf einer ganz großen Bühne Erfolg und Lorbeer ernten, dann denken Sie an unser kleines Neumöller und an die alten Neesemanns zurück!“
Viertes Kapitel.
Die Stadt Neumöller erfreute sich zweier Lokalblätter. Das eine war der „Kreisanzeiger“, amtlich, würdevoll — „anständig“, wie Frau Direktor sagte; das andre, das „Neumöller Tageblatt“, stand weit links und liebte es, seine Leser mit kleinen Skandälchen zu unterhalten. Im übrigen bestand jede Nummer hüben wie drüben aus zwei und einer halben Seite Text und sehr vielen Inseratenseiten; auf den letzteren wurden die dicksten Kartoffeln, wurden Butter und Margarine und noch so manches andre mit mehr oder minderem Erfolg von den verschiedensten Seiten angezeigt; auf den ersteren vereinten die Herren Redakteure mit Hilfe von Schere und Kleistertopf die neuesten und allerneuesten Ereignisse der Weltgeschichte, wie sie die großen politischen Zeitungen der verschiedenen Parteirichtungen widergespiegelt hatten.
Dass dabei sowohl der amtliche Kreisanzeiger wie das volksfreundliche Tageblatt jedes Mal um sechsunddreißig Stunden nachhinkten, tat nichts.
Beide Blätter brachten aber auch Theaterkritiken. Im Kreisanzeiger berichtete unter dem Pseudonym Talma Herr Oberlehrer Doktor Wolfgang Tudichum über die Kunst; ein wackerer, anständiger Herr in gesetzterem Alter, den sich Direktor Neesemann klugerweise dadurch zu Dank verpflichtet hatte, dass er vor zwei Jahren sein Römerdrama Tarquinius aufgeführt hatte, „angefertigt mit der berühmten Jambenspritze“, wie Herr Neesemann, noch in der Erinnerung schaudernd, zu sagen pflegte. Im Tageblatt führte Herr Fritz Spritze seine kritische Feder.
Beide Weltblätter verhalfen Dorothea zu ihren ersten Kritiken.
Herr Oberlehrer Doktor Wolfgang Tudichum verbreitete sich zuerst ausführlich über Gerhart Hauptmanns „Versunkene Glocke“, die er ein Produkt minderer Poetik nannte, mit unklarer Charakterzeichnung und schlottrigen Versen. Herr Gerhart Hauptmann möchte sich etwas eingehender mit Shakespeare einerseits, mit Goethe anderseits beschäftigen. Immerhin wäre das Märchenspiel nicht uninteressant und man müsste der rührigen Direktion dankbar sein, dass sie den kunstfrohen hiesigen Kreisen die Kenntnis des phantastischen Zauberspuks erschlossen hätte. Dann hieß es weiter: „Das eigentliche Ereignis des Abends aber war das Debüt von Fräulein Dorothea Linden. Die junge Dame riss die Zuschauer vom ersten Augenblick an mit sich fort. Eine blendende Erscheinung, ein herrliches Organ sind ihr von der gütigen Natur verliehen. Vor allem aber erfreute an ihr eine in der jüngeren Bühnengeneration immer seltener werdende Tiefe der Empfindung, die den Intentionen der Dichtung gleichsam vorauszueilen wusste. Sie entzückte und rührte, sie griff tief in unsre Herzen. Es gab Momente, in denen der süße Wohlklang ihrer Stimme geradezu berauschte, andre, in denen die Innigkeit ihres Spiels uns völlig in Bann nahm. Beglückwünschen wir uns zu dieser Schauspielerin, die ohne alle Zweifel sehr bald zu den ersten Sternen der deutschen Bühne gehören wird.“
Herr Redakteur Fritz Spritze hatte sich nach berühmten Mustern einen wahrhaft lapidarischen Stil angewöhnt. Er schrieb: „Gestern ‚schmierte‘ uns Neesemanns Kunstinstitut eine ‚Versunkene Glocke‘. Ausstattung erbärmlich. Regie trivial. Darstellung — puh! Wie nicht anders zu erwarten. Der Glockengießer Sickel ein paar gute Momente — schade um den Mann. Rautendelein — Fräulein Dorothea Linden. Debütantin. Hübsches Mädel, gerade gewachsen. Mancher nennt sie gewiss schön: Geschmackssache. Volltönendes Organ. Tönt aber zu oft, tönt immerzu. Das hübsche Kind agiert auch immerzu. Kein Maßhalten, Anfängerunart. Brausender Beifall zu konstatieren. Galt zweifellos in erster Linie dem hübschen Mädel, das besonders den zahlreich vertretenen Agrariern (Sitzungstag des landwirtschaftlichen Vereins) in die Augen stach. So was sieht man auf den Gutshöfen nicht alle Tage! Will aber nicht aburteilen. Vielleicht steckt in diesem hübschen Mädel doch noch mehr: wirkliches Temperament vor allem, das bisher kaum erkennbar. Kann erst die Zukunft lehren. Warten wir’s ab. Unter Herrn Neesemanns glorreichem Schmierenzepter ist Entfaltung eines Talents freilich schwer. Dixi!“
* * *
Dorothea hatte zuerst den Kreisanzeiger, dann das Tageblatt gelesen. Nun saß sie, die zusammengefalteten Blätter im Schoß, mit zusammengepressten Lippen.
Die ersten Kritiken —
Sie hätte so gern gelacht. Ein befreiendes Lachen, das fühlte sie, wäre ihr eine Wohltat gewesen. Aber das Lachen kam nicht.
Dass die Kritik im Kreisanzeiger im Grunde nichtssagend war, fühlte sie nur zu deutlich. Hinter den verletzenden Worten, die Herr Fritz Spritze gefunden hatte, aber stand doch so etwas wie ein wirkliches Urteil. Und das tat weh — tat der jungen Seele doppelt weh, weil sie ernstlich den Gründen nachsann, auf denen dies Urteil fußen mochte, und weil sie dabei darauf geführt wurde, dass ihr Rautendelein doch wohl noch weit, weit hinter den Intentionen des Dichters zurückblieb. Zu viel Theatralik! Das sagte die Kritik, wenn man sie recht verstand. Zu viel Theatralik, zu wenig Natur.
Und dann stand da noch etwas, was Dorothea zu denken gab: der Zweifel, ob sie das rechte Temperament hätte!
Temperament? Was konnte man nicht alles unter dem Begriff sich vorstellen, von ihm verlangen, in ihn hineindenken! Und vielleicht war’s schließlich nicht mehr als ein
Wort, ein leeres Wort, dass sich Herrn Fr. Sp. in die Feder gedrängt hatte, da er gerade kein andres fand.
Ärgern durfte man sich nicht. Aber weiterarbeiten musste man. Mein Herr Fr. Sp., wir wollen dir schon beweisen, dass die Anfängerin entwicklungsfähig ist — vielleicht auch, dass sie Temperament hat!
Weiterarbeiten I —
Jetzt konnte sie wirklich lachen. Aber so recht befreiend war auch dies Lachen nicht.
Da lag ja die Sardousche Fedora (Sardou ist der Verfasser des Stückes). Eine Bombenrolle, wie Direktor Neesemann gesagt hatte — man musste dankbar für sie sein. Aber zwölf Bogen, und für übermorgen Mittag war schon die erste Probe angesetzt. Dabei musste sie heute Abend lm Wallenstein die Thekla spielen — gottlob, die Rolle saß! Und morgen gab’s wieder die „Versunkene Glocke“.
An Arbeit fehlte es also nicht. Blieb nur zu hoffen, dass die Arbeit lohnte, dass der Erfolg mit ihr war.
Wie hatte doch Herr Fritz Spritze geschrieben: „Kann erst die Zukunft lehren. Warten wir’s ab!“
Dorothea wollte wieder lachen, aber es wurde ein leiser Seufzer daraus. Immerhin doch laut genug, dass Minna, die in der Kammer nebenan das duftige Rautendeleinkostüm neu aufbügelte, auf einen Augenblick ihr altes, gutes Gesicht durch die Türspalte steckte: „Na ja — gnä‘ Fräulein haben eben geseufzen. Das hab‘ ich mir immer gedacht — hier wird noch viel geseufzt werden —-“
Aber Dorothea schüttelte den Kopf. Es war nicht so schlimm gemeint, Minna. Du musst auch nicht darauf hören. Aber den Theklakragen für heute Abend darfst du mir noch zurechtkrausen.“ Es war immer noch das beste Besänftigungsmittel für Minna, wenn man ihrem Tätigkeitstrieb eine neue Richtung zuwies.
Einen Moment hielt Dorothea die beiden Zeitungsblätter noch in der Hand. Dann legte sie sie auf die Tischplatte — sie wollte zu ihrer neuen Rolle Fedora greifen. Doch da fesselte, im zufälligen Hinschauen, auf der letzten Seite des Kreisanzeigers ein Inserat ihre ganze Aufmerksamkeit —
Sie starrte auf das Blatt wie in einem Bann. Und dann, lachte sie wieder aber diesmal klang es gallebitter.
Jetzt wusste sie, wer der Mann gewesen war, der sie gestern Abend von seinem Parkettplatz unverwandt angestarrt hatte, der Mann, in dem ihre Phantasie auf eines Atemzuges Länge den geliebten Toten gesehen —
Ludolf Kastrop, der älteste Bruder, der Majoratsherr. Kein andrer —
Dass sie nie daran gedacht hatte, dass ihr nicht einmal der Gedanke gekommen war: Schneeholm musste ja hier in der Nähe liegen! Schneeholm, von dem Konrad so oft mit Begeisterung gesprochen hatte, Schneeholm, das er dabei doch nie ohne Bitterkeit hatte nennen können! Schneeholm mit seinen dunklen Buchenwäldern und dem unergründlich tiefen Evesee, mit dem alten Schloss der Kastrops, in dem sie einst die dänischen Könige willkommen geheißen! Schneeholm, das den Ältesten des Geschlechts zum Millionär machte und den jüngeren Geschwistern nur ein karges, ach so sehr karges Almosen gab!
Da stand es ja — und war’s nicht gerade in dieser Verbindung zum Lachen komisch: „Dominium Schneeholm. Holzauktion am 15. November. Frhrl. v. Kastropsche Gutsverwaltung.“
Die kleine Faust fiel schwer auf das Zeitungsblatt.
Wie sie dies Schneeholm hasste! Wie sie diesen kalten, berechnenden Ludolf Freiherrn von Kastrop, Majoratsherrn aus Schneeholm, hasste! Diesen Mann, dessen enges Herz ihr den Weg zum Glück versperrt, der den eignen Bruder in die Ferne, in den Krieg getrieben hatte! Vor ihrem geistigen Auge stand plötzlich wieder sein Antlitz — zum Greifen deutlich. Aber sie sah nicht mehr die Ähnlichkeit in diesen Zügen. Sie sah nur die Falten und Fältchen, die sich fast bis zu den Schläfen hinzogen, sah die zwei wagerechten, tiefen Furchen auf der Stirn. Gleich Kainszeichen erschienen sie ihr —
Am Abend saß Herr von Kastrop wieder im Parkett, wieder wie gestern in der ersten Reihe. Aber diesmal allein; von den andern Gutsbesitzern hatte sich keiner eingefunden, sehr zum Leidwesen des „langen Grenadiers“ an der Kasse. Das Haus war überhaupt sehr schlecht besucht, und die Vorstellung, fand Dorothea, wirklich im Sinne des Herrn Fritz Spritze „schmierenhaft“. Nur der Max Pikkolomini Sickels hob sich über den Durchschnitt, aber auch er hatte etwas eigen Flattriges, Unsicheres, Überhastetes, das Dorothea erstaunen machte.
Dass dieser Herr von Kastrop dort unten saß, was tat es? Es irritierte sie nicht — es durfte sie nicht irritieren. Mochte er doch für sein gutes Geld des zweifelhaften Genusses dieser heutigen Komödie sich erfreuen. Es war sein gutes Recht.
Und dass er sie wieder und wieder anstarrte, war das nicht schließlich auch sein Recht, bezahlt mit 2,50 Mark! Jeder Esel erwarb sich für sein Geld das gleiche Recht. Auch dies Anstarren durfte sie nicht irritieren!—
Publikumsrecht — Schauspielerlos! Das war nun einmal nicht anders. Und man kam am besten darüber hinweg, wenn man sich ganz seiner künstlerischen Aufgabe hingab. Ob da unten ein Ludolf Kastrop, Majoratsherr aus Schneeholm, saß — was ging sie das an?
Es war ja gewiss auch nur Zufall, der ihn zweimal hintereinander in die Komödie geführt hatte. Er wollte einen langweiligen Abend in diesem Städtchen ausfüllen — weiter nichts!
Aber als sie am nächsten Abend die Chaussee zum Schützenhaus hinausging, durch den tiefen Schnee, in empfindlicher Kälte, begegnete sie dem Schlitten mit den beiden Braunen, der gestern nachmittag vor dem „Schwarzen Raben“ gehalten und von dem ihr Frau Halber, das getreue Kastengeistlein, im Vorübergehen gesagt hatte: „Der Schneeholmerl Sind das nicht ein Paar Staatspferde?“
Der Schlitten flog an Dorothea vorüber. Gerade, dass sie die Pferde erkennen konnte. Vielleicht war der Herr, der selbst kutschierte, gar nicht einmal der Majoratsherr. Vielleicht war’s ein Gast von ihm, vielleicht ein Verwalter. Im Grunde, was ging sie es an?
Und wenn er’s war, ins Theater kam er gewiß nicht. Zum zweiten Male sah er sich die „Versunkene Glocke“ nicht an. Aber Dorothea irrte. Er saß wieder in der ersten Reihe.
Und diesmal mußte sie es als eine Absicht erkennen: er kam um ihretwillen. Wenn sie sich das hätte ableugnen wollen, würde es ihr ein Scherzwort Nickelmanns klar gemacht haben. Herr Baffer trat gerade, ehe der Vorhang aufging, vom Guckloch zurück und nickte ihr mit einer Grimasse, die gut zu seiner Maske paßte, zu, während er sich in sein Brunnenverließ verkroch: „Schau, schau, schön Rautendelein! Die Hauptmannsche Poesie zieht sogar die Agrarier wieder ins Haus -natürlich nur die Poesie, schön schön Rautendelein. Der Majoratsherr auf Schneeholm – schau, schau!“
Diesmal irritierte es sie doch. Sie mußte stark gegen sich ankämpfen. Nicht einen Blick warf sie in den Zuschauerraum. Dieser Mann dort unten sollte nicht denken, daß sie sein wiederholtes Kommen auch nur bemerkte!
Es war überhaupt ein Unglücksabend.
Schon im ersten Akt fühlte sie, dass ihr Partner anders war als vorgestern. Er schien nicht recht bei der Sache. Ein paar Mal verfehlte er den Einsatz, dann und wann mußte die Souffleuse stark helfen, bisweilen starrte Sickel wie hilflos zwischen die Kulissen. Er riß sich zwar immer wieder zusammen, aber Dorothea merkte ihm an, dass ihm das Weiterspielen große Überwindung kostete. Einmal fragte sie ihn: „Fühlen Sie sich nicht wohl, Herr Sickel?“ Da schüttelte er den Kopf, ohne sie anzusehen.
Im zweiten und dritten Akt ging es besser. Aber als sie in der ersten Szene des dritten Aktes wartend zwischen den Kulissen stand, sah sie mit Schrecken, dass Sickel sich kaum aufrechthalten konnte. Er sprach ganz undeutlich, ließ einzelne Verse aus und nur die Gewandtheit Baffers rettete ihn.
Neben Dorothea stand Direktor Neesemann. In ihrer Angst fragte sie: „Sickel ist krank. Was soll das nun werden?“
Aber der Direktor schüttelte den Kopf: „Krank? Nee. Aber er hat wohl wieder seinen bösen Tag —“
Da musste sie auch schon heraus, ihr Stichwort fiel. Musste sich über ihn beugen: „Was hast Du, Liebster?“
Und im selben Augenblick wurde ihr das Entsetzliche klar –
Lallend nur, und gerade darum mit schrecklicher Wahrheit sprach Sickel, sprach Heinrich:
„Ich lag wohl hier und fror –
Ohnmächtig, leer an Kraft, mit müdem Herzschlag
Da drangen finstere Mächte bei mir ein
Ich werd’ ihr Opfer und sie quälten mich
Sie würgten mich – “
Sprach’s und sah ihr mit verglasten Augen ins Gesicht, so unendlich traurig, als ob der Wein ihm die schreckliche Wirklichkeit des Geschehens nicht aus dem Bewusstsein gelöscht hatte.
Weiterspielen?!
Es mußte ja sein, es war Pflicht, erbarmungslose Pflicht.
Der Widerwillen, das Entsetzen mußte überwunden, mußte niedergekämpft werden.
Und es ging. Ging – so gut oder schlecht es eben gehen konnte.
Als Dorothea im letzten Zwischenakt an dem Direktor vorüber kam, griff er mitleidsvoll nach ihrer Hand. „Sie armes Kind! Ich fühle, wie schwer es Ihnen wird. Aber haben Sie Erbarmen mit dem unglücklichen Mann. Er würde eine Zierde jeder Hofbühne sein, wenn nicht – es ist eine furchtbare Tragik“
Sie konnte nur den Kopf neigen. Ja – es war eine furchtbare Tragik.
Nun war endlich endlich die Komödie zu Ende, der Vorhang zum letzten Male gefallen. Dorothea stürzte nach der Garderobe. Da stand im engen Gang der lange Grenadier, die Frau Direktor. Auf ihrem Gesicht stand die Erregung, die heute alle Mitglieder beherrschte: Gottlob, dass das vorbei ist. Auch sie hatte ja wohl gezittert: Ob nicht das Spiel vor dem Ende abgebrochen werden müßte, ob nicht die Zuschauer merken würden, wie mühselig alle Mitwirkenden dem unglücklichen Mann von Szene zu Szene weiterhalfen.
Als Frau Neesemann aber Dorothea erkannte, ging ein Leuchten über ihr Gesicht. Sie drehte mit einer launigen Gebärde den Daumen der linken Hand nach der Garderobentür und hatte selbstverständlich gleich ein Zitat: „Blumen, die der Lenz geboren, streue ich dir in deinen Schoß . .. ei, ei schön Rautendelein —“
Da hatte Dorothea auch schon aufgeklinkt und sah wohin die Worte und das Lächeln zielten: Auf ihrem Toilettentisch stand ein riesengroßer Korb La France-Rosen, leuchtend und duftend in herrlicher Frische.
Das Blut strömte ihr ins Gesicht. Sie wußte ja sofort, wer der Spender war. Im ersten Augenblick schoss es ihr durch den Sinn: Reiße die Blumen heraus und tritt sie mit den Füßen. Wirf sie auf die Straße, in den Schnee, vor seinen Schlitten —
Dann kam das bittere Gefühl – Du bist die Komödiantin, der jeder Blumen schenken darf!
Sie griff mit zitternden Händen in die Blütenpracht, sie zerrte an den Rosen.
„Aber Fräulein Linden, was haben Sie denn nur. Diese herrlichen La France-Rosen“ rief die kleine Grete Müller vom Nebentisch. Und Frau Hulbrich, die Wittichen, die noch nicht abgeschminkt war, kam angetrippelt, steckte ihre Nase in den Korb und jammerte: „Die schönen schönen Rosen —“
Ein Schauer roter Blütenblätter glitt zur Erde.
Dann riß Dorothea plötzlich das ganze Arrangement auseinander und warf jeder der Kolleginnen eine Handvoll Rosen zu: „Da, da – bitte ich mag sie nicht! Ich will sie nicht!“
Nachher aber – es hatte heute merkwürdig lange gedauert, bis sie fertig war, und Minna, die ihr beim Umkleiden half, brummte schon – nachher also, als sie endlich gehen wollte, sah sie noch eine einfache Knospe auf dem Tisch liegen.
Sie gab sich selbst keine Rechenschaft. Sie dachte nur flüchtig „das arme Ding“, nahm sie auf und steckte sie in ihren Muff.
So trug sie die Knospe mit nach Hause – und vergass sie, todmüde wie sie war, körperlich überanstrengt, geistig niedergedrückt.
Aber als sie am nächsten Morgen erwachte, stand die Rose in einer kleinen Vase vor ihrem Bett. Und Minna war sehr stolz auf ihr Rettungswerk. „Gnä Fräulein, was kann die arme Rose dafür? Schauen Sie doch nur, wie schön sie aufgeblüht ist über Nacht.“
Das Repertoire erlitt eine empfindliche Störung, Sickel hatte sich krank gemeldet. Der Direktor tobte: „Gerade wo wir so schön im Zuge waren, packt es ihn wieder. Ach, Fräulein Linden, was habe ich mit dem Manne schon alles durchgemacht. Der nüchternste Mensch von der Welt, aber alle Vierteljahre muss er sich einmal ausleben, alle Vierteljahre rennt er einmal in sein Unglück. Und dabei muss man Mitleid mit dem Armen haben. Sie können gar nicht ahnen, wie er leidet! Wie er jedesmal bereut, welche Vorsätze er fasst, wie er dann ringt und kämpft – und immer wieder vergeblich.“
Kleine Einakter mussten aushelfen, alte Possen und Schwänke. Man sah so recht, in welchem Maße Sickel der Träger des Repertoires war.
Es gab „brechend“ leere Häuser. Basser deklamierte einmal: „Wir sind heut in der Mehrzahl, wenn’s zum Gefecht kommt!“ Frau Hulbrich fragte: „Ist’s heut voll?“, worauf Hanna Bargetl, die Naive, spöttisch zurückgab: „Jawohl – jammervoll!“ Und der Direktor selber, in bitterer Ironie, ergänzte: „Einige Plätze sind recht gut besetzt.“
Komödiantenhumor –
Dorothea sah wohl: die Kollegen nahmen nichts tragisch. Immer gab’s heiteres Lachen, stets fand der eine oder der andre einen guten Witz. Und wenn die älteste Anekdote neu aufgewärmt wurde – fröhlichen Beifall gewann sie sich immer.
Aber sie konnte sich in diesen Ton nicht finden. Es kam zu vielerlei zusammen, das auf sie drückte.
In den ersten Tagen hatten die überraschenden Erfolge sie über alles Kleine und Kleinliche hinweg getragen, der Beifallsjubel und doch auch die stumme oder laute Anerkennung der Kollegen. Das Neue hatte seine besonderen Reize für sie gehabt. Nun aber drückte und beengte dasselbe Neue sie von allen Seiten her. Der Abstand gegen früher kam ihr mehr und mehr zum Bewusstsein. Die äußerliche Enge des neuen Daseins begann sie zu quälen. Ganz wörtlich genommen: die Enge. Ihre Mutter hatte in den letzten Jahren ja auch in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt, aber sie hatte doch einen standesgemäßen, vor allem einen geregelten Haushalt geführt. Das wollte Dorothea jetzt in den beiden kleinen Stübchen, die sie mit Minna teilen musste, nicht glücken. Sie empfand dumpf, was ein Bohémeleben bedeutete: etwas wie Zigeunerwirtschaft war’s doch. Das Studium und die Proben, diese täglichen endlosen Proben machten schon die regelmäßigen Mahlzeiten unmöglich; in den beschränkten Räumen duftete es bald nach der Küche, bald nach Wäsche und Plätteisen; die fünf Gören der guten Frau Thomsen vollführten tagsüber einen entsetzlichen Lärm, das Jüngste respektierte nicht einmal die Nachtstunden, in der oberen Etage schien sich die höhere Tochter des Magistratssekretärs Trübener zur Pianistin auszubilden – und dabei hieß es, fast täglich eine neue Rolle zu lernen!
Aber es gab noch eine andere Enge, die schwerer drückte, und für die Dorothea allmählich das Bewusstsein aufging: dass sie in einen Stand eingetreten war, der – mindestens in der Kleinstadt – eine Kaste für sich bildete und auf sich allein angewiesen war. Der gute, dicke Basser mochte seinen Stammtisch im „Schwarzen Raben“ haben, an dem er als Witzbold glänzte und den Zuhörern imponierte, sich wohl auch gelegentlich die Zeche bezahlen ließ. Sonst kamen die „Speelers“ mit anderen Schichten der Kleinstadtbevölkerung kaum in Berührung. Sie führten ihr Leben für sich.
Es war unter ihnen eigentlich nur einer, dem Dorothea sich gesellschaftlich ebenbürtig fühlte, nur einer, dem sie sich auch geistig für verwandt hielt. Gerade dieser Eine aber erschien ihr wieder als ein Beweis dafür, wie leicht die Bahn dieses Bohèmelebens dem Abgrund zuführen mochte.
Und schließlich quälte es sie, mehr als sie sich selber gestehen mochte, dass die Huldigungen des Herrn von Kastrop kein Ende finden wollten. In jeder Vorstellung sah sie sein ernstes Gesicht. War sie nur an einem Teil des Abends beschäftigt, so kam er spät und verließ das Haus fast unmittelbar, nachdem sie von der Bühne abgetreten war. Und in jeder Woche ein- oder zweimal fand sie in der Garderobe ein großes Blumenarrangement.
Sie konnte sich ja eigentlich nicht beklagen: er war ihr noch nie durch den Versuch einer persönlichen Annäherung lästig gefallen. Aber schon das leise Flüstern der Kollegen, das versteckte Lächeln, das ihm galt und ihr, reizte sie. Es schrie etwas in ihr: Er soll es nur wagen! Und zugleich sehnte sie doch den Augenblick herbei, in dem sie ihm ins Gesicht schleudern könnte, dass sie ihn hasste!
Endlich meldete sich Sickel gesund. Als er Dorothea zum ersten Male bei der langen verschobenen Probe der Fedora gegenübertrat, erschrak sie über sein Aussehen. Der ganze Mann schien gebrochen. Auch das herrliche Organ klang zuerst matt. Aber es war, als richte er sich an seiner Aufgabe auf; von Szene zu Szene hob sich sein Spiel, und am Schluss hatte auch seine Stimme den alten, vollen Klang zurückgewonnen.
Das Stück hatte für Dorothea viel Fesselndes, die Rolle war so überaus dankbar; es hatte freilich auch ihr mädchenhaftes Empfinden viel Peinliches. Doch das musste überwunden werden – auch da galt ja wieder das Wort: dem Beruf sein Opfer! Sie spielte mit voller Hingebung.
Nach der heißen Schlussszene des dritten Aktes fügte es der Zufall, dass sie auf ein paar Augenblicke mit Sickel allein war. Es berührte sie ganz merkwürdig: soeben waren sie auf der Bühne noch ein liebendes Paar – jetzt standen sie sich im Halbdunkel gegenüber wie zwei fremde Menschen.
Dort Fürstin Fedora Romazoff und Graf Boris Ivanoff – hier Dorothea Linden und Willibald Sickel!
Irgendeine Tür stand auf, es zog und war schneidend kalt. Er sah, dass sie fröstelte, lief nach der Garderobe, kam mit einem Tuch zurück und legte es ihr um die Schultern. Und dann, als die dankte, sah er sich scheu um, ob auch niemand in der Nähe sei, griff nach ihrer Hand, führte sie an die Lippen und bat: „Verzeihen Sie mir, Fräulein Linden – “
In ihr bebte noch die Erregung des Spiels nach. Aber sie fasste sich. „Ich habe nichts zu verzeihen – “
„Doch! Doch! Mir ist’s nach solchen Unglückstagen immer, als müsste ich alle Welt um Vergebung bitten. Sie aber besonders, Fräulein Linden.“
Es lag etwas tief Demütiges in seiner Bitte, etwas an das Herz Greifende.
Sie gab ihm die Hand. Auf eines Augenblicks Länge hielt er sie fest. „Ich danke Ihnen“, sagte er leise. „Versagen Sie einem Unglücklichen nicht Ihre Achtung.“
Da kam Basser vorbei und schlug Sickel leicht auf die Schulter. „Na, mein Alterchen, wieder wohlauf? Wir sehen’s mit Freude!“ Die wehmütige Stimmung des Augenblicks war gestört. Aber ihr Nachhall blieb.
Ende des Monats siedelte die ganze Truppe nach Tenburg über. Neumöller war vorläufig etwas „abgegrast“, die hohe Direktion versprach sich von der „Luftveränderung“ goldene Berge, und die Kollegen beiderlei Geschlechts begrüßten den Wechsel fast ohne Ausnahme auch mit Freuden. Schon weil es eine Veränderung war. „Ewiges Einerlei widersteht, Veränderung nur ist das Salz des Vergnügens,“ zitierte Basser aus „Kabale und Liebe“, als die Karawane – denn eine kleine Karawane war’s – sich auf dem Bahnhof in die bestellten Coupés dritter Klasse zwängte. „Auf nach Valencia!“
Nur eine grollte. Minna! Denn Minna musste zurückbleiben. Eigentlich hatte sie’s selber verschuldet. Sie war groß im Rechnen, und sie hatte dem gnä‘ Fräulein ziffernmäßig nachgewiesen, dass „man“ nicht auskam trotz aller Einschränkung! Schon zweimal hatte die Sparkasse, in der Dorothea ihre letzten paar Tausend Mark deponiert, „angezapft“ werden müssen. Einmal brauchte das gnä‘ Fräulein ein Direktorialkostüm für „Madame Sans Gêne“, und einmal fehlte das Geld zur Miete. „Gnä‘ Fräulein konnte und konnte eben nicht sparen. Es gab einen kleinen Zusammenstoß. Und als Minna hörte, dass man in Tenburg im Hotel wohnen müsse, stieg vor ihrem geistigen Auge plötzlich die Rechnung aus dem „Schwarzen Raben“ wieder empor. „Ich geh‘ nicht mit!“ hatte sie erklärt. Und wenn sie’s nun auch noch so sehr bereute, abhandeln ließ sie sich nichts. Aber sie wahrsagte Unheil – Unheil – Unheil –
Es schien durchaus, dass Minna unrecht mit ihren düsteren Prophezeiungen hätte. Tenburg gefiel Dorothea viel besser als Neumöller, und sie gefiel den Tenburgern erst recht. Die größere Garnison, die zahlreichere Beamtenschaft lieferten regelmäßige Theaterbesucher; es gab gut besetzte, beifallsfrohe Häuser. Fast an jedem Abend hatte Dorothea zu spielen; der Tag verging schnell mit Proben, Rollenlernen und Toilettenvorbereitungen. Die Vorstellungen gingen glatt vor sich in dem kleinen, sauberen Stadttheaterchen. Auch das Hotel war gut und billig. Nach der Vorstellung saß Dorothea im Speisesaal bisweilen sogar noch ein Stündchen mit dem „langen Grenadier“, dem „Alten“ und ein paar Kollegen zusammen; auch Sickel fand sich dann und wann ein, ein schweigsamer Gast vor einer Flasche Wasser.
Aber vor allem war Dorothea froh, dass sie dass sie nicht an jedem Abend das Gesicht Kastrops im Zuschauerraum vor sich sah. Tenburg mochte ihm unbequem liegen.
Das ging fast zwei Wochen, und das Intermezzo Tenburg neigte sich schon seinem Abschluss zu. Der Direktor hatte für die Rückkehr nach Neumöller allerlei Pläne, die abends am Biertisch eifrig erörtert wurden. Ein Kunterbunt war’s: Eine Überraschung für die liebe Jugend. „Was werden Sie schön aussehen als Prinzesschen Wunderhaar, Fräulein Linden? Eine ‚klassische Reihe’: ‚Kabale und Liebe’, die ‚Räuber’, ‚Egmont’, ‚Iphigenie’ – “
„Na, na,“ machte Basser. „Es wächst der Mensch mit seinen höheren Zielen.“
„ – ein Stück von Kotzebue, dessen Wahl noch nicht feststand, ‚Der Biberpelz’ von Gerhard Hauptmann, ‚Alt-Heidelberg’ von Meyer-Förster, ‚Nora’ von Ibsen – und ‚Der Raub der Sabinerinnen’.“
„Den Direktor Striese kann der Alte selber spielen, das muss er vorzüglich machen!“ erklärte heimlich Herr Swarte, der noch immer Geduldete, der „Volontär“, wie er bei der Truppe hieß, da er auf Gehalt verzichtet hatte.
Ein Kunterbunt also, oder auch eine Blütenlese, wie man’s nehmen wollte.
Und dann kam eines Tages der Herr Direktor auf die Probe, zog einen Brief aus der Tasche und kündete orbi et urbi: „Das Neueste, Herrschaften! Am fünfzehnten und sechzehnten nächsten Monats erweist und Herr Hofschauspieler Edgar Maurer, die Ehre, bei uns zu gastieren. Sie wissen: Edgar Maurer, mein großer Schüler! Er wird den Prinzivalli in der ‚Monna Vanna’ geben, Fräulein Linden die Monna – bitte, sorgen Sie für einen schönen Mantel – und den ‚Cyrano’, Fräulein Linden die Roxane! Große Anforderungen an uns, meine Herrschaften, aber wir werden ihnen Ehre zu machen wissen!“
Die Monna Vanna! Die Roxane!
Es klang ganz eigen in Dorothea auf. Die Erinnerung kam zurück an die Stunde, da sie Edgar Maurer zuerst gesehen. Vier, fünf Monate lagen nur dazwischen, aber sie dünkten sie fast eine Ewigkeit, soviel des Erlebens hatten sie ihr gebracht. Und in all diesem wechselreichen Leben war das Bild Edgar Maurers allmählich verblichen. Nun stand es wieder greifbar deutlich vor ihr: wie er in das Zimmer getreten war, an der Seite des Intendanten, wie ihre Blicke sich zuerst begegneten, und wie im gleichen Moment sie das seltsame Gefühl durchzuckt hatte: dieser Mann wird in deinem Leben noch eine Rolle spielen!
Man probte Sudermanns „Heimat“. Sie gab die Magda. Das Stück sagte ihr nicht sonderlich zu, sie empfand zu deutlich die leere Theatralik in ihm. Aber die Magda war nun einmal eine „Bombenrolle“, wie der Direktor sagte, und sie versprach sich Erfolg von ihr. So manches ließ sich in sie, die Offizierstochter, verflechten, was auch eigenes Erleben war. Heute freilich, auf der Probe, konnte sie gar nicht recht bei der Sache sein. Fast zum ersten Male grollte der „Alte“ mit ihr.
Und auf dem kurzen Wege zum Hotel gingen ihre Gedanken mit ihr: Edgar Maurer – sie sollte mit Edgar Maurer zusammen spielen! Die Monna Vanna! Die Roxane!
Sie musste ihm dankbar sein. Er hatte ihr auch hier die Wege geebnet. Ohne jeden Zweifel. Ohne sein Fürwort hätte es Reesemann gar nicht gewagt, sie gleich in ersten Rollen auftreten zu lassen. Und wenn er jetzt kam – sie fühlte es – so kam er nur ihretwegen.
Ihr Herz schlug nicht dabei. War ihr doch überhaupt, als sei ihr Herz tot. Aber ein inneres Beben war in ihr: Wie wirst du dich neben ihm halten? Wie wird er dich nun beurteilen? Kam er, um sich zu überzeugen, ob sie seiner Empfehlung Ehre machte? Weshalb kam er sonst?
So, ganz eingesponnen in den einen Gedankenkreis, trat sie in das Hotel. Und immer aus demselben Ideengang heraus fiel ihr ein, dass der Direktor gestern Abend die Agenten-Zeitung im Lesezimmer hatte liegen lassen. In ihr aber standen gewöhnlich die Mitteilungen über die Gastspielreisen der großen Künstler. „Ich will doch einmal nachsehen“, dachte sie.
In dem kleinen Leezimmer saß nur ein einzelner Herr, den Rücken der Tür zugewendet. Ohne ihn zu beachten, ging Dorothea an den Mitteltisch und suchte in den dort aufgestapelten Zeitschriften. Doch da wandte der Fremde den Kopf, sprang auf –
Es war Ludolf Kastrop.
Das Blut flammte ihr ins Gesicht. Ihr erster Gedanke war: Kehrtmachen, fort! Aber dann trotzte es in ihr auf; Nein! Fliehen? Warum denn ? Wahrlich, sie hatte keine Veranlassung dazu! So warf sie mit einer beabsichtigt hochmütigen Bewegung den Kopf zurück und griff wieder nach den Zeitungen. Will der Herr Baron von Kastrop ein Tänzlein wagen – mag er’s nur sagen – ich spiel ihm auf!
Auch über sein Gesicht war eine helle Röte geflogen. Nun stand er einen Augenblick starr vor ihr, auf der anderen Seite des schmalen Tischs, machte ihr dann eine respektvolle Verbeugung, die sie völlig ignorierte.
Er schien etwas sagen zu wollen und fand wohl doch nicht das rechte einleitende Wort. Seine Hand lag auf der Tischplatte, und Dorothea konnte, ohne aufzublicken, sehen, wie sie ganz leicht, erregt und unruhig vibrierte. Aber sie sah noch etwas andres, sah an dem einen Finger den roten Karneol, den Wappenring mit den drei Bällen im Schilde. Oh, wie sie einst die Hand des andern zärtlich gestreichelt und fest, so fest umspannt hatte, die Hand des andern, die den gleichen Wappenring trug!
Es war noch ein kurzes Schweigen zwischen ihnen.
Dann schien er sich gesammelt zu haben, Er sprach langsam und schwer: „Ich bitte um Verzeihung, wenn ich mich selbst vorstelle – Ludolf Kastrop.“
Sie rührte sich nicht, sah nicht auf, gab keine Antwort.
„Gnädiges Fräulein, ich kam hierher, nur, um Sie um eine Unterredung zu bitten.“
Noch immer schwieg sie. Aber in ihrer Seele wuchs das Weh: wie klang doch seine Stimme der des andern – des andern, den sie so innig geliebt hatte, gleich! Und in ihrer Seele wuchs der Hass.
„Gnädiges Fräulein, ich war verreist. In Ihrer Heimat war ich. Ich habe erst dort erfahren, dass sich hinter Ihrem Theaternamen Fräulein von Lindenbug verbirgt.“
Die Zeitungsblätter knisterten in ihren Händen.
Ein paar Augenblicke zögerte er, schien zu warten, stand mit zusammengepressten Lippen. Dann fragte er: „Darf ich nicht um eine Antwort bitten, gnädiges Fräulein?“
Da stieß sie kurz hervor: „Sie haben mich ja gar nicht gefragt, und ich habe Ihnen nichts zu sagen, Herr von Kastrop!“
Sie sah ihn wieder nicht an, aber sie sah, wie seine Hand auf der Tischplatte noch stärker vibrierte, als vorhin. Die ganze Erregung des Mannes verriet sich in diesen knappen, gewaltsam niedergehaltenen Bewegungen. Dorothea triumphierte innerlich: so mochte er doch leiden! Wenn Ludolf Kastrop überhaupt nicht zu leicht oder zu brutal für seelisches Leid war!
Auch seine Stimme bebte jetzt. „Vielleicht haben Sie dem Schein nach recht, gnädiges Fräulein – ich fragte nicht. Aber ich bat – ich bat Sie um eine Unterredung.“
„Und ich sagte Ihnen schon, dass ich Ihnen nichts zu sagen hätte. Genügt das nicht?“
„Nein, gnädiges Fräulein. Es genügt mir nicht.“
Ohne ihn wieder anzusehen, blickte sie nach der Tür. Das wollte sie doch nicht, dass irgendein Unberufener das seltsame Gespräch belauschte. Aber auch das Nebenzimmer war leer. Um diese Stunde war wirklich kaum eine Störung zu befürchten. So zog sie wie verächtlich die Achseln hoch und sagte: „Wenn es denn sein muss – ich höre!“
Aber nun sprach er nicht gleich. Vielleicht suchte er wieder nach dem passenden Einleitungswort; vielleicht musste er erst ihren fast höhnischen Ton überwinden. Vielleicht, dachte sie, gereut’s ihn schon. Nun dann – desto besser.
Doch da begann er, und wieder schnitt ihr der Tonfall seiner Stimme ins Herz. Ja, sie glich der Stimme des andern. Aber sie glich ihr so, wie auch die Gesichtszüge der beiden sich glichen. Die Liebenswürdigkeit des Klanges fehlte, wie in dem edel geschnittenen Gesicht das Herzgewinnende. Herb war sein Organ.
Dabei sprach er nur halblaut, gedämpft; aber man fühlte: diese Stimme war des Befehlens mehr gewohnt als der Liebesworte.
Und auch was er sagte, war nicht dazu angetan, sich in ein weibliches Herz einzuschmeicheln.
„Ich bin etwas ungelenk, gnädiges Fräulein“, sagte er, und sie sah, dass nun plötzlich die nervige Rechte ganz fest und still lag. „Sie müssen einige Nachsicht mit mir haben. Ich habe mein Leben lang mich nicht um Frauengunst bemüht. So habe ich Sie vielleicht verletzt, ohne es zu wollen. Wahrhaftig, ohne es zu wollen. Ich – ich weiß selber nicht, was über mich gekommen ist, seit ich Sie zum ersten Male gesehen habe. Dagegen angekämpft habe ich – ich muss Ihnen auch das ehrlich gestehen. Aber es war vergebens. Dann – dann habe ich mich nach Ihnen erkundigt – “
„Wollen wir diese Unterhaltung nicht doch lieber abbrechen?“ sprach sie scharf dazwischen. Es war ein unwiderstehliches Verlangen in ihr, ihn zu verletzen, ihn mit Hohn zu überschütten – diesen Mann, der ihr ins Gesicht zu sagen wagte, dass er es für nötig erachtet hätte, sich „nach ihr zu erkundigen“. Sie zog wieder hochmütig die Achseln hoch: „Ich finde dieses Gespräch sehr wenig reizvoll für uns beide.“
Aber da klang in seiner Stimme ein neuer Ton auf, etwas Herrisches, Scharfes, Metallisches: „Nein – ich bin gewohnt, zu beenden, was ich mir vornahm. Mit ihrer Erlaubnis werde ich weitersprechen. Ich hoffe, dass Sie, gnädiges Fräulein, unter einem angenommenen Namen auftreten. Ich erfuhr, wo Sie zuletzt gelebt – “
„Sehr interessant. In der Tat, Herr von Kastrop.“
„ – so reiste ich nach Blankenburg, dann nach Gemar – “
Er unterbrach sich plötzlich. „Sie wissen gewiss, dass mich mein unglücklicher Bruder von allem unterrichtet hat.“
„Wie sollte ich nicht?“ Wir hatten keine Geheimnisse voreinander.“
Zum ersten Male sah sie auf und ihn an, voll, mit leuchtendem Auge. Es währte einige Sekunden, bis er fortfuhr: „Vielleicht – erfuhren Sie doch nicht alles.“
„Schmähen Sie den Toten nicht!“
„Das sei ferne von mir. Aber das darf ich sagen: ich verstehe erst jetzt vieles, was mir damals zu verstehen versagt blieb.“ Er hatte seine Selbstbeherrschung zurückgewonnen und sprach ruhig weiter. „Vielleicht hätte ich anders gehandelt, wenn ich Sie gekannt hätte, gnädiges Fräulein.“
„Sehr gütig – nur bedauerlich, dass diese Erkenntnis zu spät kommt. Es liegt eine Kleinigkeit dazwischen: der Tod!“
Wieder war ein Schweigen zwischen ihnen, als ob die Majestät des Todes auch ihnen die Fäden zur Gegenwart zerrissen hätte.
Aber Dorothea hatte den Kopf nicht wieder gesenkt. Ihre Augen hafteten auf seinem Gesicht. Und es war neben aller Bitterkeit nun doch auch eine eigene Spannung in ihr: was wollte dieser Mann von ihr? Anfangs hatte sie geglaubt – wie sollte sie anders -, dass er ihr, der Schauspielerin, eine Liebeserklärung machen würde. Daraufhin hätte sie zu antworten gewusst.
Aber das Ziel, das sich dieser seltsame Mensch gestellt zu haben schien, ging doch wohl auf ganz etwas anderes hinaus. –
Während sie so zu ihm hinübersah, empfand sie, dass etwas Neues von ihr Besitz ergriff. Ein unerklärliches Gefühl, das nur aus der Ähnlichkeit der beiden Brüder geboren sein konnte – aus dieser Ähnlichkeit , die Einzelzüge aufzuheben schien und die der Gesamteindruck doch immer aufs Neue weckte und verstärkte. Ihr kam so jäh, dass es sie überrieselte, der Gedanke: „Nein! Hassen kann ich ihn doch nicht! Hassen nicht! Und wenn ich es hundertfach will – ich kann es nicht!“
Und in der kurzen Spanne Zeit des beiderseitigen Schweigens, während sie in diesen energischen Zügen las, die wie aus Erz geschnitten schienen, gestand sie sich noch eins: dieser Mann war keiner von denen, die in schnellem Werben Frauengunst zu erhaschen suchen, keiner von denen, die überall, wo Blumen blühen, die leichtfertige Hand ausstrecken. Nein – ungerecht wollte sie nicht sein! Er blieb in allem übrigen derselbe Ludolf von Kastrop, als den sie ihn von Anfang an eingeschätzt hatte: der harte, karge, herzensarme Mensch, der dem Bruder das Glück seines Lebens versagt, der den Bruder in die Fremde, in den Tod getrieben hatte. Es konnte zwischen ihr und ihm nie eine Brücke geben. Aber das fühlte sie nun: er war eine Persönlichkeit – er war ein Mann!
Was wollte er nur von ihr? Was wollte er?
Da sprach er es aus. Kurz, knapp; eine Bitte, die, wohl ohne dass er sich selber darüber völlig klar war, in einen herrischen Ton gekleidet war.
„Ich möchte Sie bitten, gnädiges Fräulein, der Bühne zu entsagen!“
Im ersten Augenblick sah sie ihn sprachlos, verständnislos an. In Wirklichkeit: sie verstand ihn nicht; die Worte wohl, den Sinn nicht.
Er wartete aber auch keine Antwort ab.
„Sie gehören nicht auf die Bühne. Sie sind zu schade dazu. Eine Dame unseres Standes gehört überhaupt nicht auf die Bretter, die angeblich die Welt und tatsächlich gar nichts bedeuten. Sie erst recht nicht. Denn – schmeicheln ist nicht meine Art – denn Sie haben wohl, außer Ihrer Schönheit, ein starkes Talent, aber Sie sind kein Genie. Schönheit und Talent werden Sie vielleicht bis zu einer gewissen Höhe führen. Dann aber werden Sie stille stehen und werden im Streben nach der Vollendung Ihrer Bühnenkunst verbluten. Davor möchte ich Sie bewahren.“
In ganz kurzen Sätzen hatte er gesprochen, scharf jedes einzelne Wort, wie auf eines Messers Schneide gestellt, betonend, unerbittlich wie sein Gesicht. Kein Muskel hatte in diesen Zügen gezuckt, nur in den Augen war es wie Wetterleuchten, als ob sie sagen wollten: Wehre dich nicht! Ich zwinge dich!
Einmal, zweimal hatte Dorothea empört auffahren wollen. Aber diese Augen hatten sie wirklich immer wieder niedergezwungen. In tiefster Seele fühlte sie sich verletzt, auf das schwerste beleidigt in ihrem Frauenstolz, in ihrem Künstlerstolz. Es schrie in ihr: Was maßt dieser Mann sich an? Was duldest du es? Warum wendest du ihm nicht den Rücken, oder warum lachst du ihm nicht ins Gesicht? Und doch stand sie und stand und fand kein Wort der Erwiderung.
Da sprach er weiter:
„Vergeben Sie meine Offenheit. Ich habe in Gemar genug über Ihre äußeren Verhältnisse erfahren. Ich weiß, dass Sie nicht allein der berühmte innere Drang auf die Bühne zog, weiß auch, dass der Zwang der Umstände Sie zu – gerade zu dieser Truppe führte. Das kann so nicht weitergehen. Ich will es nicht. Nehmen Sie an, wenn es durchaus einer Erklärung bedarf, um meines verstorbenen Bruders willen. Nein, nehmen Sie nichts an, als dass ich es nicht will. Ich bin von Gemar aus zur einzigen noch lebenden Schwester meiner seligen Mutter gefahren, Frau von Zielendorf. Sie ist bereit, sie aufzunehmen, Mehr, sie wird Sie herzlich willkommen heißen. Für alles Übrige lassen Sie mich sorgen.“
Seine letzten Worte gaben den Ausschlag. Mit einem Male fand Dorothea sich selber wieder. Mit einem Male war der Bann gebrochen, den seine übermächtige Persönlichkeit auf sie ausgeübt hatte. Zwang wollte er, und scheute sich nicht einmal, das ganz offen auszusprechen! Zwang gegen ihr Künstlertum, Zwang gegen die Gaben, die ihr der Himmel verliehen! Ihre Freiheit ihr nehmen! Und was bot er ihr dafür? Almosen! Elende Almosen. „Für alles Übrige lassen Sie mich sorgen.“
Es kam eine überlegene Ruhe über sie. Jetzt fühlte sie sich stark, jetzt erst ganz im Recht ihm gegenüber. Der spottbittere Ton stand ihr plötzlich wieder zu Gebote, wie in der ersten Hälfte dieser Unterredung.
Sie hatte wieder ihr hochmütiges Achselzucken. Den Kopf warf sie zurück, und sie konnte lächeln.
„Ich habe mit einer Geduld zugehört, die mich selbst erstaunt, Herr von Kastrop“, sage sie. „Ich will nicht verhehlen, die Neugier reizte mich: die Neugier, Sie doch noch von einer anderen Seite kennen zu lernen, als ich Sie schon kannte. Ich danke Ihnen für die erstaunliche Offenheit, mit der Sie sich auszusprechen beliebten. Ich danke Ihnen für das gütige Interesse, das Sie mir widmeten. Nun – ich danke auch für Ihre Fürsorge – in jeder Form. Ich glaube Sie jetzt zu kennen. Mich aber kennen Sie nicht. Darum sollen Sie es nun wissen: Ich bin zu stolz, ich dünke mich zu gut, Almosen von Ihnen anzunehmen!“
Sie hatte sich hoch aufgerichtet. Sie stand ihm gegenüber in der Haltung einer Königin. Und wie eine Königin einen missliebigen Untertan ungnädig verabschiedet, so schloss sie: „Wir dürften uns nun wohl kaum wiedersehen. Leben Sie wohl, Herr von Kastrop.“
Sprachs mit lächelnden Lippen, neigte ganz leicht das Haupt, wandte sich und ging.
Die Frau Direktor stand hinter dem geschlossenen Kassenschalter und rieb sich die Hände: „Männe, es ist noch nicht dagewesen! Ausverkauft! Hast du schon so etwas erlebt? Und da konnte Schiller trotzdem sagen: „Ach, es geschehen keine Wunder mehr!’“ –
Die Frau Direktor hatte zur Feier des Tages ihr berühmtes Schwarzseidenes angezogen, das, wie Basser gerne behauptete, am Tage ihrer Silberhochzeit zum fünfundzwanzigsten Male umgearbeitet worden war. Und der Direktor, der auf einen Augenblick heruntergekommen war, um sich höchstselbst vom Stande der Abendkasse zu überzeugen, prunkte im schwarzen Überrock, der noch so gut wie neu war – bis auf die Ärmelnähte und eine ominöse Stelle auf der linken Brust, wo für Fürsten- und Ministerrollen die großen Ordenssterne angeheftet werden mussten.
„Wunder? Was Wunder?“ entgegnete er mit einer großartigen Geste. „Mein liebes Kind, du bist zitatenreich. Man weiß das. Es wird gewisslich wahr werden, was Lessing seinen weisen Nathan sagen lässt: ‚Der Wunder höchstes ist, dass und die wahren, echten Wunder so alltäglich werden sollen!’“
„Ausverkauft!“ wiederholte sie noch einmal. „Ich hab’s noch nie erlebt. Ich hätte auch nie gedacht, dass der Name Maurers solche Zugkraft üben könnte.“
Der Direktor lächelte überlegen. „Mein Kind! Maurer ist gut, Maurer ist groß. Doch er ist nur ein Magnet. Er ist der Magnet für das weibliche Geschlecht. Wir besitzen aber noch einen anderen Magneten. Und das ist, beim großen Apoll, das ist Dorothea Linden!“ Er klopfte seiner Frau gnädig auf die Schulter, „Ich sage dir, diese Dorothea ist imstande, selbst die todernsten Philisterseelen dieser Großstadt rebellisch zu machen. Schön war sie, als sie zu uns kam. In jedem Monat aber möchte man sagen: Und sie wird schöner von Tag zu Tag.“
Dasselbe fast, wenn auch mit anderen Worten, hatte heute früh bei der Probe Edgar Maurer zu Dorothea gesagt.
Er war erst am Morgen von Hamburg gekommen. Natürlich musste für die kostbare Zeit des großen Mannes eine Probe genügen. Und auch auf dieser markierte er nur; sie fand eigentlich auch nur statt, damit das Ensemble sich mit seinen Eigenheiten und Eigenmächtigkeiten, mit seinen kleinen und großen „Nuancen“ vertraut machen konnte.
Dorothea hatte diesen Gastspieltagen, hatte der ersten Begegnung mit Maurer in begreiflicher Unruhe, ja sogar mit einer fast peinigenden, nervösen Spannung entgegengesehen. Vielleicht war es nicht nur die Erwartung: Wie wird er sich zu dir stellen? Was wird er dir sagen? Wie wird er über dein Spiel urteilen? – was sie so nervös machte.
In ihr zitterte noch immer die Erinnerung nach an ihr entscheidendes Gespräch mit dem Freiherr von Kastrop. Sie hatte zuerst das Gefühl gehabt, als Siegerin, ganz als die Stärkere, die Überlegenere aus jenem Gespräch geschieden zu sein; aber sie konnte dieses Sieges doch nicht recht froh werden. Nicht dass sie etwas bereute, nicht dass sie ein Wort von dem hätte zurücknehmen mögen, was sie ihm gesagt hatte. Es war ein unsicheres Gefühl der Sorge in ihr – Wie hat er’s aufgenommen? Hat er’s auch recht verstanden? Fasste er’s nicht als Phrase, als Theaterpose auf, was du ihm gesagt und wie du’s ihm gesagt hast? Und es war auch noch ein andres empfindliches Gefühl der Unsicherheit dabei: Warst du wirklich ganz echt in deinem Hass, warst du nicht, wenn auch nur unbewusst, ein wenig die Bühnenkünstlerin, die Schauspielerin, die anstatt ihre menschlich echte Entrüstung herauszusprudeln, sich einen wirkungsvollen „Abgang“ bereiten wollte?
Sie war sehr nervös geworden, so nervös, dass die gute Minna oft ihren grauen Kopf schüttelte und dann und wann mit ihrem geliebten, aber mit Abscheu zurückgewiesenen Hausmittelchen, dem Fläschchen mit Baldriantropfen, ankam. Jedesmal lachte dann Dorothea: „Kaffee, liebe Minna, Kaffee, so stark, dass der Löffel in der Tasse stehen bleibt! Mit deinen Tröpfchen kann man nicht studieren – und ich muss – ich muss –“
Ich muss –
Was sie musste, sagte sie aber nicht. Minna hätte es doch nicht verstanden: Ehre einlegen vor Edgar Maurer!
Die vereinigte Direktion – Herr und Frau Reesemann hatte den berühmten Schauspieler von der Bahn abgeholt und in den „Schwarzen Raben“ begleitet. An der Seite des Direktors betrat er die Bühne.
Liebenswürdig ist er nicht, war die Empfindung Dorotheas. Er grüßte die Mitwirkenden fast hochmütig, knapp und kurz – gnädig. Er sah über sie hinweg – es hatte den Anschein, er wollte nur Dorothea sehen. Auf sie kam er dann auch gleich zu, vor ihr verbeugte er sich, ihr küsste er die Hand, nicht wie ein Kollege, sondern ganz als eleganter Kavalier. Und doch auch wieder nicht ganz ritterlich, denn er sagte nach den ersten Begrüßungsworten so laut, dass es auch die Nächststehenden hören mussten: „Wie schön Sie geworden sind, gnädiges Fräulein, weit schöner noch sind Sie, als ich Sie in der Erinnerung habe!“
Das Blut strömte ihr in das Gesicht –
Da hatte er sich auch schon umgewandt. „Wenn es Ihnen recht ist, Herr Direktor, fangen wir gleich an.“ –
Dorothea war von der Probe enttäuscht zurückgekommen. Maurer hatte das Ganze fast wie ein lästiges Geschäft abgemacht. Nur einige Male war Maurer lebhafter geworden, fast stets bei kleinlichen Anlässen, aber immer dann, wenn er seine Persönlichkeit besonders in den Vordergrund gerückt wissen wollte. „Ich wünsche das so!“ – „Bitte hier stummes Spiel, bis ich zu sprechen anfange!“ Jedesmal hatte der „Alte“ lächelnd genickt: „Natürlich – sehr richtig – ganz besonders fein – “
Aber Dorothea war nicht nur enttäuscht, sie war empört. Dieser Herr Maurer setzte sich über die einfachsten Begriffe der Kollegialität in selbstherrlicher, abstoßend egoistischer Weise hinweg. Nicht ihr gegenüber; da war er von der ausgesuchtesten Liebenswürdigkeit. Aber sonst gab er sich mit einem Selbstbewusstsein, dass Dorothea sich oft wunderte, wie die Kollegen sich so etwas bieten lassen konnten. Ein einziger hatte einmal im dritten Akt zu opponieren gewagt: Sickel, der den Guido Colonna spielte. Es hätte fast eine Szene in der Szene gegeben, wenn der Direktor nicht vermittelnd dazwischen gesprungen wäre.
So kam der Abend heran. Die Vorstellung brachte Dorothea einen völligen Umschwung ihrer Stimmung. Maurers Spiel riss sie vollkommen mit sich fort. Er hatte nicht das wundervolle Organ Sickels, aber er entwickelte ein geradezu stürmisches Temperament, das aber die Grenzen künstlerischer Mäßigung nie überschritt. Ohne Zweifel: er war ein begnadetes Genie. Zum ersten Male spielte sie mit einem wahrhaft großen Schauspieler, der nicht wie der arme Sickel eine schon halb gebrochene Kraft, sondern im Vollbesitz der herrlichen Gaben war, die ein Menschendarsteller haben kann. Es war ein seltsamer, oft freilich auch ein atembeklemmender Genuss. Sie fühlte sich durch ihn zu nie erträumten Höhen emporgetragen. Sie empfand, zumal in der großen Szene des zweiten Aktes, wo sie, mit dem langen Mantel bekleidet, in seinem Zelte erschien, vor dem Gewaltigen, den die Liebe dann weich macht und zart – sie fühlte sich selber wachsen. Und sie war wie in einem Rausch, als Maurer ihr am Schluss die Hand drückte und sagte: „Das haben wir beide gut gemacht!“ –
Dann kam wieder die Enttäuschung.
Die hohe Direktion gab nach der Vorstellung im „Schwarzen Raben“ dem großen Gast ein bescheidenes Fest, zu dem die ersten Mitglieder eingeladen waren. Und hier gab sich Edgar Maurer wieder ganz als der „Maurenweiler“, nach dem Vorbild jenes Virtuosen, der überall, wo er gastierte, eine Notiz in die Zeitung lancierte: „Der berühmte R. R. weilt seit heute früh acht Uhr in unsern Mauern.“ Er ließ sich alle Huldigungen gefallen mit einem geradezu verletzend impertinenten Lächeln, er erzählte von seinen Erfolgen, er zeigte sich als selbstbewusster Egoist.
Sickel fehlte. „Nun, Direktorchen, wo ist denn unser ‚Colonna’ von heute Abend? Sitzt wohl wieder allein beim Fläschchen?“
Selbst den Direktor verletzten diese rohen Anspielungen. „Verehrter, lassen Sie doch den armen Sickel in Ruhe!“ bat er.
„Was tu‘ ich denn dem ‚armenֹ’ Sickel?“ lachte Maurer. „Der hat sich sein Leben lang immer nur selber verwundet. Ich bin nur erstaunt, dass Sie es immer noch mit ihm aushalten.“
„Sie wissen doch, lieber Maurer, welch tüchtige Kraft er ist, wenn – er gesund ist.“
„Gesund! Ja – wenn er gesund ist! Ganz leidlich – geht so mit durch. Aber wenn er – krank ist, dann schmeißt er jede Vorstellung um. Ich habe das doch oft genug erlebt. Sie noch nicht, gnädiges Fräulein? Noch nicht diese Qual für jeden Kollegen, der an solchen Abenden mit ihm agieren muss!“
Dorothea raffte sich auf. „Ich habe nur Mitleid mit dem Unglücklichen –“ Sie zögerte ein wenig. Dann fuhr sie fort: „Ich habe Herrn Sickel stets als einen vornehm denkenden Mann kennen gelernt.“
Ein scharfer Blick traf sie. „So, so? – Vornehm!“ entgegnete Maurer und wechselte schnell das Gesprächsthema. Er sprach jetzt von seinem Wirkungskreis, sprach von Anerbietungen, die ihm von Wien bis Berlin aus gemacht worden wären. Aber während er sprach, wandte er kaum ein Auge von Dorothea. Es lag etwas eigen Forschendes, Suchendes in seinen Blicken, das ihr bisweilen das Blut in die Wangen trieb. Sie war schließlich froh, als man aufbrach.
Der Zufall fügte es, das das Direktorpaar mit ihr bis zu ihrer Wohnung ging. Zuerst schwärmte der Direktor von Maurer, lobte auch die Monna Banna des heutigen Abends. Dann sagte er, zu seiner Frau gewandt: „Vergessen kann Maurer doch nichts! Einen Hass – geradezu einen Hass – hat er auf unsern armen Sickel – “
Frau Reesemann nickte. „Ja – die Männereitelkeit! Wie heißt’s doch: ‚Wenn die Weiber nicht eitel wären – die Männer könnten sie’s lehren!“ Darüber kommt Maurerei nun mal nicht fort, dass die kleine Gegori damals den Sickel ihm vorzog – und eigentlich sollt‘ er ihm auf den Knien dankbar sein. Denn wer weiß, was Maurer geworden wäre, wenn nicht Sickel, sondern er die Gegori geheiratet hätte. Ja – so,“ fuhr sie fort. „Sie wissen von der ganzen Geschichte wohl gar nichts, Fräulein Linden?
Um es kurz zu sagen: die kleine Dora Gegori war damals Naive bei uns, eine unbedeutende Schauspielerin, aber ein bildhübsches Mädel. Maurer und Sickel allen beiden hatte sie den Kopf verdreht, aber Maurer war noch Anfänger, Sickel galt schon als Kraft – na ja, und so gab sie dem den Vorzug. Ein Jahr sind sie verheiratet gewesen, und für den armen Sickel war’s die Hölle auf Erden. Bis sie ihm dann durchging – und da war’s zu spät, als dass er sich noch wieder hochbringen konnte. Man soll sein eigenes Geschlecht nicht schmähen. Aber manchmal möchte‘ man doch mit dem alten Raupach denken: ‚Wie mancher große Geist ging unter schon in eines Weibes Armen.’ – Und nun, gute Nacht, Fräulein Linden! Morgen ist auch noch ein Tag – und ich bin neugierig auf Ihre Roxane.“
Das also war es! Eifersucht, die nicht vergeben und nicht vergessen kann. Er war so groß in seiner Kunst, und als Mensch doch so unsagbar klein. –
Dorothea wurde den einen Gedanken nicht los, und ihr graute vor der morgenden Komödie fast so sehr, wie sie sich vorher auf den Cyrano von Bergerac gefreut hatte und auf die dankbare Rolle der Roxane darin. Es schmerzte sie, dass sie Edgar Maurer menschlich so gering abwägen musste, und es verdross sie, dass sie diesen Schmerz so tief empfand. Was ging sie schließlich der Mensch in Edgar Maurer an? Sie hatte ja doch nur mit dem genialen Künstler zu tun.
Am Vormittag des nächsten Tages, etwa eine halbe Sunde vor der Probe – Dorothea saß noch mit Minna am letzten Ausputz des koketten Rokokokleides – klingelte es. Die gute Minna warf die Spitzen, die den Ausschnitt des Kleides einsäumen sollten, beiseite. „Es wird der Briefträger sein –“ Minna träumte immer von einem phantastischen Briefe aus Nirgendwoland, der ihrem gnä‘ Fräulein irgendeine besonders gute Botschaft bringen sollte.
Es war aber Maurer. Dorothea erkannte schon auf dem Flur seine Stimme im Gespräch mit Minna, die ihn nicht einlassen wollte.
Das Blut schoss ihr ins Gesicht.
Dann stand er mit einem Male auf der Schwelle, Minna beiseite schiebend, mit lachenden Mienen, einen Strauß Rosen in der Hand.
„Guten Morgen, gnädiges Fräulein! Ich musste Ihnen doch meinen Besuch machen. Haben Sie aber eine gestrenge Oberhofmeisterin.“
„Sie werden begreifen, Herr Maurer, dass ich keine Herrenbesuche annehme, “ gab Dorothea etwas förmlich zurück, reichte ihm aber zugleich die Hand. Und dann sagte sie lächelnd: „Es gibt natürlich Ausnahmen – oder richtiger, ich konstatiere hiermit eine Ausnahme.“
„Gehorsamsten Dank. Ich hatte wirklich das lebhafteste Bedürfnis, mit Ihnen ein paar Worte, fern vom Beruf, zu sprechen, gnädiges Fräulein. Unter den Augen der guten Neeseleute ist das unmöglich, von den andern – Kollegen“ – er dehnte das Wort spöttisch -„ganz zu schweigen.“
„Wir haben wenig Zeit bis zur Probe –“
„Dann werden die Herrschaften eben warten –“
Dorothea bat, Platz zu nehmen, und gab Minna ein Zeichen, sie allein zu lassen.
Edgar Maurer war so völlig Weltmann, dass die Situation ihr Peinliches sofort verlor. Es schien wirklich, als wäre er nur aus Artigkeit, aus Höflichkeit gekommen. Er plauderte, wie man eben bei einem Besuch plaudert, nur dass seine Augen bisweilen mit einem ein wenig neugierigen, ein wenig spöttischen Ausdruck durch das Zimmer zu wandern schienen. Von Exzellenz Rakolski erzählte er, und auch von der Frau Intendantin und ihren Möpsen Liddy und Piddy mit den rosenroten und den stahlgrünen Halsbändern. Es war Dorothea, als ob damit Bilder aus einer Welt vor ihr auftauchten, der sie längst, längst fremd geworden war. Aber diese Erinnerungsbilder, die sie zuerst lachen machten, gruben ihr auch wieder die tiefe Einsamkeit in die Seele, in der sie eigentlich in den ganzen letzten Monaten gelebt hatte. Sie lösten etwas wie Sehnsucht in ihr aus – nach der großen Welt da draußen.
Er sah wohl, dass ihr schönes Gesicht ernst und ernster wurde.
Und plötzlich wechselte er auch den Ton.
„Nun noch ein offenes Wort, gnädiges Fräulein! Wahrscheinlich haben sie selber geahnt, dass ich nicht die Sehnsucht nach den schönen Augen der Frau Direktor Neesemann nach hier trieb und nicht das enorme Gastpielhonorar. Ich wollte mich persönlich überzeugen, wie Sie vorwärtsgekommen sind, denn ich – wahrhaftig – ich fühlte etwas wie eine starke Verantwortlichkeit für Ihre Zukunft in mir. Nun – ich brauche den heutigen Abend nicht abzuwarten, der gestrige genügt mir. Ich gestehe Ihnen, dass ich auch mit dem guten Neesemann über Sie gesprochen habe; in ihm lebt nur der eine Wunsch, Sie sobald nicht zu verlieren. In dieser Beziehung freilich wird ihm nicht zu helfen sein.“
Er sprach jetzt ganz sachlich, fast wie geschäftlich. Aber es klang doch auch warme Teilnahme aus seinen Worten.
Dorothea saß ihm schweigend gegenüber. Ihre Hände hatten unwillkürlich nach den Spitzen gegriffen, die neben ihr lagen. Sie zog sie mechanisch durch die Finger. „Das ist nun wieder eine Schicksalsstunde,“ dachte sie, und sie empfand, wie damals im Zimmer des Intendanten: dieser Mann ist berufen, in deinem Leben eine Rolle zu spielen, nur dass so gar keine rechte Freude diesem Empfinden beigemischt war –“
Maurer hatte eine kleine Pause gemacht. Vielleicht wartete er auf ein Wort des Dankes oder der Anerkennung. Aber sie neigte nur ganz wenig den Kopf.
So begann er denn wieder: „Sie dürfen selbstverständlich hier nicht länger bleiben als unbedingt nötig ist. Das, was Direktor Neesemann bieten konnte, haben Sie jetzt schon, überraschend schnell, erworben: das Überwinden der Scheu vor der urteilslosen Masse, die äußere Routine, die Erweiterung Ihres Repertoires – ich kann mir lebhaft vorstellen, wie die hohe Direktion Sie ausgenutzt hat. Ich sehe es Ihnen auch an. Ich lese in Ihrem Gesicht die über dem Rollenstudium durchwachten Nächte – mein Gott, ich habe das ja auch alles durchgemacht, und es bleibt niemand erspart, der vorwärts will. Wer die Kraft nicht besitzt, es zu überwinden, der bleibt eben in der flachen Ebene, in der Niedrigkeit, wie – doch ich will keine Namen nennen.“
Wieder unterbrach er sich auf die Länge einiger Atemzüge. Wieder ruhte sein Auge forschend auf ihr.
„Also,“ fuhr er dann fort, „also zum Frühjahr müssen Sie fort. Ich könnte Sie nun wohl direkt nach Gemar bringen, es läge ja nahe und – so weit reicht mein Einfluss schon. Aber mir will es besser scheinen, wenn wir ein kurzes Übergangsstadium dazwischenschieben. Sie müssen sich erst ein wenig in etwas größere Verhältnisse gewöhnen. Ich habe an irgendeines der besseren Stadttheater gedacht, und da ich sowieso von hier nach Berlin fahre, werde ich mit meinem Agenten sprechen. Sie wissen, der gewaltige Karl Oskar Braune. Es wird dann am besten sein, Sie stellen sich nach Ablauf Ihres hiesigen Engagements ihm selber vor. Dass ich den Boden gut vorbereiten werde, darauf können Sie sich verlassen. Nun müssen wir aber wohl wirklich gehen –“
Damit stand er auf. Er streckte ihr die Hand hin. „Einverstanden?“
Diesmal fühlte sie deutlich: Du musst ihm danken.
„Wie sollte ich nicht, Herr Maurer. Und innigen Dank für all Ihre Güte – “
Die Worte kamen etwas schwer von ihren Lippen.
„Aber ich bitte Sie –“
Einen Augenblick hielt er ihre Hand in der seinen. Er sah sie an, lächelnd und wie mit einem leichten, vielleicht einem leichtsinnigen Überlegen. Dann aber beugte er sich und küsste ihr die Hand.
Dann gab es unten vor der Haustür noch einen peinlichen Moment.
Dorothea sah erst jetzt, dass er im Wagen, dem „einzigen“ Lohnwagen Neumöllers, gekommen war. Er ging wie selbstverständlich auf diesen zu und öffnete den Schlag: „Bitte, gnädiges Fräulein –“
Kaum saßen sie, so begann er wieder zu plaudern. Aber diesmal heiter und – von der heutigen Vorstellung.
„Ich liebe diesen köstlichen Cyrano, diesen romantischen Gesellen. Und ich freue mich auf Ihre Roxane. Hoffentlich – nein – gewiss geben Sie ihr eine recht preziöse Note. Eigentlich kann nur eine fein gebildete Frau diese Rolle gut spielen, darum bat ich Neesemann, den Cyrano zu geben. Dieser poetische Raufbold mit der Riesennase, diese zierliche Roxane erfordern ein Studium ihrer Zeit. Wer ist denn sonst heute beschäftigt? Wer gibt den Zuckerbäcker Raguenau?“
„Herr Basser.“
„Vielleicht nicht übel. Und Ihren getreuen Christian?“
„Herr Sickel.“
„Ah – ich hätte es mir denken können. Ein Glück, dass auch dieser Christian schon im vierten Akt sterben muss.“
Es kam wieder so scharf, so höhnend heraus.
Dorothea drückte sich ganz in ihre Wagenecke, als wollte sie sich körperlich so weit als möglich von Maurer entfernen. Sie schüttelte unwillkürlich den Kopf.
Da sagte er, plötzlich wieder ernst werdend: „Ich sehe wohl, dass Sie sich wundern, gnädiges Fräulein. Vielleicht bin ich auch ungerecht gegen Sickel. Aber – nun, man wird Ihnen wahrscheinlich den Klatsch, der sich um seine und meine Person gewunden hat, nicht vorenthalten haben, aber es verknüpft sich mit ihm die Erinnerung an eine der bösesten, vielleicht sogar an die böseste Episode meines Lebens. Eine Erinnerung, die in mir immer aufs Neue die Ablehnung wachruft gegen jeden und jede, die nicht Diener und Dienerin unsrer Kunst sind, sondern Knechte. Dann nennt man mich hochmütig. Wahrscheinlich kommt die Zeit, wo man auch Sie so nennen wird.“
Mühsam raffte sie sich auf. „Herr Sickel ist so unglücklich. Können Sie denn nicht vergessen?“
„Nein!“ gab er schroff zurück. „Dies ist es ja gerade –“
„So seien Sie wenigstens mitleidvoll! Seien Sie nicht hart!“
Er sah vor sich hin. Dann sah er sie an und sagte: „Ich will es versuchen, weil Sie mich darum bitten, gnädiges Fräulein.“
Da hielt auch schon der Wagen.
Edgar Maurer hielt Wort.
Die Probe verlief glatt und ohne Anstoß. Dorothea konnte gar nicht recht bei der Sache sein, ihre Unterredung mit Maurer zitterte allzu stark in ihr nach, und er – nun, er spielte ohne Anteilnahme, gerade, dass er den Mitwirkenden die nötigen Schlagworte hinwarf.
Und dann, bei der Vorstellung, war es wieder wie gestern. Seine große Kunst, seine Leidenschaft, sein sorgsames Herausarbeiten aller Nuancen riss das ausverkaufte Haus zu jubelndem Beifall fort.
Es ging alles ganz glatt bis zum vierten Akt; auch Dorothea fühlte sich wieder auf der Höhe ihrer Aufgabe; sie sah reizend aus und fand lebhaftesten Beifall.
Im vierten Akt – im Lager der Gascogner Kadetten vor der belagerten Festung Arras – war Sickel merkwürdig zerstreut. Als Roxane auf die Bühne trat, von Raguenau gefolgt, mit dem großen Korbe voll leckerer Speisen, fiel ihr sein verändertes Wesen auf. Er war nicht etwa in der Gewalt des Weines – oh nein! Aber er folgte doch nur mühsam. Ein paar Male verfehlte er das Stichwort. Bisweilen sah er starr, wie ganz in sich versunken, vor sich hin. Dann raffte er sich wieder empor.
Den letzten Teil seiner Rolle, nachdem er erkannt, dass Roxane, die er sich ja nur durch Täuschung errungen hat, eigentlich nicht ihn liebt, sondern den geistvollen Dichter, den Gascogner, dessen Verse er als die seinen ausgab – diesen letzten Teil spielte er sogar hinreißend. Und als ihn dann beim Angriff der Feinde die erste Kugel traf, als Cyrano sich über ihn neigte, ihm versichernd, dass schließlich Roxanens Liebe doch nur ihm gegolten – da hatte er einen wahrhaft großen Moment. Er war so trefflich, dass Maurer nach dem Aktschluss ganz aufrichtig zu Dorothea sagte: „Ich hätte es nicht für möglich gehalten – Sickel gab wirklich etwas wie ein Stück Leben. Es ist doch ewig schade um den Mann.“
Während des letzten Aktes, der, vierzehn Jahre später im Klostergarten der Nonnen vom heiligen Kreuze spielend, die große Szene zwischen Roxane und Cyrano bringt, hatten beide – Dorothea und Maurer – mehrere Mal die Empfindung, dass hinter den Kulissen irgend etwas Ungewöhnliches vorgehen müsse. Sie hörten hastiges Laufen, hörten erregt raunende Stimmen. Aber sie konnten, sie durften ja nicht darauf achten, und beide standen auch bald so völlig im Banne der Gestalten, die sie zu verkörpern hatten, dass jene Empfindung auslöschte. Dorothea zumal fühlte wieder ganz die Wonne, als Partnerin des großen Meisters wirken zu dürfen. Es kam helle Begeisterung über sie.
Und als dann der Vorhang fiel, als draußen das Haus jubelte, wunderten sie sich, dass Neesemanns beliebtes Wort: „Der Vorhang hoch – die Fetzen hoch!“ ausblieb. Sie standen ein paar Sekunden wie betäubt – harrend, um den immer stärker werdenden Herausrufen Folge zu leisten. Endlich hob sich der Vorhang – wie müde kroch er empor – senkte sich wieder und stieg noch einmal hoch. Aber dann, als er wieder niedergesunken war, war plötzlich der Direktor neben ihnen, und sie lasen beide sofort in seinem ganz verstörten Gesicht, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Nur mit Mühe brachte er hervor: „Lasst sie weiter klatschen! – Der Vorhang bleibt unten. Kinder, erschreckt nicht! – Sickel ist tot!“
In der Garderobe hatten sie ihn auf dem schmalen Sofa gebettet. Er lag wie ein Schlafender.
Tief erschüttert umstand ihn die kleine Künstlerschar.
Am schwersten ergriffen schien Edgar Maurer. Sein Gesicht war totenblass, als wäre der letzte Blutstropfen zum Herzen zurückgeebbt; er starrte, mit glanzlosen Augen, die Lippen fest aufeinander gepresst, auf den Toten.
Die Frauen weinten. Auch Dorothea schluchzte. Es war zu furchtbar, kaum fasslich schien es: draußen auf der Bühne war Sickel den Tod des Komödianten gestorben, und nur wenige Minuten später hatte der Tod ihn wirklich geholt. –
Ein Herzschlag hatte seinem Leben ein Ende gemacht, wie der Theaterarzt konstatierte.
Langsam, schweren Schrittes gingen die Mitglieder, nachdem sie den Theatertand abgetan, dem Städtchen zu. Auch Maurer, er hatte den Wagen fortgeschickt, ging neben Dorothea. Schweigend zuerst. Dann fasste er plötzlich nach ihrer Hand.
„Mein Gott, mein Gott – und ich war so hässlich zu dem Ärmsten!“
„Heute nicht!“ sagte sie weich.
„Wenn ich es heute nicht war, so danke ich das nur Ihnen. Aber meine Seele war nicht minder voll Groll und Bitternis.“
Der Direktor gesellte sich zu ihnen. Er raunte leise: „Im tiefsten Vertrauen – Basser fand ihn zuerst – mit dem Giftfläschchen noch in der krampfhaft geschlossenen Hand. Es hat’s still beiseite gebracht, als guter Kollege. Was brauchte die Welt zu wissen –“
Tief auf stöhnte Maurer.
„ – und in der Brusttasche seines Kostüms hatte er eine kurze Benachrichtigung des deutschen Konsulats in New York. Seine Frau sei dort im schrecklichsten Elend gestorben. Dem Poststempel nach muss der Ärmste den Brief heute Nachmittag erst erhalten haben. Und hat dennoch gespielt. Welch Menschenschicksal –“
„Menschenschicksal – ja! – und Komödiantenlos!“ stieß Maurer heraus. Es war, als schüttelte ihn der Frost. Sie standen schon vor dem „Schwarzen Raben“. Er atmete schwer. Dann sagte er, sich gewaltsam zusammenraffend: „Es hat wohl jeder das Bedürfnis, heute allein zu bleiben. Gute Nacht, Fräulein von Lindenbug!“ Gute Nacht, Direktor! Ich las einmal auf einem alten Grabkreuz: ‚Vollendet ist der Pilgerpfad – wohl dem, der überwunden hat.’ – Gute Nacht!“
„Theater-Vermittlungsgeschäft von Karl Oskar Braune“ so stand unten neben der Haustür auf der glänzenden Metallplatte. Dieselbe Firma stand auf dem Kopf des eleganten Briefbogens, auf dem der Geheime Kommissionsrat Karl Oskar Braune Fräulein Dorothea Linden für Anfang April um ihren Besuch gebeten hatte: „Laut Rücksprache mit Herrn Edgar Maurer und mit der Zusicherung, dass wir Ihnen bestimmte, sehr günstige Offerten werden vorlegen können.“
Der Abschied von dem Kunstinstitut des Herrn Neesemann war Dorothea gegen alles eigne Erwarten merkwürdig schwer geworden. Noch schwerer freilich der hohen Direktion. Der „Alte“ hatte vergeblich gebarmt, hatte sogar von „beträchtlicher“ Erhöhung gesprochen, hatte Dorothea seine „Leuchte“ genannt, um schließlich wehmütig zu klagen: „Es ist schon nicht anders. Kommt mal eine wirkliche Kraft zum alten Neesemann, dann erscheint ihm der Stern nur als Komet. Eine Saison und ade!“ Die gute Frau Direktor hatte wirkliche Tränen in den Augen gehabt. „Wir hatten Sie alle so lieb gewonnen, Fräulein Linden. Wie oft habe ich mit dem Direktor über Sie gesprochen: auf die Linden ist Verlass – immer pünktlich, immer bei der Sache, fleißig, strebsam – aus der wird mal was Großes. Na ja – und habe mir ja immer dabei gedacht: bei uns bleibt sie nicht lange. Aber dass Sie so schnell gehen würden, hätte ich doch nicht erwartet. Aber, nicht wahr, Sie machen es doch auch wie der Maurer und gastieren bald mal bei uns, dass wir nicht zu sagen brauchen, frei nach der Jungfrau: Dorothea ging, und nimmer kehrt sie wieder!“
Ihr Benefiz hatte sie gehabt – zum Abschied. Und der „Alte“ hatte dazu die „Iphigenie“ herausgebracht – endlich! „Neu einstudiert!“ „Mit gänzlich neuen Dekorationen und gänzlich neuen Kostümen!“ Dass die beiden letzten Versprechungen nicht „gänzlich“ der Wahrheit entsprachen, tat nichts. Neumöller nahm es nicht so genau. Aber ganz Neumöller bewies an dem Tage, dass in dem Städtchen samt Umgebung mehr geistiges Leben und Interesse an den Klassikern war, als die hohe Direktion je vermutet hatte; oder dass Dorothea sich einer größeren Verehrung erfreute, als sie selber je zu hoffen gewagt hätte. Das Haus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Honoratioren des Städtchens, voran der Bürgermeister, der Direktor der Oberrealschule, drei Ärzte, zwei Apotheker, der Landrichter, zwei Assessoren, dann die Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft: Basser zählte sie alle mit drolligem Augenzwinkern auf. „Hat man denn so was schon erlebt bei der ‚Iphigenie’ vom seligen Herrn Goethe!“ Hinten aber saßen die Schüler und Schülerinnen der oberen Klassen und Minna, die unter ihnen ihr Plätzchen gefunden hatte, versicherte nachher: „Gnä‘ Fräulein, die hätten Sie am liebsten aufgefressen!“
Am Tage nach der Vorstellung, es war zugleich der Abschiedstag, war Dorothea noch einmal zum Friedhof hinausgegangen und hatte ein Veilchensträußchen auf das Grab Sickels gelegt, dem sie in ihrer Kunst, Menschencharaktere darzustellen, so unendlich viel zu danken hatte. Es war nur ein kleines Veilchensträußchen, das ihr gestern unter vielen, vielen anderen Blumen gespendet war. Eine ganze Zeit stand sie sinnend an dem kleinen, von allen Spuren menschlicher Anteilnahme entblößten, vereinsamt daliegenden Hügel und gedachte, schob sich auch das Bild Edgar Maurers dazwischen, in jenen merkwürdigen Umrissen, die ihr so unklar erschienen wie der ganze Charakter dieses rätselhaften Mannes.
Als Dorothea langsam und nachdenklich die breite Chaussee zum Städtchen zurückschritt, zwischen den Feldern hindurch, auf denen das erste Grün sprosste, kam ihr ein Wagen entgegen. Der Majoratsherr Ludolf von Kastrop saß darin. Er zog tief den Hut – ganz tief. Sie sah ihn zum ersten Male wieder seit ihrer letzten Aussprache, und sie dachte: Nun hast du ihn auch zum letzten Male gesehen! – Aber wieder verknüpfte sich seine Gestalt mit der ihres großen Vorbildes, Edgar Maurer, wie vorhin die seine und die Sickels zugleich vor ihren geistigen Augen erschienen waren. Nur war es ganz anders: Sickel war der Stärkste von ihnen – er war ein Mann! „Und ich habe ihn gebeugt“, dachte sie. Aber sie konnte ihres Triumphes nicht recht froh werden. ––
„Kurz ist der Abschied für die lange Freundschaft!“ zitierte dann die Frau Direktor noch einmal auf dem Bahnhof. „Freundschaft war’s ja doch geworden, Fräulein Linden, wenn sie leider auch nicht lang war.“
„Wenn Menschen auseinandergehen, so sagen sie: Auf Wiedersehn!“ ergänzte Direktor Neesemann, und der dicke Basser, der sich auch eingefunden hatte, summte mit zum Himmel gerichteten Augen: „Liebchen, ade – Scheiden tut weh –“
Es war ein Glück, dass er dabei so unsagbar komisch aussah. Sie mussten alle lachen. Und darüber zog die Lokomotive an, und der Zug fuhr hinaus in das frühlingsduftende Land.
Und nun war Dorothea in Berlin und im Empfangssalon des Herrn Geheimen Kommissionsrat Karl Oskar Braune! –
„So antichambrieren wir also wieder einmal“, dachte Dorothea, „wie damals in Gemar bei Exzellenz von Rakolski, im Wartezimmer der hohen Intendanz.“
Die herzbeklemmende Angst, die sie damals empfunden, war freilich nicht in ihr. Sie fühlte sich ungleich sicherer. Aber neugierig war sie doch, sogar sehr neugierig, wie sich die Sache hier entwickeln würde.
„Wirklich elegant hat es aber dieser Geheimrat Braune!“ dachte sie. „Dagegen ist das Wartezimmer des Herrn von Rakolski ja die reine Bettelbude.“
Ein großer Raum, die Wände mit dunkelroter Seide bespannt, die Decke kassettiert und reich vergoldet. Überall kleine Arrangements, Möbel im englischen Stil, roter Mahagoni und bordeauxrote Damastbezüge; ein mächtiger echter Perser auf dem Fußboden, zwischen den Fenstern auf der einen, zwischen den hohen Spiegeln auf der anderen Seite köstliche, frische Blumen in gewaltigen Bronzekübeln. Auf der seidenen Wandbekleidung, an schweren Schnüren in breiten, goldenen Rahmen einige Porträts: Possart, Kainz, die Sorma, Irene Triesch.
Es war sehr voll. Überall saßen und standen kleine Gruppen, elegante Damen und Herren. Kollegen und Kolleginnen wohl der Mehrzahl nach, aber doch auch andere Persönlichkeiten darunter. Nur ganz gedämpftes Plaudern; man achtete scheinbar möglichst wenig aufeinander, man schien den richtigen Salonton, wie er in diesen Raum passte, festzuhalten. –
Als Dorothea eingetreten war, hatten sich wohl ein paar Augen auf sie gerichtet, aber man hatte gleich wieder fortgesehen. Und nur, wenn die große, lederüberzogene Tür drüben sich auf kurze Momente öffnete, blickte man dorthin. –
Die Tür zum Allerheiligsten! – Dann und wann dufte einer oder eine der Wartenden hineinschlüpfen. Dann und wann kamen die Zugelassenen wieder heraus. Dann und wann beschritt einer der Diener – im Frack mit weißer Binde, Eskarpins und Lackschuhen – die geweihte Schwelle, und ein-, zweimal war aus ihr, auf die Dauer einer Sekunde, ein unglaublich dicker Herr erschienen; sehr klein, mit einem Bäuchelchen wie ein Luftballon, und einem Kopf darüber, fast ohne das Bindeglied eines Halses, einem Kopf, der aussah wie eine Riesenkartoffel. – Sollte das der Gewaltige, der Herr Geheimrat sein? –
Dann – endlich, endlich – kam einer der befrackten Diener aus dem Allerheiligsten, sah sich suchend um, schritt geräuschlos auf Dorothea zu, verbeugte sich und hauchte im vollendetsten Hofton: „Der Herr Geheimrat lassen bitten.“
Nun wurde Dorothea mit einem Male doch ein wenig ängstlich ums Herz. Und zum Ausgleich setzte sie dafür, indem sie die geweihte Schwelle überschritt, ihr stolzestes Gesicht auf.
Aber es schien: imponieren ließ sich dieser kleine Mann mit dem dicken Bäuchelchen unter der weißen, schwarz getupften Weste nicht. Er stand zwar von seinem Sitz vor dem Schreibtisch auf, aber dies Aufstehen war gleichsam nur eine symbolische Handlung. Gerade um einen halben Zoll erhob er sich, nickte herablassend, fiel wieder auf den Sessel zurück und deutete auf einen andern: „Bitte – Fräulein Linden – nicht wahr?“ Was wünschen Sie?“
Das klang wenig verlockend, wenig verheißend. – Sie erwiderte: „Sie haben mir geschrieben – oder schreiben lassen, dass Sie meine persönliche Vorstellung wünschten und mir Vorschläge zu machen hätten.“
„So?“
Plötzlich wandte er sich scharf herum, drückte den goldenen Kneifer fest auf den breiten Nasenrücken und sah Dorothea an – eigentlich sah er sie erst jetzt an. Und da erlebte sie wieder, was sie schon so oft erlebt hatte: den Eindruck ihrer Schönheit. Aber es hatte geradezu etwas Verletzendes, wie der kleine, dicke Mann sie musterte. Das Blut schoss ihr ins Gesicht – und vielleicht sah sie dadurch noch reizender aus. Er lachte: „Na – rot werden können Sie also auch noch, mein allergnädigstes Fräulein! Famos steht Ihnen das. Ja – und nun taucht mir’s in der Erinnerung auf – hat nicht Maurer sich für Sie interessiert? Hm – er hatte immer einen guten Geschmack – Edgar Maurer – natürlich. Den neidischen Schleier aber könnten Sie wenigstens lüften, Allergnädigste –“
Dorothea rührte sich nicht.
Am liebsten wäre sie fortgeeilt. Sie war innerlich empört. Aber zugleich keimte lähmend die Sorge in ihr empor: das ist der allmächtige Geheimrat Braune – wenn du ihn behandelst, wie sein Benehmen es verdient, rührt er keinen Finger mehr für dich – und du gehst ohne Engagement in den Sommer –
Vielleicht – vielleicht war der dicke Mann aber auch gar nicht so arg –
Vielleicht war er nur schlecht erzogen und war maßlos verwöhnt, dieser gewaltige Herr, von dem sie schon so viel hatte erzählen hören.
Jetzt lachte er sogar ganz gemütlich. „Also stolz wären wir auch, mein allergnädigstes, schönes Kind. Gar nicht so übel, steht Ihnen auch sehr gut. Nun erlauben Sie mal –“
Er nahm das Telefon von der Schreibtischplatte. Sie hörte ihn hineinsprechen: „Gleich herüberbringen – Fräulein Linden – es ist der Dame geschrieben worden –“
Dann wandte er sich wider zu Dorothea: „Wo waren wir denn zuletzt?“
Sie gab kurz Auskunft.
„Hm – also Anfängerin. Seh‘ mal einer an – und so stolz. Na, anfangen muss jeder einmal. Und wie steht es mit dem Repertoire?“
Wieder gab sie kurz Auskunft.
„Hm – scheint ja immer noch ein recht rühriges Herrchen, dieser alte Neesepeter. Ja – aber da hätten wir ja die Papiere.“
Einer der Diener brachte ein richtiges kleines Aktenfaszikel (Aktenbündel). Der Herr Geheimrat blätterte ein wenig darin, sah dazwischen wieder ein paarmal auf Dorothea, drückte ab und zu den Kneifer fester auf die Nase, schlug die kurzen Beinchen übereinander und wippte vergnüglich mit den Lackschuhen.
„Hm – ja, warum mag Sie denn Ihr Freund, der Maurer, nicht gleich nach Gemar nehmen? Das könnte er doch leicht bei Exzellenz Rakolski erreichen.“
„Ich wüsste nicht, inwiefern Herr Maurer mein ‚Freund’ wäre, Herr Geheimrat!“
„Ach so – ich vergaß ganz, dass Sie so stolz sind – pardon – ja – also Ihr kollegialer Beschützer – wie – ist’s so recht?“
„Er interessiert sich wohl hauptsächlich für mich, weil Exzellenz von Rakolski und mein verstorbener Vater befreundet waren.“
Sie wusste oder fühlte wenigstens, dass sie nicht ganz die Wahrheit sprach. Aber in ihr lebte nur der Wunsch, diesen peinigenden Anspielungen die Spitze abzubrechen. Das schien sie denn auch zu erreichen. Der Geheimrat blickte wieder scharf zu ihr hinüber, diesmal unbedingt ein wenig respektvoller.
„So, so. Darf ich fragen, was Ihr Herr Papa war, gnädiges Fräulein?“
„Offizier –“
„Hm – so. Nun verstehe ich auch. Exzellenz Rakolski wird Sie in Gemar erst herausbringen wollen, wenn er die Gewissheit des Erfolges vor sich sieht. Hm – mag schon sein.“
Dann lächelte der Geheimrat wieder ein wenig süffisant. „Sagen wir also im Herbst. Um Herbst hat Rakolski, seit der Herzog sich mehr für das Theater interessiert, ja immer Bedarf an jungen Schönheiten. Hm – also ein Sommerengagement. Ich könnte Sie vielleicht für eine renommierte Bühne in einer der rheinisch-westfälischen Industriestädte in Vorschlag bringen. Was würden Sie zum Beispiel zu Brochum sagen?“
„Ich gehe überall hin, wenn die Bedingungen einigermaßen erträglich sind und ich gute Beschäftigung finde.“
Diesmal lächelte der Geheimrat nicht, er lachte. „An Beschäftigung dürfte es wohl nicht fehlen. Aber die Bedingungen? Gnädiges Fräulein, Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie Anfängerin sind. Nun, ich will aber zusehen, was sich machen lässt, unter der Voraussetzung natürlich, dass wir in dauernder Verbindung bleiben. Ganz ehrlich gesagt, ich hab’s so in den Fingerspitzen, als ob Sie vorwärtskommen würden, und deshalb will ich ein Übriges tun. Ja – vorwärtskommen – und Karl Oskar Braune hat sich noch selten getäuscht. Das weiß die Welt.“
Er stand auf, reiche Dorothea die Hand und drückte die ihre mit einem komischen, fast wie verliebten Augenzwinkern.
„Also auf Wiedersehen, gnädiges Fräulein! Ihre Adresse bitte im Büro zu hinterlassen. Ich depeschiere sofort nach Bochum. Was gemacht werden kann, wird gemacht – schon weil Sie wirklich bildhübsch sind – bildhübsch.“
Sie stand schon auf der Türschwelle, da rief er sie noch einmal zurück: „Pardon, Gnädigste, wollen Sie nicht heute Abend in das Deutsche Theater gehen? Oder, warten Sie, lieber in die Kammerspiele. Lysistrata – großartig. Ich habe zufällig hier noch einen guten Platz.“ Ablehnen war nicht gut möglich.
Und so saß sie am Abend in einem der tiefen Ledersessel des kleinen, intimen Raumes, von dem sie schon so viel gehört und gelesen hatte, sah mit erstaunten Augen auf das Farbenwunder des Bühnenbildes und lauschte der realistischen, meisterhaften Aufführung. Sie bemerkte gar nicht, dass die Plätze rechts und links neben ihr leer blieben, fast die einzig unbesetzten im überfüllten Hause, bis dann plötzlich im Zwischenakt rechts die kleine Gestalt des Geheimrats Braune auftauchte und links eine noch kleinere, ein rundes Püppchen, zwergenhaft fast, mit einem Marquisengesicht, Puder auf den Wangen und Puder im roten Haar. „Fräulein von Lindenbug – meine Frau!“
Der kleine Mann war sehr echauffiert und ganz anders als am Vormittag. „Ich gehe sonst nur in die Komödie, wenn ich muss! – Aber da erzählte ich zufällig meiner Frau – rein zufällig, wir sprechen sonst fast nie vom Geschäft – ja – erzählte ich von Ihnen und dass Sie aus Gemar stammen – ja, und da –“
„Karl Oskar, aus deinen Worten kann kein Mensch klug werden“, klang es zur Linken. „Sie müssen nämlich wissen, gnädiges Fräulein, dass ich ein Gemarer Kind bin. Mein Vater war der Gymnasialdirektor Hergenpfeil – mein Gott, und ich habe ja Ihren Herrn Vater noch von Ansehen gekannt und Sie gewiss auch als Kind gesehen. Da hat man doch Interesse. Kurz, ich wollte Sie gern kennenlernen, und – ja – ich wollte auch nicht, dass Sie in dieser grässlichen Komödie allein sind – ja –“
Da ging zum Glück der Vorhang zum letzten Male auf und schnitt die Rede des Püppchens kurzweg ab, das heißt, nur zum Teil. Denn während von rechts her jetzt, während der ganzen letzten Szenen, immer wieder ein leises Schnaufen, ein heimliches „Großartig! Wunderbar!“ an Dorotheas Ohr schlug, klang’s von links herüber: „Dass man so etwas aufführen darf!“ „Dass man das ansehen muss!“ „Unsre Moral – unsre Moral – “
Und Dorothea fand: sie hatten alle beide recht. Und sie fand weiter, dass beide sie empfindlich störten, und amüsierte sich schließlich doch über die divergierenden Ansichten dieses Ehepaares. Wie mochten diese beiden Leutchen zusammengekommen sein?
Unten stand nachher ein fürstliches Auto. „Sie erweisen uns doch die Ehre und soupieren mit uns im Hotel Bristol“, sagte er. „Natürlich essen Sie mit uns bei Adlon“, sagte sie. Es entspann sich ein kleines Wortgefecht: hier Adlon – hier Bristol, aus dem die Frau Geheimrat selbstverständlich als Siegerin hervorging. Und das war charakteristisch: während des ganzen Abends, in immer ewigem Geplänkel, blieb die kleine Frau die Überlegene, und der arme Karl Oskar, der die ganze deutsche Bühnenwelt beherrschte, wurde kleiner und immer kleiner.
„Welches Glück dieser Mann da gehabt hat, dass ich seine Frau wurde! Bei dem Geschäft – wenn ich da nicht ein gesundes Gegengewicht bildete! Was, Karl Oskar? Hast du nicht ein immenses Glück gehabt?“
„Gewiss, meine Liebe – “
„Er möchte natürlich jeder hübschen Schauspielerin die Tour machen, bei seinem Asthma, wo er doch alle Jahre nach Nauheim muss. Du lebtest schon seit Jahren nicht mehr, wenn ich nicht vorsorgte. Ist’s wahr oder ist’s nicht wahr?“
Karl Oskar schnitt ein tragikkomisches Gesicht. „Natürlich ist’s wahr, das heißt – mit dem Tourmachen, liebe Mechthildis, das ist –“
„Es ist wahr. Du hast diese unglückliche Neigung. Denken Sie denn, Fräulein von Lindenbug, er wäre heute Abend nicht lieber allein gekommen? Aber ich kenne ihn doch. Kenn‘ ich dich, Karl Oskar?“
„Bis in die tiefsten Tiefen meiner Seele.“
„Nun also! Eifersüchtig bin ich ja, gottlob, nicht, nur auf dein Wohl bin ich bedacht. Bin ich eifersüchtig, Karl Oskar?“
„Bewahre, liebste Mechthildis –“
„Nur auf dein Wohl bedacht. Du trinkst auch schon wieder zu schnell.“
„Ich? – Aber wirklich, Mechthildis –“
„Du trinkst zu schnell. Gleich stellst du dein Sektglas beiseite. Ein Glas Bordeaux darfst du noch nehmen – und Fachinger. Denke an dein Herz, Karl Oskar. Du neigst immer dazu, deinem Herzen zu viel zuzumuten.“
Es ging Schlag auf Schlag. Und dazwischen wisperte die kleine Puppe, die ein so strenges Regiment führte, von Gemar und vom Gymnasium und von der alten Herzoginmutter; sie erzählte, wie sie als Gouvernante in das Haus dieses gänzlich verwahrlosten Karl Oskar Braune gekommen sei, und dass sie aus dem armseligen, kranken Witwer erst wieder einen glücklichen Menschen gemacht hätte; aß nach einem Omelette Surprise noch drei Portionen Fruchteis, fragte Dorothea nach ihren Erlebnissen und hielt ihr alle Schäden und Gefahren der deutschen Schaubühne vor Augen und klagte, dass alle großen Traditionen auszusterben im Begriffe wären.
Dazwischen, wenn er sich auf einen Moment unbeobachtet glaubte, machte Karl Oskar verzweiflungsvolle Augen, um gleich wieder seine ergebenste Miene aufzustecken. Gerade noch so viel Mut hatte der Gewaltige, dass er Dorothea dann und wann auf die kostbare Ausstattung des „schönsten Hotels Europas“ aufmerksam machte oder auf irgendeine markante Persönlichkeit an einem der Nebentische. Aber selbst darin musste er vorsichtig sein, sonst hieß es: „Karl Oskar, benimm dich nicht so auffällig!“
Und Dorothea saß in ihrer stolzen Schönheit zwischen den beiden, kleinen Menschen, neigte sich einmal nach rechts, einmal nach links und genoss zum ersten Male in ihrem Leben die eine Genugtuung: auch hier in Berlin erregst du Aufsehen. Sie hätte nicht Weib sein müssen, wenn es nicht eine Genugtuung für sie gewesen wäre. In ihrem einfachen Kleide, das aus der Werkstatt der guten Minna hervorgegangen war, saß sie, mit dem schlichten Hut, den sie sich selber garniert hatte, und fühlte, wie man sie bewundernd anstaunte, wie an den Nebentischen geraunt und getuschelt und gefragt wurde, wer sie sei. Dies wunderschöne Mädchen, das niemand kannte, neben dem stadtbekannten Theatergewaltigen. Eine Schauspielerin also jedenfalls, so schön, wie es in ganz Berlin kaum eine gab. An welche Bühne sie der Geheimrat wohl bringen würde? Ob sie Sängerin war? Ob eine Operettendiva? Ob eine Heroine? Opernhaus – Metropoltheater – Deutsches Theater –
Mit einem Male schien in Karl Oskar ein ähnlicher Gedankenkreis aufzusteigen. Er sagte plötzlich: „Eigentlich sind Sie für die Provinz doch viel zu schade!“ Aber da musste er wohl sofort einen kleinen Tritt unter dem Tisch bekommen haben; denn er zuckte zusammen und ergänzte: „Ja – nun das wird sich später finden.“
„Ich nehme an, Karl Oskar, dass du für Fräulein von Lindenbug sehr gut gesorgt hast.“
„Aber gewiss doch, liebe Mechthildis.“
„Sehr gut“ Du verstehst mich, Karl Oskar. Ich interessiere mich für das gnädige Fräulein.“
„Sehr gut. Übrigens kann ich es ja gleich verraten: Bochum hat akzeptiert.“ –
Am Tage darauf hatte Dorothea ihren Vertrag. Ob er sehr gut war? Einhundertfünfzig Mark Monatsgage, zehn Mark Spielhonorar. Es war glänzend, an dem Maßstab von Neumüller gemessen. Und dennoch unterschrieb Dorothea mit einem unsicheren Gefühl, sie wusste selbst nicht recht, weshalb. Es war etwas wie ein ungewisses Grauen in ihr vor den neuen Verhältnissen, denen sie entgegenging, vor der großen Stadt mit den rauchenden Fabrikschloten, vor dem Publikum, das ihr mit so ganz andern Ansprüchen gegenübertreten würde, vor den fremden Kollegen.
Zum ersten Male überkam sie etwas wie Heimwehfieber, nach einer wirklichen Heimat, nach einem Heimatort. Hatte sie denn überhaupt je eine Heimat in diesem Sinne besessen? Selbst Gemar war ihr das eigentlich nicht gewesen. Soweit sie zurückdenken konnte, immer war sie in Deutschland herumgeworfen worden, alle paar Jahre hatten die Eltern den Wohnsitz gewechselt. Aber das Heimweh nach einem sicheren Hafen, nach dem Schutz des eignen Herdes lebte weh in ihr auf: welch armseliges Menschenkind war sie doch! Wann würde sie je festen Anker werfen können?
Es waren Augenblicksempfindungen, die kamen und gingen. Sie wusste es selbst. Wenn sie erst wieder im Beruf stand, vor neuen Aufgaben, wenn die Arbeit sie packte, wenn der Tag drängte und die Stunde – wenn sie gefiel: dann mussten solche Empfindungen verwehen wie Spreu vor dem Winde. Aber jetzt waren sie da, und sie musste gegen sich kämpfen, dass ihr nicht die Tränen in die Augen schossen.
Endlos dünkte sie die Fahrt gen Westen.
Und auf dieser endlosen Fahrt, bald einsam in einem Abteil dritter Klasse, bald eingepfercht zwischen fremden Menschen, gleichgültige jetzt, neugierig starrende dann, stiegen in ihr mit jenem Heimwehfieber zugleich die Sorgen empor, die erbärmlichen, materiellen Sorgen.
Sie rechnete und rechnete, und das Resultat blieb immer gleich niederdrückend.
Ja doch! Sie hatte nun fast die doppelte Gage wie bei dem braven Neesemann; mit dem Spielhonorar sogar mehr, wenn sie einigermaßen häufig beschäftigt wurde. Aber ganz gewiss waren auch die Toilettenansprüche ungleich größere als in dem kleinen Neumöller, wo schließlich jedes einigermaßen aufgeputzte Fähnchen gnädig im Lampenlicht bewundert wurde. Die leidigen Toilettenansprüche, die zum Fluch jeder jungen Schauspielerin werden müssen!
Dabei war das kleine Kapital, das die Mutter hinterlassen, sogar in Neumöller schon wiederholt angegriffen worden. Wie würde das in der Großstadt werden? Und wie schnell waren die paar tausend Mark aufgezehrt! Was dann – was dann?
Einen Moment dachte sie dann: die gute, alte Minna ist dir eigentlich eine finanzielle Bürde, mehr Bürde als Stütze. Wenn du sie entlassen würdest?
Aber gleich verwarf sie den Gedanken wieder. Nicht nur aus nüchterner Überlegung, nicht, weil Minnas Sparsamkeit und praktischer Sinn wohl alle Ausgaben für sie mehr als ausglichen. Nein, sie brauchte auch jemand, der ihr nahestand, an dem sie sich in trüben Stunden einmal aufrichten konnte. Brauchte dies verhunzelte, alte Gesichtchen mit den treuen Augen mehr vielleicht als das tägliche Brot!
Und mitten in all dem trüben Überlegen musste sie plötzlich laut auflachen.
Mit einem Male stand die kleine Geheimrätin, Frau Mechthildis Braune, geborene Hergenpfeil, vor ihren geistigen Augen, und es war, als hörte sie die leise Stimme, die so fein wisperte und vor der der Theatergewaltige doch immer aufs neue zusammenschrak.
Woher die Frauen wohl die Gewalt über die Männer schöpfen?
Diese kleine Frau war gewiss selbst in ihren Blütejahren nicht sonderlich hübsch gewesen, nicht sonderlich klug, konnte ohne Zweifel oft recht unausstehlich sein, musste einem vielbeschäftigten Mann bisweilen stark auf die Nerven fallen, aber sie regierte doch: mit wispernder Stimme, aber gewiss mit straffem Zügel.
Und wie Dorothea in dem rasselnden Zuge, eingepfercht zwischen ein paar robusten Marktweibern, die zur nächsten Stadt fuhren, dieser geheimnisvollen Gewalt der Frau nachsann, da tauchten in ganz eigner Ideenverbindung vor ihr die Gestalten der Männer auf, die mit stärkerer Hand in ihr eignes junges Leben einzugreifen gesucht hatten.
Der eine, um den ihr Herz himmelhoch gejauchzt hatte und zu Tode betrübt gewesen war, war von ihr gegangen, war hinausgegangen in den großen Kampf der Männer, ohne doch – und das stand heute zum ersten Male so klar vor ihrer Seele, dass sie selber davor erschrak – ohne doch den größeren Kampf um sie aufzunehmen, den Kampf um ein Dasein, das gewiss reich an tiefschmerzlichen Entbehrungen gewesen wäre, aber unendlich reicher an dem Glück, das die Liebe gibt. Nun ruhte er, vom Unfrieden der Welt erlöst, in fremder Erde.
Der andre – ja wie war das eigentlich? Der andre war ein Irrlicht, das hier und dort an ihrem Wege aufzutauchen schien, als ob es in ihr Leben hineinleuchten möchte. Was wollte Edgar Maurer? Hatte er nur das verstandesmäßige künstlerische Interesse an der Kollegin? Liebte er sie? Und wenn er sie liebte?
Dann endlich der dritte. Sie hatte ihn verachtet, sie hatte ihn gehasst, sie hatte ihn zu demütigen gesucht? Der Hass jedoch – sie wusste selbst nicht, wie es kam – der Hass war eingesargt, die Verachtung war erloschen, und die Stunde, in der sie als Siegerin von ihm geschieden zu sein meinte, gereute sie fast. Aber er erschien ihr jetzt für ewig weltfern von ihr abgerückt, als ein ganz Fremder, der ihres Lebens Bahnen nie mehr kreuzen würde. Und das war gewiss am besten so.
Nur die eine Erinnerung würde, musste sie immer an ihn wahren: er war ein Mann!
Ganz jäh hörte sie wieder die wispernde Stimme: „Karl Oskar, benimm dich nicht auffallend! Karl Oskar, wenn du mich nicht hättest!“ Und Karl Oskar Braune, Theatergewaltiger und Geheimrat, beugte sich, beugte sich ganz tief.
Es war doch etwas Geheimnisvolles.
Sie, Dorothea, hatte nie Gewalt über die Männer gehabt, die ihre Kreise berührt hatten. Wohl mochte sie Männerherzen erobern, herrschen würde sie nie über sie können. Und doch sagte ihr der Spiegel täglich aufs Neue, was ihr allerorten bewundernde Blicke sagten: Du bist so schön! Du bist die Schönste im ganzen Land! – Ganz tief sank ihr das Haupt, und erst allmählich hob sie den Kopf wieder.
Vielleicht war auch das gerade gut so, wie es war, denn sie gehörte der Kunst!
Wie oft musste Dorothea in den nächsten Tagen nicht lächeln, wenn sie an ihren Einzug in Neumöller, an ihre erste Zeit unter dem Zepter des alten Neesemann zurückdachte. Hier, in der großen rheinischen Industriestadt, war alles von viel größerem Zuschnitt. Ein schönes Haus, bequeme Garderoben – eine gediegene Ausstattung auf der Bühne. Der Direktor in seiner Erscheinung, in seinem Auftreten ein Gentleman, der beim ersten wirklichen Frühlingssonnenschein den tadellosen Zylinder mit einem echten Panama vertauschte; seine Frau eine Dame von Welt, die sich dem Beruf ihres Mannes ziemlich fernhielt und nur gelegentlich bei den Proben erschien. Die Kollegen und Kolleginnen, mindestens äußerlich, durchaus „höhere Klasse“, sogar bis zu den Vertretern der kleinen Rollen hinunter.
Welch ein Unterschied! Und dennoch – dennoch –
In Neumöller war Dorothea von den ersten Tagen an Alleinherrscherin in ihrem Rollenfach gewesen. Hier lernte sie zum ersten Mal den bitteren Kampf kennen, die eine Notwendigkeit, sich eine sichere Position zu erobern, die andre, nicht minder schwere: sie zu behaupten.
Man raunte es ihr bald zu, und wenn man es ihr nicht zugeraunt hätte, sie würde es auch selber schnell erkannt haben: die Direktion gehörte zu denen, die „reichlich engagieren“. Jetzt wusste sie ja schon, was das bedeutete. Jedes Rollenfach war drei-, vierfach besetzt, aber nach den ersten Debüts sichtete der Herr Direktor seine Heerscharen und entließ rücksichtslos, was ihm nicht passte, was dem Publikum nicht gefiel: der Vertrag bot ja dazu reichliche Handhaben. Mochten sie dann zusehen, wo sie in der schwerbedrängten Sommerzeit einen neuen Unterschlupf fanden!
„Geschäft bleibt Geschäft!“ war hier die Devise. Und das Theater war ein Geschäft gleich jedem andern.
Als Dorothea sich auf dem Direktionsbüro vorstellte, hatte sie der Direktor, ein noch junger Mann, der ursprünglich Redakteur einer Tageszeitung gewesen war und sich dank dem Sprungbrett seiner scharfen Kritiken und der Mitgift seiner Frau zum Direktor lanciert hatte, mit vollendeter Höflichkeit, aber mit etwas sarkastischer Zurückhaltung empfangen.
„Man hat Sie mir sehr gut empfohlen, Fräulein von Lindenbug – apropos, Herr Rat Braune schreibt mir, dass Sie Ihren eigentlichen Namen wieder annehmen wollen – sehr verständig! – ja also, man hat Sie mir aufs Wärmste empfohlen. Aber Sie kommen aus recht kleinen Verhältnissen – hm – Neumöller – ja, ich gestehe, ich war ein wenig erstaunt, als mir Braune depeschierte. Pardon – Sie werden das gewiss verstehen. Ich verstehe es ja auch, nun ich den Vorzug habe, Sie zu sehen. Wer sollte das nicht verstehen? Aber – hm – leicht werden Sie es hier nicht haben, Fräulein von Lindenbug. Ich denke, wir versuchen es zunächst mit ein paar kleineren Partien, die geeignet sind, Ihre Persönlichkeit besonders vorteilhaft herauszubringen.“
Er lächelte dabei überlegen, macht eine kleine Verbeugung und versicherte: „Ich meine es gut!“
Vielleicht meinte er es wirklich gut. Vielleicht ahnte er gar nicht, wie er Dorotheas Stolz beugte? Was wusste er denn auch von ihr?
Sie erhielt also einige „kleinere Rollen“, leichte Ware in Komödien aus dem Französischen. Eine Vicomtesse, die gut aussehen sollte und wenig zu sagen hatte. Eine Brettldiva, die nur äußerlich zu glänzen und ein paar Strophen zu trillern hatte. Die Dueña im Cyrano – sie, die die Roxane gespiet hatte!
Es waren schmerzliche Enttäuschungen. Und mit den Enttäuschungen zugleich kamen die Sorgen, die sie unsicher im Voraus geahnt hatte.
Sie hatte mit Minna eine sehr bescheidene Wohnung gefunden, aber auch diese war sehr teuer. Teuer, erschreckend teuer war hier alles in diesem großen, im Verlauf weniger Jahrzehnte empor geblühten Gemeinwesen. Selbst Minna, die ewig gelassene, verlor einigermaßen ihr Gleichgewicht, wenn sie, mit dem Marktkorb am Arm heimkommend, ihrem gnä‘ Fräulein beichtete, dass jeder Krämer hier ein halber Wucherer sei. Aber von allen Sorgen die schlimmsten waren die Toilettensorgen. Wie sich die Kolleginnen herausbrachten! Woher sie nur das Geld nahmen, um von Akt zu Akt in immer eleganteren, immer kostbareren Kleidern zu erscheinen? Sie, die zum größeren Teil doch auch mit einer verhältnismäßig lächerlich kleinen Gage engagiert waren.
Immer wieder ging Dorothea den Inhalt ihrer gerade ausgepackten Koffer durch. Sie hätte weinen mögen: Für die historischen Rollen mochte das eine oder das andre von dem Vorhandenen zur Not genügen. Aber gerade für die moderne, leicht geschürzte Komödie fehlte alles und jedes. Man konnte die kokette Vicomtesse doch nicht in einem „Kattunfummelchen“ darstellen, und das schon dreimal umgearbeitet Blauseidene genügte unmöglich für die Brettldiva, von der es in der Rolle hieß, dass sie sich allabendlich mit Brillanten im Wert einer halben Million behängte.
Sie hätte weinen mögen. Aber Tränen halfen nichts. Es musste wieder das kleine Kapital angegriffen werden, so sehr Minna jammerte, drohte, schalt. Es mussten Stoffe und Spitzen gekauft werden, und dann surrte die Handnähmaschine zwei Tage und drei Nächte hindurch. Ein Glück noch, dass Dorothea einen Geschmack mit persönlicher Note besaß. Ein Glück, dass Minna die „goldig geschickten“ Finger hatte. Auf die verlorenen Nachtstunden kam’s schließlich nicht an. Freilich – wie unendlich viel lieber hätte Dorothea die auf ein ernsteres Rollenstudium verwendet als auf diese kleinen Partien, die das Lernen kaum lohnten. Oder lohnten sie doch? Gleich bei ihrem ersten Auftreten hatte sie einen kleinen Erfolg. Sie fühlte zwar, dieser Erfolg war wieder einmal einer von denen, die ihrer Schönheit galten – diesmal wohl nur ihrer Schönheit. Der Direktor hatte sich schmunzelnd an seinem à la Haby (Hoffriseur Wilhelm II., der ihm zu seinem nach oben gezwirbelten Schnurrbart verhalf) gebrannten, schwarzen Schnurrbärtchen gewirbelt, als sie aus der Garderobe kam: „Brillant, Fräulein von Lindenbug!“ Fräulein Melanie Schwarz, die etwas ältliche Kollegin, der die größere Rolle der Schlossherrin zugefallen war, hatte ihr einen bösen Blick zugeworfen. Und durch den Zuschauerraum war dann jenes leise Rauschen bei ihrem Auftreten gegangen, das entsteht, wenn ein paar hundert Hände gleichzeitig das Opernglas heben, wenn die Theaterzettel plötzlich leise knistern, weil alle Welt nachsehen möchte: „Alle Wetter – wer ist denn das?“
Schönheit ist eben ein Himmelsgeschenk. Für alle Welt, aber zumal für jene Bretter, die die Welt bedeuten. Zumal wenn – was auf der Bühne keineswegs häufig – Schönheit sich mit Jugend paart.
Bei der Cyrano-Aufführung raunte Herr Max Hinkell Dorothea zu, mit einem Seitenblick auf Fräulein Melanie Schwarz: „Mit Ihnen hätt‘ ich halt noch lieber g’spielt?“ Und der Direktor wirbelte seinen Habybart, ohne ein Wort zu sagen, aber mit der Miene eines Mannes, der sich mit großen Entschlüssen trägt.
Direktor Krauthaar war durchaus für „die Moderne“; die „öden Klassiker“ waren ihm im besten Fall ein notwendiges Übel, und wenn er einen „alten Schinken“ herausbrachte, so geschah’s immer aus besonderen Gründen, entweder um denen eine Konzession zu machen, die ja bekanntlich nicht aussterben, wie er sich ausdrückte, oder um einen Versuch‚ à la Reinhardt zu veranstalten, ob man nicht solch „Ururvatersstück“ reizvoll auffrischen konnte, indem man ihm eine besonders stimmungsvolle Ausstattung gibt, oder endlich, um irgendein Mitglied „auszuprobieren“. Missglückte das dann, so hatte es bei einem klassischen Stück noch am wenigsten zu sagen.
„Ich beabsichtige, ‚Minna von Barnhelm’ mal wieder aufs Repertoire zu setzen. Es gibt ja immer noch sonderbare Schwärmer, die das Stücklein nicht nur für das erste, sondern auch für das beste Lustspiel halten. Bitte, Fräulein von Lindenbug, Sie übernehmen natürlich die Minna.“
„Natürlich, “ sagte er bereits.
Und es wurde ein voller, ganzer Erfolg für Dorothea. Seitdem stand sie fest – bei dem Publikum und bei der hohen Direktion, während Melanie Schwarz ihre Koffer packte und, wie Herr Max Hinkell meinte, „zwischen Rhein und Memel Altersversorgung suchte“.
Aber trotz der Erfolge wurde Dorothea in der Industriestadt nicht recht froh. Es kam mancherlei zusammen. Das Repertoire behagte ihr nicht, es bot zu wenig ihrer Individualität zusagende Aufgaben. Manchmal dachte sie im Stillen: Bei dem guten Neesemann war ja, trotz aller Enge, mehr künstlerisches Leben als hier. Dann waren die nicht endenden Toilettensorgen umso einschneidender und schwerer, weil der Direktor immer wieder neue, moderne Stücke herausbrachte. Zudem kränkelte Minna und konnte ihre geschickten Hände nicht mehr so flink und unermüdlich rühren wie ehedem. Sie verbarg es zwar, so gut sie es vermochte, aber sie klagte doch oft: „Der Kohlenstaub – der Kohlenstaub, gnä‘ Fräulein – wie die Leute nur hier leben können.“ Ja freilich, schön war Brochum nicht mit seinen himmelhohen Schloten und seinen Fabrikkasernen. Da hatte man sich nun immer und immer wieder auf den Vater Rhein gefreut, die ganze Jugend hindurch, auf den Wunderstrom und seine poesieumwobenen Rebenhänge, und nun saß man knapp zwei Stunden entfernt, ohne ihn grüßen zu können, saß eingesponnen in eine Maueröde, atmete die Stickluft der Industriestadt, hörte das Pfauchen und Rasseln der Maschinen. „Ach, du mein Vater Rhein!“ seufzte Dorothea wohl bisweilen, oder sie gedachte wiederum des kleinen Neumöller, das von Ost und West her die frische, herzerquickende Meeresluft umweht hatte.
Auch die kollegialen Verhältnisse waren nicht übermäßig angenehm. Man lebte nebeneinander hin, ging außerhalb der gemeinsamen Tätigkeit seine eignen Wege. Man war eben schon in der Großstadt.
Nur eine Freude und Genugtuung hatte Dorothea. Es fand sich, was sie bisher so schmerzlich entbehrt hatte, ein wenig geselliger Verkehr für sie und brachte sie aus der Abgeschlossenheit des Berufs wieder etwas mit der großen Welt in Verbindung. Es kam, wie es nicht selten kommt, wenn eine solche Brücke geschlagen wird.
Dorothea fand eine Zeitlang, fast nach jedem Auftreten, ein paar Blumen an der Klinke ihrer Wohnungstüre befestigt, sinnig mit irgendeinem farbigen Band zusammengebunden. Dann kamen einige kleine, rührend unbeholfene, schwärmerische Gedichte, von einer flinken Mädchenhandschrift geschrieben, und dann stand eines Nachmittags ein langaufgeschossenes, hübsches, blondes Ding, ganz holde Siebzehn, vor ihr in ihrem Zimmer, sah sie, erglühend wie ein Röslein, mit großen, blauen Augen an, hob bittend beide Hände und sagte nichts als: „Meisterin –“
Sagte es nicht, hauchte es nur.
Im ersten Moment fühlte Dorothea einen schier unwiderstehlichen Lachreiz im Halse. Aber zugleich tauchte in ihr die Erinnerung auf an die eigne holde Siebzehn – es war ja noch gar nicht so lange her, wenn es ihr oft auch wie eine Ewigkeit erscheinen wollte. Sie gedachte der lieben, süßen Jugendeseleien, die sie selber verbrochen hatte, dass auch sie einst die Heroine in Gemar angedichtet, angeschwärmt und angebetet, und dass sie einst den Namen des „Schwarms“ auf winzig kleine Papierschnitzelchen geschrieben, die sie auf ihre Schulsemmel gelegt und selig mit hinuntergewürgt hatte.
Nein – nicht lachen! Nicht wehe tun!
So legte sie ihren Arm um den Gürtel des Mädchens, drehte sich mit ihr einmal im Kreise und sagte dann lustig: „Da setzen wir uns hin. Meisterin – ach nein! Aber erzählen Sie mir etwas von sich, damit ich Sie kennenlerne.“
Es kam nur sehr langsam heraus. Die kleine Schwärmerin hieß Margaret Wignam, war eines sehr wohlhabenden Fabrikbesitzers Töchterlein und – wollte selbstverständlich zur Bühne. Als dies Geständnis endlich über die bebenden Lippen war, sagte Dorothea nur: „Nein! Nein! Nein!“ Dreimal hintereinander und so bestimmt, dass sie selber davor erschrak. Aber sie redete dann Margaret so herzlich und eindringlich ins Gemüt, dass die, zwar mit etlichen Tränen, aber doch ohne darüber zu sterben, ihren Bühnenideen entsagte. Sie schieden als gute Freundinnen; Margaret mit einem langausgedehnten Handkuss, den Dorothea in einen herzlichen Kuss auf den Mund übersetzte.
Wenige Tage später kam die Mutter des Kindes, um zu danken. Die Kleine hatte unter Tränen alles gebeichtet, vom ersten Rosensträußchen, das sie zitternden Fußes die zwei schmalen Stiegen bis zu Dorotheas Wohnung hinaufgetragen, bis zu der großen Szene und bis zu dem energischen „Nein! Nein! Nein!“ Frau Wignam berichtete es mit dem Lächeln einer verständigen Mutter und mit dem taktvollen Hinzufügen, dass sie einer wirklichen großen Begabung nie ernstliche Hindernisse in den Weg gelegt haben würde – und sie lud dann Dorothea ein. Es entspann sich ein engerer Verkehr, man gefiel sich augenscheinlich gegenseitig, und neben dem einen gastlichen Hause öffneten sich in einem grünen Villenkranze draußen vor den Toren der Künstlerin noch einige andre.
Ein angenehmer Kreis von fein gebildeten Männern und Frauen war es, dem auch die frohe Jugend nicht fehlte. Manch ein leises Vorurteil war da hinüber und herüber besiegt, und als die Sommersaison des Stadttheaters sich ihrem Ende zuneigte, war allgemeines, aufrichtiges Bedauern. Ja, Herr Wignam, der dem städtischen Theaterkuratorium angehörte, sprach mit seiner leisen, sanften Stimme wohl davon, ob er seinen Einfluss in die Waagschale werfen dürfe, um Fräulein von Lindenbug für den Winter zu fesseln. Aber Dorothea schüttelte den Kopf:
„Sie waren alle so lieb und gütig zu mir. Ich möchte nicht undankbar erscheinen. Nur, verzeihen Sie – darf ich ein Wort von Geibel für mich sprechen lassen: ‚Lass das Träumen, lass das Zagen! Unermüdet wandre fort! Will die Kraft dir schier versagen: vorwärts ist das rechte Wort!’“
Da nickte der alte Herr lächelnd: „Ich möchte Ihnen dafür ein Verslein aus einem vergessenen rheinischen Volksliede sagen: ‚Oh Jugend, oh schöne Rosenzeit, die Wege, die Stege mit Blumen bestreut – der Himmel steht offen, man siehet die Engelein.’ Sie sind noch so jung, darum sind Sie im Recht, und wir können nur wünschen, dass Ihnen der Himmel offen stehe und dass Ihre Wege und Stege mit Blumen bestreut sein mögen.“
Das kleine Gespräch fand in dem großen Garten der Villa statt, etwas abseits von der fröhlichen Gesellschaft, die unter der Laube um eine mächtige Bowle saß. Die Gläser klangen herüber, und dann fing der älteste Sohn des Hauses, der gerade von der Technischen Hochschule zurückgekommen war, mit seiner kräftigen Baritonstimme zu singen an:
„Am deutschen Rheine, grün umlaubt,
Da ist ein lustig Leben;
Es trägt der Rhein auf seinem Haupt
Ein Diadem von Reben.“
Die andern fielen ein. Dorothea und der alte Herr traten näher heran, auch sie sangen mit:
„Ein lustig Leben ist am Rhein.
Ich sing‘ mit hellem Tone:
Es ist der Assmannshäuser Wein,
Rubin in Rheinlands Krone –“
Der junge Wignam brachte Dorothea und dem Vater je ein Glas. Man stieß an; es stieg noch ein Rundgesang und noch einer. Und dann sagte die Hausfrau dazwischen: „In diesem Jahre waren wir noch gar nicht am Rhein –“
Und Dorothea: „Und ich kenn‘ ihn überhaupt nicht.“
Ein Hallo erhob sich. Man lachte, man wollte es nicht für möglich halten, nicht glauben. Diese Rheinlandskinder bekreuzigten sich: Vater Rhein noch nicht gesehen zu haben! Wie konnte man leben, trinken, lachen und fröhlich sein, ohne den Rhein zu kennen?!
Bis dann der alte Herr entschied: „Ich lade euch alle zusammen ein – vom Drachenfels bis zum Niederwald! Und Sie, gnädiges Fräulein, da Sie am schwersten sich auf zwei Tage freimachen können, Sie sollen uns sagen, wann wir unser Schifflein rüsten dürfen.“ –
Sonnige, wonnige Augusttage wurden es. Endlich einmal wieder hatte Dorothea sich ganz losgelöst von den Sorgen des Tages, vom Beruf. Sie wollte harmlos fröhlich sein mit den Fröhlichen, und sie war es.
In Assmannshausen, in der alten lieben Krone, hatten die gespeist, hatten das Freiligrath-Zimmer besichtigt, hatten sich noch einmal zum kühlen Trunk niedergesetzt. Nun ging es über den Niederwald nach Rüdesheim.
Es war eine ziemlich große Gesellschaft geworden, dem engeren Wignamschen Kreise hatten sich Verwandte und Bekannte angeschlossen. Zuerst blieb man beieinander, dann dehnte und streckte sich der Zug durch den Wald. Umgekehrt, wie es sonst ist: die Älteren schritten rüstig vorn, die Jugend trödelte unter Lachen und Scherzen hinterdrein. Mit ihr war Dorothea, und der rheinische Übermut hatte auch sie angesteckt. Es war wie ein Jubeln in ihr: endlich, endlich wieder einmal!
Anfangs war sie mit Margaret Wignam gegangen und deren ältesten Bruder, dem jungen Dr. Ing. Dann hatten ein paar Freundinnen den Backfisch mit sich fortgezogen, seitlich vom Wege; man hörte sie lachen und kichern. Nun schritt sie mit dem jungen Ingenieur allein, und der Schaumwein der Krone war mit ihnen.
„Wissen Sie, wie’s der Goethekreis in Frankfurt machte?“ fragte er lachend. „Da schloss man in einer Lotterie scherzhaft Ehen auf Tage und Stunden, nur um sich beim Vornamen und mit dem freundschaftlichen Du ansprechen zu dürfen. Mariagespiel nannten sie es, und Goethe verband dreimal das Los mit – nun, wie hieß sie doch – mit der Anne Sibylle Münch. Es muss ganz furchtbar nett gewesen sein.“
„Glaub ich schon.“
„Wie wär’s? Was unsre Leutchen wohl für Augen machen würden, wenn sie es hörten. Wollen wir – bis heute Abend?“
„Machen wir!“
Und sie nahmen den Scherz auf. Es ging vortrefflich, das Du, und Albert und Dorothea flogen nur so herüber und hinüber.
„Nein – Albert, das klingt so steif. Überhaupt, ein schrecklicher Vorname, mit dem mich meine alten Herrschaften gestraft haben. Bertchen nennt mich Mutter, wenn sie es besonders gut meint.“
„Also – Bertchen, obschon es etwas weiblich klingt für einen wohlbestallten Dr. Ing.!“
„Ja – aber Dorothea klingt mehr wie steif. Ich muss auch einen Kosenamen für dich wissen.“
„Diedel hat man ein gewisses Kind genannt, liebes Bertchen.“
„Diedel ist famos. Ich nenne dich nur noch Diedelchen. Man hört ordentlich die Musik aus dem Namen. Dideldum, dideldum –“
„Hör mal, Bertchen, die Zusammenstellung mit dumm möchte ich mir energisch verbitten.“
„Vorzüglich – vorzüglich: da hätten wir also schon die erste Gardinenpredigt. Anbetungswürdiges, geliebtes Diedelchen, zum Pantoffelhelden habe ich wahrhaftig keine Anlage.“
„Aber ich zur Tyrannin! Man ist doch nicht umsonst Heroine.“
„Also schön, du darfst mich knechten. Aber den Arm musst du mir geben.“
„Ist ganz unmodern, Bertchen. Kommt unter Eheleuten gar nicht mehr vor.“
„Bitte recht sehr. Wir sind in der Wertherzeit. Bitte, liebes Diedelchen, gestrenge Tyrannin – deinen Arm.“
So traten sie, Arm in Arm, lachend auf den freien Platz vor dem Denkmal. Der Marsch hatte ihnen das Blut in die Wangen getrieben, und der Frohsinn leuchtete aus ihren Augen.
Und da sah Dorothea plötzlich – kaum zwanzig Schritt vor sich – Ludolf von Kastrop.
Er stand ganz allein, hatte hinausgeschaut auf den Rheinstrom und die sonnenüberströmte Landschaft drüben, wandte sich gerade um – und sah auch sie. Er musste noch Wignams lautes „Deinen Arm – deinen Arm“ gehört haben und ihr fröhliches Lachen. Er musste jetzt sehen, wie ihr das Blut jäh in die Wangen schoss.
Und sie sah, wie es in seinem Gesicht zuckte. Sah, wie er die Unterlippe zwischen die Zähne zog. Sah dann, wie er den Hut tief zog, sich umwandte und schnell, dicht an ihnen vorbei, die Straße entlang schritt.
Und wieder musste er hören, was der junge Wignam sagte: „Diedelchen, du zitterst ja. Ist’s aus Liebe?“ Sie fühlte es, dass er das hören musste.
Mit einem jähen Ruck riss sie ihren Arm frei. Das ganze übermütige Spiel kam ihr mit einem Male so unsagbar albern, so unwürdig und unpassend vor. Die Brust war ihr plötzlich eng geworden, und wie ein Reif lag es um ihren Kopf. Aufschreien hätte sie mögen. –
Der Mann dort – was ging sie der Mann an? Ludolf Kastrop? „Was ist er dir?“ rief es in ihr. Hastig gab sie sich selber die Antwort: „Nichts – nichts.“ Aber in der Antwort lag es wie ein Zwang, den sie sich antun musste. Der große Schmerz ließ sich nicht ertöten: „Was muss er von dir denken? Gerade er –“
„Aber Diedelchen, was hast du denn nur? Willst du mir eine Ehestandsszene machen?“ hörte sie die junge Stimme neben sich. „Das ist entschieden zu früh. Schäm‘ dich, mein Diedelchen.“
Sie stand und hörte es und holte tief Atem.
Am liebsten hätte sie geantwortet: „Es ist genug dieses törichten Spiels.“
Doch da kam ihr schon die ruhigere Überlegung: „Weshalb dem liebenswürdigen Menschen den harmlosen Spaß verderben? Sei nicht kleinlich, Dorothea.“ Dazu kam der Trotz: „Nun erst recht! Warum auch nicht?“
Diesmal zwang sie sich: „Du sollst gleich deine launische Herrin kennenlernen. Küsse nur meinen Pantoffel.“
Und sie lachte, schob wieder ihren Arm in den seinen und zog ihn hinüber zu der andern Gesellschaft, die sich zu Füßen des Denkmals gesammelt hatte.
Es war sehr heiter geblieben in dem Rheinländerkreise. Erst in Rüdesheim, dann auf dem Dampfer, schließlich Wiesbaden, wo die fröhliche Fahrt endete. Vielleicht schien Dorothea die Heiterste, vielleicht die Übermütigste. Bisweilen glitt wohl ein etwas erstaunter Blick des alten Herrn von ihr zu dem Sohne, und von dem Sohne zu ihr. Aber dann lächelte er doch wieder: das hatte nichts auf sich! Er kannte sein Bertchen, er meinte auch, dies schöne, stolze Mädchen zu kennen. Und er selber fühlte in diesen Stunden das leichte, rheinländische Blut reger durch die Adern kreisen: man war ja auch einmal jung gewesen! Nur der Jugend nicht eine harmlose Freude verkümmern!
Ungestört, bis zur letzten Minute, verlief das Zusammensein. Und als man sich auf den Bahnhof von Brochum trennte, geschah’s mit festem Händedruck: Vater Rhein hat’s wieder einmal gut gemeint mit seinen Kindern –
Aber Dorothea war kein Rheinlandskind.
In all den Stunden hatte es wie eine drückende Last zentnerschwer auf ihr gelegen. Was die andern als sprudelnden Frohsinn angesehen, angestaunt hatten – es war ein Spiel gewesen, Komödie. Und dass es nichts andres gewesen war, tat ihr doppelt weh. Sie kam sich wie eine Betrügerin vor, wie eine Gauklerin.
Langsam und schwer stieg sie die Treppe zu ihrer Wohnung hinan.
Es dämmerte schon. Minna hatte bereits Licht. Sie kam in den Korridor, als der Schlüssel im Schloss knarrte. Und es war, als könnte sie im Gesicht ihrer jungen Herrin lesen. „Gnä‘ Fräulein, ist Ihnen nicht gut? Ich sag’s ja – ich sag’s ja – hier werden wir beide noch ganz krank.“
„Bewahre, alte treue Seele. Ich bin ganz wohl. Nur etwas müde – sehr müde.“
Dann saß sie in der Sofaecke, wirklich wie zerschlagen, starrte vor sich hin und sann und sann.
Minna stellte das einfache Abendbrot auf den Tisch, ging auf leisen Sohlen hin und her. Aber selbst die leisen Schritte taten Dorothea weh.
„Herrjemine – die Briefe! Und ’ne Depesche, gnä‘ Fräulein. Und morgen ist ‚Minna von Barnhelm’ –“
Da lagen zwei Briefe. Richtig – und ein Telegramm. Mochten sie liegen bleiben –
Aber schließlich griff Dorothea doch nach dem zusammengefalteten Blatt. Ein Telegramm? – Ein Telegramm bleibt eben ein Telegramm, ein magnetisches Etwas, dem sich selbst der Müdeste nicht entziehen kann.
Die Depesche kam aus Köln: von der Direktion des Stadttheaters. Ja, richtig: der Direktor war ja neulich hier gewesen, hatte sie als Minna gesehen.
„Sind Sie zum Oktober frei? Anbieten, wenn Debüt erfolgreich, dreihundertundfünfzig Mark, zwanzig Mark Spielhonorar. Jahreskontrakt, acht Wochen Sommerurlaub.“
R. P. – Rückantwort bezahlt. – Der gute Mann musste es eilig haben.
Nun erwachte Dorothea doch aus ihrer Träumerei. Da war wieder einmal das Leben, das Leben mit seinem Muss, der Beruf!
Für ihre Verhältnisse ein glänzendes Anerbieten. Man durfte es nicht von der Hand weisen.
Aber da lag ja noch ein Brief, und noch einer –
Ein blauer Umschlag: „Theater-Vermittlungsgeschäft Karl Oskar Braune, Berlin.“
Und der Herr Rat schrieb persönlich. Nicht einmal diktiert hatte er. Da stand in seiner krausen Handschrift mit den hundert Fähnchen und Häkchen, die jede Zeile so schwer lesbar machten wie seine Abkürzungen, die oft die einzelnen Worte wie in einer selbsterfundenen Stenografie wiedergaben. Ganz vertraulich, fast wie ungeschäftlich schrieb der Theatergewaltige. Seine Exzellenz Herr von Rakolski sei auf der Suche nach einer ersten Kraft. Jung sollte sie sein, schön sollte sie sein, begabt sollte sie sein, gleichbegabt für das Klassische wie für die Moderne. Seine Exzellenz hätten ja ihren Namen – Dorotheens Namen – nicht genannt. Sehr erklärlich, denn Seine Exzellenz wollten sich natürlich nicht Protektionswirtschaft vorwerfen lassen. Aber er, Karl Oskar Braune, sei doch auch nicht aus Dummsdorf, Schilda und Umgegend. Also, ob er die Vermittlung offiziell übernehmen sollte. Selbstverständlich würde er auch pekuniär herauszudrücken suchen, was möglich sei. Obschon die pt. Hoftheater – na, das kenne man ja! Aber unter dreihundert Mark kein Rühran. Dann noch als Schlusssatz: „M. M. lässt grüßen, hofft schon Wsehen G. Sie haben ihr Herz erob., ws mir nie glang.“
Gemar! Also doch! Gemar und Köln!
„Mein Stern steigt!“ dachte Dorothea. Sie war nun ganz wach, ganz im Beruf. Und alles Träumen war in ihr erloschen.
Gemar und Köln. Gemar oder Köln. Man musste ruhig überlegen. Es sprach viel für das eine, viel für das andre. Die Wahl war nicht leicht.
Aber da lag ja noch der zweite Brief.
Als sie den elfenbeinfarbenen Umschlag aufnahm, erkannte sie sofort die Handschrift. Der Brief kam von Maurer. Ein wundervolles Zusammentreffen. Gestern Ludolf Kastrop. Heute dies Lebenszeichen von Edgar Maurer.
Aber wenn ihr das Wiedersehen mit Kastrop wider Willen das Blut durch die Adern gejagt hatte, den Brief Maurers öffnete sie ganz kühl.
Er hatte die Verbindung mit ihr nie ganz abreißen lassen. In unregelmäßigen Zwischenräumen hatte er immer wieder an sie geschrieben. Eigentlich stets ohne ersichtlichen Grund. Seine Briefe, bald kurz, bald lang, bisweilen sogar sehr lang, hatten immer etwa eigen Anregendes für sie gehabt, ohne sie doch innerlich zu erregen. Er schrieb wie ein gescheiter Mann, der gern ein wenig geistreichelt. Inhalt und Form pflegten etwas Prickelndes zu haben. Fast stets berührte er nur künstlerische Fragen, sprach wohl etwas viel von sich und seinen Erfolgen, aber zeigte dabei doch auch immer aufs neue Interesse an ihrer Entwicklung. Und ganz im Hintergrund fehlte nie irgendeine diskrete Huldigung. Man musste fast nach dieser suchen, so liebte er sie zu verstecken, und hatte doch immer das Gefühl: er versteckt sie, nur um sie wirkungsvoller zu machen. Bisweilen hatte Dorothea darüber gelächelt, ein paar Male vielleicht sogar gelacht. Und wenn sie antwortete, so war sie selbstverständlich über diese Seite seiner Briefe hinweggeglitten, ohne sie auch nur zu streifen.
Diesmal schrieb er merkwürdig kurz, ganz sachlich. Jetzt sei die Stunde da, der Wendepunkt. Für den Winter würde der Platz für sie in Gemar frei. Nach allem, was er gehört – er wäre neulich zum Genossenschaftstag in Berlin gewesen und dort mit einigen rheinischen Kollegen und Direktoren zusammengetroffen – würde es ihr nicht an anderweitigen Offerten fehlen. Vielleicht sei eine materiell günstigere darunter, als Gemar ihr bieten könnte. Aber sie solle, dürfe nicht schwanken. Ein Hoftheater hätte immer sein besonderes Relief. Gemar zumal sei und bleibe klassischer Boden. Und – Gemar könnte ihr zum Sprungbrett werden für die größten Bühnen Deutschlands.
Dann folgte noch eine Schlusswendung, die allein aus dem Rahmen des Sachlichen herausfiel:
„Dass ich mich glücklich schätzen werde, mit Ihnen gemeinsam tätig sein zu dürfen, wissen Sie. Aber ich muss Ihnen dennoch ausdrücklich aussprechen, dass ich mich herzlich auf unser Zusammenwirken freue. Erlauben Sie mir, mich diesmal zu zeichnen als
Ihr aufrichtig ergebener Kollege und Freund Edgar Maurer.“
Nun saß Dorothea doch wieder und sann, weit zurückgelehnt in die Sofaecke. Sann und sann. Sie war schon fest entschlossen gewesen für Gemar. Die wenigen Schlussworte Maurers aber hatten sie wieder schwankend gemacht. Vielleicht sogar nur das eine Wort: „Freund!“
Es bäumte sich in ihr etwas gegen dies eine Wort auf. Als sie ein Kind gewesen war, hatte die Mutter bisweilen, wenn sie trotzig und hochmütig war, gesagt: „Diebel, der Bock stößt dich!“ Ähnlich war’s jetzt: der Bock stieß sie. Sie dachte: „Wie kommt dieser Mann dazu, sich deinen Freund zu nennen?“ Und im gleichen Atemzuge dachte sie dann: „Deinen Freund nennt er sich, und du musst mit ihm zusammen auf der Bühne stehen, er wird seine Arme um dich legen dürfen, seine Lippen werden deine Wange streifen, und du wirst stillhalten müssen.“ Noch niemals hatte sie eine ähnliche Empfindung gehabt, das eine Wort „Freund“ erst löste sie aus.
Sie sann und sann. Und allmählich kam doch eine ruhigere Auffassung über sie. Nun ja: Maurer interessierte sich für sie; interessierte sich wohl nicht nur für die Künstlerin, sondern auch für die Frau in ihr. Was tat es schließlich? Sie würde ihn schon in den Schranken zu halten wissen. Und das eine Wort – das eine dumme Wort! Aber die Bühne bringt es nun einmal so mit sich, dass der Künstler hohe Worte leicht ins praktische Leben überträgt, ohne ihnen ein besonderes Gewicht beizumessen. Es war eben ein Wort – ein Wort, wie viele andre. Man musste es nicht auf die Waagschale legen, oder tat man es doch, dann wog es gewiss leicht.
Plötzlich sprang sie auf und rief laut ins Nebenzimmer, wo Minna gerade noch an der Toilette für die andre Minna für morgen Abend bügelte: „Wir gehen nach Gemar!“
Da kam die Alte hereingelaufen und schlug die Hände zusammen.
„Nach Gemar? Ist ’ne Möglichkeit! Nach unserm lieben, schönen Gemar! Gnä‘ Fräulein, gnä‘ Fräulein, unser guter Gott lebt noch. Ich dacht‘ schon, er wollt‘ von mir nix mehr wissen. Aber nu is ja alles gut. In Gemar werd‘ ich gewiss noch mal gesund!“
Ihre Exzellenz Frau von Rakolski saß im Lehnstuhl am Fenster. Rechts von ihr hockte Siddy mit dem rosenroten, Liddy mit dem marineblauen Seidenbändchen um den Hals, während Piddy das stahlgrüne Bändchen links von der Gebieterin in Parade trug. – Frau von Rakolski hatte ein schweres Jahr hinter sich, denn sie hatte noch fünfzehn Pfund an Gewicht zugenommen. Aber sie trug ihre Bürde mit Würde. Die hellen Äugelchen blickten noch ganz so leutselig und lustig aus dem guten Gesicht hervor, wie vor einem Jahre, und das Züngelchen war noch gerade so lebendig wie damals.
Ihrer Exzellenz gegenüber saß Dorothea von Lindenbug.
„Also da hätten wir dich ja endlich wieder, mein Diedelchen. Heil! Heil! Heil! Die erste gute Idee, die mein Fritzle seit Jahren gehabt hat. Lass dich mal anschauen. – Prachtvoll! Etwas voller bist du geworden, und das steht dir vorzüglich. Ich sehe schon, wie sich die Operngläser auf mein Diedelchen richten werden. Na und – und die Allerhöchsten Herrschaften. Hm – ja! Und der ganze Hof – mitsamt dem Schranzengesindel und all dem dazugehörigen grasgrünen Neid.“
Sie unterbrach sich, hob etwas mühevoll den rechten Arm, spreizte den Zeigefinger ungefähr in der Richtung, wo sie Dorotheens Herz vermuten mochte: „Du, Diedelchen, na – und das dumme Ding da? Nun – heraus mit der Sprache – hat’s schon ordentlich geklopft?“
„Gehämmert hat’s, Tante. Aber nur, wenn ich vor irgendeiner neuen, großen Aufgabe stand.“
„Ach du meine Unschuld! Oder auch – du Heuchlerin! Als ob ich danach frage. Ich meine doch – aus Liebe.“
„Nein, Tante Gertrud. Mein Herz ist ein Kieselstein geworden.“
Die kleinen, hellen Augen konnten doch recht scharf blicken. Aber Dorothea hielt stand. Sie lächelte nur ein wenig, aber in dem Lächeln lag keine Spur von Verlegenheit.
„Also gewiss und wahrhaftig nicht, Diedelchen? Na, dann desto besser. Denn, weißt du – – die Männer! Die Männer taugen alle nix, mein Fritzle nicht ausgenommen. Ich könnte dir Geschichten erzählen.“
„Lieber nicht, Tante. Bedenke doch, mein hoher Chef!“
„Ah, Chef hin, Chef her! Aber halt‘ du dein Herz nur fest. Möglichst lange. Schließlich kommt doch einmal einer, der darauf haucht, dass die Kieselschicht abfällt; ja, aber der Rechte muss es sein. Weißt du, der Rechte, – einer, der es brav meint.“
„Sei ohne Sorge, Tante. Ich bin gefeit.“
Tante Gertruds helle Augen glitten wieder forschend und prüfend über das schöne, stolze Gesicht. Dann nickte Frau von Rakolski, als ob sie zufrieden wäre vom Befund ihrer Inspektion, und sprang nach ihrer Art schnell zu einem andern Thema über.
„Also, natürlich habe ich deine Laufbahn verfolgt, Schritt um Schritt. Na, weißt du, was in den Agentenblättern steht, darauf pfeife ich. Man hat ja den Rummel kennengelernt, wenn man so lange indirekt an einem Thespiskarren (Wohnwagen wandernder Schauspieler) mitgeschoben hat – sozusagen. Aber was mir der Edgar Maurer erzählt hat, das hat mich gewaltig interessiert. Der war ja Feuer und Flamme.“
Diesmal zuckte es doch ein wenig um Dorotheens Mund, als die Augen der alten Dame sie wieder fragend umspähten. Freilich nur auf eines Gedankens Länge; dann schürzte sie die Lippen: „Sehr gütig von dem Herrn Kollegen.“
„Hm –Diedelchen – der Maurer weiß, was er sagt. Er hat einen guten Geschmack. Ich meine natürlich, für seine Kunst. Ja –“ Und Tante Gertrud sprang wieder jäh von ihrem Thema ab. Sie kam auf den Hof zu sprechen.
Das pflegte sie stets mit einigen absonderlichen Handbewegungen einzuleiten. Erst beschrieb sie einen großen Kreis in der Luft, dann einen etwas kleineren, dann einen ganz kleinen, dann noch einen, und schließlich steckte sie den Daumen senkrecht in die Höhe. Der ganz große Kreis – so ließ es sich deuten – waren die „Untertanen“, der kleinere war die „Gesellschaft“ im weiteren Sinne, der dritte stellte die „Hofgesellschaft“ vor, der vierte die „Herrschaften“, – der Daumen war der Herzog.
„Es ist lebendiger geworden hier, Diedelchen. Na, du wirst das ja bald selber sehen, auch aus deiner Perspektive. Mein Fritzle merkt es auch, denn er sagt: die Kasse ist gut. Besonders im Winter. Wir haben viel Fremde. Der Hof regt sich halt eben mehr. Die Herzoginmutter, na, du weißt ja, die hatte immer viel übrig für das Theater. Zuviel sogar, sagen manche Leute. Eine Theaternärrin wär sie, sagen manche Klatschmäuler. Na, warum soll denn die Allergnädigste nicht das eine Vergnügen haben. Nun – und der Herr? – Seine Königliche Hoheit, – großartig, sage ich dir, Diedelchen, du wirst erstaunt sein. Voller Interessen, voll Arbeitslust, manchmal sollen die Geheimen Räte ihr Kreuz zu tragen haben.“
Das Gesicht Ihrer Exzellenz strahlte. Es strahlte ja immer, wenn Tante Gertrud sich für irgendjemand begeisterte.
Doch dann legte sich ein leichter Schatten über die breiten Wangenflächen. „Ja, so leutselig und so gnädig gegen hoch und gering. Man muss den hohen Herrn liebhaben. Aber, darüber ist auch nur eine Stimme, es ist ein rechtes Unglück, dass er sich nicht vermählen will.“
„Wenn er nun nicht mag, Tante Gertrud! Er wird eben die Rechte auch noch nicht gefunden haben. Vielleicht ist sein Herz auch ein Kieselstein!“ sagte Dorothea lachend.
„Kind, wie du so reden kannst? Er ist siebenundzwanzig Jahre! Und der einzige Agnat, der Prinz Joachim – dir kann ich’s ja sagen, obgleich Fritzle mich kreuzigen würde – der gute Prinz Joachim ist, mit Respekt zu vermelden, ein Trottel. Er hat nicht so viel Verstand wie Liddy oder Siddy, von Piddy ganz zu schweigen, denn Piddy ist klüger wie mancher Mensch. Was, mein Piddychen, habe ich nicht recht? Ja, siebenundzwanzig Jahre, und wenn er unvermählt bliebe –“
„Schrecklich!“
„Es wäre auch wirklich schrecklich, wenn einmal das schöne Ländle an Preußen fallen sollte! Du glaubst gar nicht, wie das hier die Herzen und die Gemüter bewegt, und wie man sich bei allen Höfen um den hohen Herrn bemüht. Erst sollte es eine russische Großfürstin sein, dann war es eine dänische Prinzessin, dann eine von Gerz-Schlotheim-Berleburg – ein Dutzend Prinzessinnen ist es mindestens gewesen, das man ihm auf dem Präsentierteller sozusagen angebracht hat. Aber, ja Kuchen! – Und dabei ist er so lebensfrisch und so bild- – bild- – bildschön, Diedelchen. Aber du wirst ihn ja bald selber sehen, und dann halte du nur deinen Kieselstein fest. – Aber nun wollen wir doch endlich einmal ernstlich von dir und deinem Beruf sprechen.“
Gleich am ersten Tage hatte sich Dorothea dem Intendanten vorgestellt; gleich am ersten Tage hatte sie auch Edgar Maurer begrüßt. Er war zu ihr in das Hotel gekommen, mit einem riesigen Strauß La France-Rosen und mit der Miene des ergebenen Kollegen; nicht des „Freundes“, wie Dorothea sofort mit einem Gefühl der Genugtuung empfand. Ihre etwas vorsichtig kühle Antwort auf seinen letzten Brief schien also ihre Schuldigkeit getan zu haben.
Vielleicht hatte sie recht. Aber ihr sonst so scharfes Auge konnte sich auch täuschen, denn sie war heute nicht recht aufgelegt, nicht recht geschaffen für Menschenbeobachtung. Anders und doch ähnlich wie fast genau vor Jahresfrist erging es ihr heute und hier; das alte Gemar mit seinen Erinnerungen an die Eltern, an die Jugendzeit, mit der Erinnerung an ihre erste leidenschaftliche Liebe wirkte zu mächtig auf sie ein. Da hatte sie nun geglaubt und fast gehofft, diese erste Liebe sei eingesargt, sei überwunden und die Wunden hätten sich geschlossen für immer, und doch zwang es sie vor allem andern zu dem Gang hinaus in den stillen Park, wo sie einst mit ihm gesessen, seinen Worten gelauscht, sich an seiner Liebe berauscht hatte.
Nein, sie war heute keine scharfe Menschenbeobachterin, konnte heute nicht in den Seelen lesen. Sie war zerstreut, folgte ohne rechte Aufmerksamkeit dem, was Edgar Maurer sagte, erkannte nicht, was hinter seinen Worten stand. Sie hörte nur, dass er ihr seine Dienste, seine Zeit völlig zur Verfügung stellte, – hörte, was er von dem Repertoire der nächsten Zeit erzählte, und sie antwortete flüchtig, hier mit einem halben Ja, dort mit einem halben Nein, und wusste wohl selbst im nächsten Augenblick nicht mehr genau, was sie gesagt hatte.
Sie saßen noch unten in dem etwas frostigen Lesezimmer des „Pelikans“ sich gegenüber, als der Hotelportier den alten Intendanturdiener Emke herein lancierte.
Herr Emke machte zwei seiner tiefsten Komplimente, trat von einem Fuß auf den andern und wickelte dabei aus wachsledernem Überzug eine dickleibige Mappe heraus.
„Gehorsamst zu melden, die Rollen für das gnädige Fräulein – gehorsamst zu melden, für die nächste Zeit. Und seine Exzellenz und Herr Ecker lassen bitten, die ‚Julia’ zuerst vorzunehmen. Mich gehorsamst zu empfehlen, gnädiges Fräulein!“
Worauf er immer noch stehenblieb und von einem Fuß auf den andern trat, während er unglaublich langsam seinen wachsledernen Überzug zusammenrollte. Maurer lächelte und raunte Dorothea zu: „Le pourboire“ (Trinkgeld)– und nun begriff sie endlich.
„Mich gehorsamst zu bedanken, gnädiges Fräulein –“
Nun war er endlich hinaus.
„Verzeihen Sie“, sagte Maurer, dass ich Sie darauf aufmerksam machte. Aber man braucht auch diese Leute, und ein Markstück tut da oft Wunder. Aber – wenn Sie erlauben – wollen wir doch einmal flüchtig zuschauen, was Ihnen die hohe Intendanz zugedacht hat.“
Dorothea konnte zufrieden sein. Die „hohe Intendanz“ traute ihr viel zu. Da war die Julia, die sie noch nie gespielt hatte und auf die sie sich besonders freute; die „Jungfrau von Orleans“ war für die nächste Zeit vorgesehen und merkwürdigerweise das Klärchen im „Egmont“. An modernen Rollen hatte man ihr das Rautendelein zugedacht – („die ‚Versunkene Glocke’ hat von allen Hauptmannschen Dramen allein hier Heimatrechte, “ schob Edgar Maurer etwas sarkastisch ein) – dann die „Hedda Gabler“ von Ibsen, die „Monna Banna“ („auf mein dringendstes Bitten!“ und „Madame Sans–Gêne“ („ein Lieblingsstück der Herzoginmutter“).
„Nun ja, gnädiges Fräulein, wo Licht ist, muss auch Schatten sein.“ Maurer legte die Rollen wieder zusammen. „Wir sind hier hübsch konservativ, und Exzellenz von Rakolski ist ein wenig bequem geworden. Bequem werden ist wohl der Fluch aller Hoftheaterintendanten, und sie haben’s meist so leicht, sich hinter den angeblichen oder wirklichen Abneigungen der Allerhöchsten Herrschaften gegen die Moderne zu verschanzen. Sie haben auch die berühmte ‚Tradition’ für sich und für ihre wohlweise Beschränkung auf ein vorwiegend klassisches Repertoire. Indessen – wenn uns auch damit so manche neue Aufgabe entgeht – wir kommen bei den Klassikern immer noch auf unsre Rechnung.
„Ich freue mich darauf, “ war Dorothea lebhaft ein. „In Brochum wurden die Heutigen fast zu einseitig bevorzugt.“
Er nickte. Man wusste, wenn Edgar Maurer den Kopf neigte, nie genau, war’s wirklich eine Zustimmung, oder bedeutete es eine leere Höflichkeit. Und dann irrte wieder ein Lächeln um seinen Mund: Schließlich ist’s auch Temperamentssache. Aber zerbrechen wir uns nicht den Kopf von Exzellenz von Rakolski. Ich vermute, dass Seine Hoheit diesem armen Kopf noch genug Rätsel zu lösen aufgeben werden.“
„Wie meinen Sie das?“
„Schwer zu sagen, gnädiges Fräulein. Der Herzog ist sehr impulsiv, und es will mir bisweilen scheinen, als ob er nicht gerade übermäßig zufrieden wäre mit – ja, wie drücke ich’s nur aus? – mit dem langsamen Tempo, in dem unsre Bühne den Bewegungen der Literatur folgt.
Dorothea war doch neugierig auf diesen jungen Fürsten, dessen Lob ihr überall entgegen klang.
Sie kannte ihn ja. Er war sogar sehr artig – Pardon, gnädig! – gegen sie gewesen. Ein-, zweimal bei den Bällen im Residenzschloss, dann bei einer kleinen Theatervorstellung, in der sie einst mitgewirkt hatte. Aber das war nun vier Jahre, nein, fast fünf Jahre her. Sie war selber damals gerade den Backfischkleidern entwachsen gewesen, und der Herzog hatte gerade die Regierung angetreten. Heute ging er ins Siebenundzwanzigste – was hatten diese Zwischenjahre ihr bedeutet, was mochten sie ihm gewesen sein! –
Damals war er noch etwas befangen gewesen. Sie musste lächeln bei der Erinnerung, wie er ihrer jungen Schönheit ein wenig zu huldigen versucht hatte, mit dem leisen Sorgengefühl, sich nur ja nichts zu vergeben. Aber man hatte ihn damals schon gern gehabt. Zumal die jungen Offiziere hatten für ihn geschwärmt und merkwürdigerweise auch die alten Tanten. Die einen nannten ihn einen lustigen Herrn oder gar einen „famosen Kameraden“, der Ruf ging ihm auch von Potsdam nach, wo er zwei Jahre bei dem Gardedukorps gestanden; die anderen meinten, er erinnere in allen Wesenszügen an seinen Urgroßvater, der einst am Hofe von Gemar einen erlesenen Kreis schöner Geister um sich geschart hatte. Vielleicht mochten die einen und die andern recht haben; der Ahne war auch ein lustiger Herr gewesen und seinen geistreichen Genossen ein guter Kamerad.
Und ein großer Theaterfreund obendrein! Vielleicht erbte auch das im Blut sich weiter. Und kein Verächter weiblicher Schönheit.
Dorothea war wirklich neugierig auf den Herzog August-Otto. Aber sie musste Geduld haben, denn Seine Hoheit residierte zurzeit noch in Richardsbrunnen, dem kleinen Jagdschloss hoch oben in den Bergen. Frau von Rakolski behauptete steif und fest, dorthin flüchte er immer, wenn wieder einmal diplomatische Fäden gesponnen würden, ihn ins Ehegarn einzufangen.
Und dann tauchte die Gestalt des Herzogs, mit der sie sich ein paar Augenblicke lebhafter beschäftigt hatte, wieder unter in die Flut der Erinnerungen, die Gemar für sie belebte, und in die Sorgen der Alltäglichkeit und in die Freuden des Berufs.
Sie empfand doch den Abstand zwischen dem Stadttheater in Brochum und der Hofbühne; empfand ihn stärker noch, als vorher den andern zwischen der Direktion Krauthaar und der Direktion Neesemann. Der ganze Zuschnitt, der Ton war höher gestimmt, ruhiger, gelassener, vornehmer. Es herrschte eine gemessene Höflichkeit, eine stille Rücksichtnahme, von oben nach unten, wie zwischen den Kollegen. Man war gesellschaftlich erzogen oder mühte sich wenigstens, eine „gute Kinderstube“ zu beweisen. Und wenn hinter den guten Formen auch hier und dort Missgunst und Neid stehen mochten: auf Dorothea wirkten jene guten Formen darum nicht minder angenehm. Nur das Verhältnis zu Seiner Exzellenz dem Herrn Intendanten war ein wenig peinlich. Aber Herr von Rakolski hatte den richtigen Takt, sich „im Dienst“ durchaus geschäftlich zu Dorothea zu stellen, und das erleichterte ihr ihre Position wesentlich. Zu Hause gab er sich freier. Er sagte ihr jedoch schon beim ersten Zusammensein: „Wundern Sie sich nicht, Fräulein von Lindenbug, wenn ich Ihnen als ein besonders strenger Vorgesetzter erscheine.“ Worauf seine Frau die dicken Bäckchen noch etwas mehr aufblies und heraussprudelte: „Fritzle, mach‘ dich nur nicht lächerlich!“
Der Beruf, gewiss, sie konnte zufrieden sein mit dem, was ihr geworden. Aber die Sorgen des Alltags standen daneben. Der elende, elende Mammon! Sie war in ihrem Einkommen so schnell gestiegen, vielleicht wie kaum eine zweite deutsche Schauspielerin in der gleichen Zeit; es hatte sich in Jahresfrist mehr als vervierfacht. Es musste, musste jetzt endlich möglich sein, ein ordentliches Haushaltsbudget aufzustellen und zu balancieren, man musste endlich auskommen können. Aber ach, in demselben Atemzuge fast, in dem Dorothea das dachte, wurden die besten Vorsätze schon wieder über den Haufen gerannt. Und das Defizit war von neuem da!
Herzogliche Hofschauspielerin! Es war schon nicht anders, man musste doch dementsprechend auftreten. Würden bringen Bürden. Selbst Minna, die sparsame Minna, sah das ein.
„Gnä‘ Fräulein, in Gemar müssen wir ’ne anständige Wohnung haben. Wo uns jeder Mensch kennt. Lassen Sie mich man sorgen, gnä‘ Fräulein. Ich will schon was Bill’ges finden. Und dann –
„Was denn noch, Minna.“
„Dann lassen wir uns die in Blankenburg beim Spediteur stehenden Möbel kommen, gnä‘ Fräulein, und dann richten wir’s uns recht scheene ein.“
So geschah’s denn auch. Es war ja auch richtig: man blieb ja aller Voraussicht nach ein paar Jahre in Gemar. Aber die Wohnung war nicht so billig, wie Minna geglaubt hatte, und das Einrichten kostete Geld! Geld! Geld! Es kannte einen „jeder Mensch“, und die „Herzogliche Hofschauspielerin“ hatte nun andern Kredit als das Mitglied der „Speelers“ in Neumöller. Die Lieferanten drängten die Waren geradezu auf; die Schneiderin wollte sogar keine Rechnung bringen.
„Minna, Minna – wir geraten in Schulden!“ barmte Dorothea.
Dann kraulte Minna sich hinter dem rechten Ohr und machte ein pfiffiges Gesicht. „In Gemar tut das nix, gnä‘ Fräulein. Der Herr Major haben hier immer Rechnungen gehabt – die Menge und Masse. Das seien die Leute hier so gewöhnt.“
Der gute Papa! Aber sollte, durfte sie seine Wege wandeln?
Es gab ein paar schlaflose Nächte. Dorothea hatte das leichte Blut nicht, sich mit solchen Schwierigkeiten schnell abzufinden. Sie grübelte und grübelte. Einen Ausweg sah sie nicht – es sei denn die Möglichkeit, in den Ferien durch Gastspielreisen aus dem Defizit herauszukommen. Vielleicht gelang das. Es war wenigstens eine Hoffnung.
Gerade noch die Hotelrechnung im „Pelikan“ konnte sie begleichen – und der Gemarer „Pelikan“ war teurer als der „Schwarze Rabe“ in Neumöller! Dann war das kleine, braune Portemonnaie leer und sie arm wie eine Kirchenmaus. Zum ersten Male musste sie den schweren Gang gehen, den sie schon so viele Kollegen und Kolleginnen leichten Herzens hatte gehen sehen, und um Vorschuss bitten.
„Wie viel darf ich Ihnen anweisen, gnädiges Fräulein? Bitte, an der Hauptkasse drüben.“
Es war so bequem, es war so leicht! Doch die beiden „blauen Lappen“ brannten, als Dorothea sie in Empfang nahm, wie Feuer in ihren Händen. Sie sagte sich selber: „Sei doch ein bissel leichtherziger! Ein Künstler, eine Künstlerin muss es sein!“ Aber es gelang ihr nicht. Und dann wusste sie ja: was waren zweihundert Mark! Sie waren die Hälfte einer Monatsgage, und – sie waren ein Tropfen auf einen heißen Stein.
So kam der Tag ihres ersten Auftretens heran.
Dorothea war in großer Erregung. Zum ersten Male eigentlich hatte sie etwas wie Lampenfieber. Die Probe war zwar vorzüglich verlaufen. Exzellenz von Rakolski war zufrieden, der gestrenge Ecker war zufrieden, Edgar Maurer schien entzückt. Aber was wollte das alles besagen? Sie kannte ja nun längst das beliebte Bühnenschlagwort, nach dem „beim Theater immer alles anders kam“.
Sie war in großer Erregung. Und dabei war doch auch eine große Freude in ihr. Wie ein Kind freute sie sich, als sie am Morgen an den Anschlagtafeln las: „Romeo und Julia“, und „Julia, Capulets Tochter – Fräulein von Lindenbug.“
Wie ein Kind freute sie sich, als sie mit einem fast scheuen Blick erkannte, dass eine kleine Menschenansammlung vor der Tageskasse des Hoftheaters sich staute. Wie ein Kind freute sie sich, dass in der Hofbuchhandlung Weber & Sohn eine große Fotografie von ihr ausgestellt war. Freute sich auch, dass sie brillant darauf aussah. Und dass darunter stand: „Fräulein Dorothea von Lindenbug, Herzogliche Hofschauspielerin, als Madame Sans-Gêne“.
Dann kam doch wieder das unsichere Angstgefühl über sie, als sie sah, dass auf dem Residenzschloss die Flagge wehte. Der Herzog war also in Gemar – ob er wohl im Theater sein würde?
Das Angstgefühl wuchs und wuchs während des ganzen Tages. Es erreichte seinen Höhepunkt, als sie in der Garderobe die letzte Hand an ihre Toilette legte, während draußen auf der Bühne schon die ersten Szenen sich abspielten. Die Knie bebten ihr, als sie, des Stichworts harrend, stand –
Und dann war sie mit einem Male ganz ruhig. Sicher und ganz ruhig. Sie hörte und unterschied das leise Rauschen der Erwartung im Zuschauerraum bei ihrem Auftreten. Ihr Auge glitt flüchtig über die Ränge und das weite Parkett. Dann versank alles vor ihr.
„Sag‘ mir, liebe Tochter,
Wie steht’s mit deiner Lust, dich zu vermählen?“ sprach die Gräfin Capulet zu ihr. Und sie antwortete, mit gesenktem Köpfchen:
„Ich träumte nie von dieser Ehre noch.“
Weiter fragte die Mutter: „Sage kurz: Fühlst du dem Grafen dich geneigt?“
Und sie hob den Kopf ein wenig, senkte ihn wieder und sprach:
„Gern will ich sehn, ob Sehen Neigung zeugt,
Doch weiter soll mein Blick den Flug nicht wagen,
Als ihn die Schwingen Eures Beifalls tragen.“
Das Werk, die Dichtung, ihre Aufgabe hatten Dorothea im Bann. Und wie tagsüber die Sorge: „Wird’s auch gelingen?“ sie gedrückt, sich gesteigert hatte von Stunde zu Stunde, so fühlte sie sich nun von Minute zu Minute freier, wuchs von Szene zu Szene mehr in das Speil hinein.
Auf den Proben hatte sie es lebhaft und dankbar empfunden, welch vorzüglicher Partner ihr Edgar Maurer war. Jetzt fühlte sie es weit weniger. Sie lehnte sich an ihn nicht mehr an, sie hing nicht mehr von ihm ab, als es die Rolle erforderte. Sie war selbständig geworden. Sie gab sich voll aus. Und nur bisweilen, aber dann zwingend, tauchte in ihr die Erinnerung an die Studien auf, an die fleißige Vorarbeit, die sie der Rolle gewidmet hatte, so dass sie wohl die Empfindung hatte wie auf dem Untergrund des Bewusstseins; es ist doch ein Segen und ein Glück, dass du die Julia so sorgsam studiert hast.
Das vollbesetzte Haus kargte nicht mit seinem Beifall. Schon nach dem ersten Akt prophezeite Maurer: „Wir haben einen schönen Erfolg, und das freut mich für Sie!“ Nach der großen, von Poesie durchglühten Szene im zweiten Akt zwischen Romeo und Julia schwoll der Beifall mächtig an, und alle fühlten auf der Bühne, dass er in erster Reihe Dorothea von Lindenbug galt, jedes Wort fast hatte gezündet, zumal die schönen, innigen Verse, in denen sie Romeo scheiden heißt:
„Es tagt beinah, ich wollte min, du gingst.
Doch weiter nicht, als wie ein tändelnd Mädchen
Ihr Vögelchen der Hand entschlüpfen lässt,
Gleich einem Armen in der Banden Druck,
Und dann zurück in zieht an seidenem Faden,
So liebevoll missgönnt sie ihm die Freiheit.
Nun gute Nacht! So süß ist Trennungswehe –
Ich rief wohl gute Nacht, bis ich den Morgen sähe!“
Dann schlug das kurze, wundervolle Zwiegespräch von seligem Glück nach der heimlichen Hochzeit mit voller Gewalt ein:
„Willst du schon gehen, der Tag ist noch so fern.
Es war die Nachtigall und nicht die Lerche,
Die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang.
Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort.
Glaub‘, Lieber, mir, es war die Nachtigall.“
Es glückte heute alles, alles. – Alles fand die rechte Stimmung, den Widerhall bei den Zuschauern. Sie zitterte um Romeo, sie erlebte Julias Glück und Julias Leid mit. Bis der Tod die Liebenden, die das Leben getrennt, einte.
Als der Vorhang zum letzten Mal gesunken war, mussten Julia und Romeo noch drei-, viermal vor die Rampe. Ganz langsam nur leerte sich der Zuschauerraum.
Und nun kam doch der Rückschlag für Dorothea.
Sie war aufs Äußerste erschöpft. Einen Augenblick hielt sie sich, mit geschlossenen Augen, an Maurer fest; ihr war’s, als müsse sie sonst umfallen.
Er lächelte. Er kannte ja dieses seltsame Rauschgefühl, diese Ermattung aller Nerven nach höchster Spannung und zugleich dies wonnevolle Siegesbewusstsein. Vorsichtig geleitete er sie bis zur Tür ihrer Garderobe und küsste ihr die Hand: „War’s schön, Julia?“
Sie nickte nur. Und dann saß sie, wie zerbrochen, in der Garderobe, die Hände im Schoß verschränkt, mit hängendem Kopf, ließ Minna um sich her wirtschaften, hörte nicht, was die treue Seele berichtete – ihr war der Abend wie ein Traum.
Sie saß noch im Sterbegewand, unabgeschminkt, nur das Haar hatte Minna schon mit leichten Händen aufgesteckt, da pochte es an der Tür: „Fräulein von Lindenbug – Fräulein von Lindenbug! Bitte!“
Es war die Stimme des Intendanten. Da schreckte sie auf und hieß Minna öffnen.
Exzellenz von Rakolski steckte nun den Kopf zur Tür herein.
„Darf ich? Meinen Glückwunsch! Aber nun schnell! Die Herrschaften sind im Teesalon. Ihre Hoheit wünscht Sie zu sehen.“
„Exzellenz – ich bin noch im Kostüm.“
Er war erregt, er vergaß sogar die Förmlichkeiten an denen er sonst festhielt: „Ach was, Fräulein Diedel, gerade so ist’s recht. Sie können sich schon so sehen lassen! Nur schnell ein bissel abschminken – ganz fix – und dann vorwärts – vorwärts!“
Durch einen schmalen Gang, über eine enge Stiege führte er sie, hastig plaudernd. „Es war famos. Maurer und Sie – Sie und Maurer – einfach famos! Die Herrschaften sind entzückt. So, da wären wir. Schon nach dem zweiten Aufzug haben Ihre Hoheit befohlen, dass der Tee hier genommen werden soll – ist lange nicht vorgekommen, zum letzten Male, als die Duse gastierte.“
Er öffnete die Tür und ließ Dorothea vorantreten.
Es war ein winziger Raum hinter der herzoglichen Loge, fensterlos, die Wände mit dunkelrotem Brokat überspannt; ein kleines Tischchen in der Mitte und ein paar Sessel. In einer Ecke ein Servierschrank, neben dem ein Hoflakai in militärischer Haltung, gerade aufgerichtet wie ein Grenadier, stand.
An dem Mitteltisch saß die Herzoginmutter allein. Im Hintergrund stand eine kleine Gruppe, zwei hochgewachsene Herren in Uniform und eine Dame.
Dorothea machte ihre tiefe Verbeugung vor der Greisin. Und unwillkürlich dachte sie an ihre erste Vorstellung bei Hofe zurück. Die alte Dame sah noch genauso aus wie damals. Ganz unverändert war das rundliche, rosige Gesicht mit dem Silberhaar darüber, die Augen blickten noch frisch und hell, fast jugendlich, und der Mund hatte noch das gleiche Lächeln – gütig und ein wenig überlegen.
Gerade stellte die hohe Frau die Teetasse auf den Tisch. Sie winkte leicht mit der Hand und reichte sie dann Dorothea zum Kuss.
„Wer hätte das gedacht, dass wir die kleine Lindenbug hier als große Künstlerin sehen würden“, sagte sie freundlich. „Ich gratuliere Ihnen, mein Kind. Es war ein schöner Abend, wirklich genussreich. Übrigens erstaunlich, dass Sie die Julia, wie mir Exzellenz sagte, zum ersten Male gespielt haben. Wo waren Sie bisher?“
Dorothea gab Auskunft. Kurz und knapp, sie wusste ja, dass hohe Herrschaften selten viel Zeit haben, und sie war darauf gefasst, nun in Gnaden entlassen zu sein.
Aber die Herzoginmutter war andern Sinnes.
„Also wirklich Anfängerin? Desto erstaunlicher. Mir hat Ihr Spiel ungemein gefallen. Zumal die Innigkeit, mit der Sie sprachen. Freilich, Ihr schönes Organ kam Ihnen da prächtig zu Hilfe. Vielleicht hätten Sie etwas mehr Leidenschaft entwickeln können.“ Sie wandte sich um. „August-Otto, bitte.“
Während der ganzen letzten Worte der hohen Frau hatte Dorothea zwei Augen auf sich gerichtet gefühlt. Nur gefühlt, aber mit intensivster Gewissheit. Nun erst, während sie dem Herzog die zweite tiefe Verbeugung machte, sah sie diese großen, dunkelblauen Augen und empfand: „Warum blickt er so schwermütig? Er müsste doch glücklich sein. Jung, auf der Höhe des Seins, schön, geliebt – warum ist er nicht glücklich?“
„Lieber August-Otto, du hast da vorhin etwas sehr Zutreffendes gesagt!“ sprach die Greisin weiter. „Über Julias Liebe zu Romeo. Ich sprach gerade mit unsrer Julia hier von ihrer Auffassung. Wie war’s doch?“
Der Herzog hatte im Näherkommen die Verbeugung Dorotheas liebenswürdig erwidert. Nun stand er hinter dem Stuhl der Mutter, die schmale Hand auf der Rücklehne. Er lächelte. Aber auch sein Lächeln hatte etwas Schwermütiges. Er sah doch ganz anders aus, als noch vor vier Jahren.
„Liebe Mama, was ich sagte, ist wohl nur eine ganz persönliche Auffassung. Und Fräulein von Lindenbug war so vortrefflich – wahrhaftig, gnädiges Fräulein – dass ich Ihrer Leistung gegenüber meine Meinung lieber für mich behalten möchte.“
„Ach, ich bitte dich, August-Otto! Du hattest ganz recht. Sprich nur!“
„Da du befiehlst, Mama. Ich meinte, wir Deutschen hätten uns allzu sehr gewöhnt, in der Julia das Hohelied der Liebe, wie wir Germanen sie auffassen, zu sehen. Shakespeare aber habe die Romanin geschildert, die leidenschaftliche Veroneserin. Und er wollte die furchtbare Gewalt zeichnen, die diese Leidenschaft ausübt in all ihrer, jede Überlegung umnebelnden Wirkung. Ich meinte also wohl, die Julia vertrüge, ja fordere sehr starke Akzente.“
Es war ein seltsamer Wohllaut in seiner Stimme, die bei aller Frische etwas eigen Weiches hatte.
„Übrigens, Fräulein von Lindenbug, sagte ich das alles nicht in Bezug auf Ihre Julia. Ich sagte es vielmehr in Bezug auf einen Gegensatz, den ich zwischen Julia und Romeo, wie sie uns der große Dichter geschildert hat, zu sehen glaube. Die Leidenschaft, meine ich nämlich, weckt in der Frau, in Julia, ungeahnte neue Kräfte, lässt sie schließlich sogar vor dem Wagnis des Schlaftrunks nicht zurückschrecken. Den Mann aber, Romeo, verwirrt die Leidenschaft nur. Freilich ist mir Romeo nie recht als Mann erschienen – mehr als schwankender, als ein liebenswürdiger aber schwacher Mensch.“
Es war wirklich interessant, was der Herzog sagte. Ganz abgesehen davon, dass es eben der Herzog war, der es sprach. Interessant war es, gescheit, gerade weil es von der allgemeinen Auffassung abwich.
Die Herzoginmutter nickte lebhaft. Sie mochte ähnlich empfinden.
„Sie hatten einen vorzüglichen Romeo“, warf sie ein.
„Die Rolle liegt Herrn Edgar Maurer vortrefflich. Ich habe noch den großen Devrient als Romeo gekannt, dann auch Robert, schließlich vor ein paar Jahren Kainz – aber der Romeo Maurers gibt den ihren wenig nach. In welchen Rollen werden wir Sie denn demnächst sehen, liebes Kind?“
Wieder gab Dorothea knapp und kurz Auskunft, mit dem lächelnden Zusatz: „Wenn Exzellenz nicht anders befehlen.“
Exzellenz von Rakolski beeiferte sich, zu bestätigen, dass die Repertoireangaben richtig seien.
„Steht die ‚Nora’ auf Ihrem Repertoire, gnädiges Fräulein?“ fragte der Herzog.
„Gewiss, Königliche Hoheit.“
„Dann sollten Sie uns die ‚Nora’ nicht vorenthalten. Überhaupt, liebe Exzellenz, ich wünschte wohl, dass Sie die moderne Dichtung etwas mehr berücksichtigten. Ibsen, Björnson, dann Gerhart Hauptmann – auch die ‚Elektra’ von Hoffmannsthal möchte ich auf das Repertoire gesetzt wissen, wenn nicht zwingende Gründe dagegen sprechen. Unsre großen Meister in Ehren – – aber ich fürchte, wir versteinern ein wenig.“
Exzellenz verbeugte sich wortlos.
Dann reichte die Herzoginmutter Dorothea noch einmal die Hand zum Kuss. „Auf Wiedersehen, mein Kind!“
Die Audienz war zu Ende.
Dorothea machte ihre zwei Verbeugungen, die eine war zur Greisin, die andre zum Herzog gewendet. Rückwärts, wie sie es einst bei der köstlichen Madame Torbillon gelernt hatte, ging sie zur Tür, ohne aufzuschauen.
Aber auch ohne, dass sie aufsah, fühlte sie wieder die dunkelblauen, schwermütigen Augen auf sich gerichtet, bis die Tür sich hinter ihr schloss.
Es begann eine merkwürdige Zeit für Dorothea. – Zuerst beschäftigte sie hauptsächlich, was der Herzog gesagt hatte über die Dichtung, indirekt doch auch über ihr Spiel. War’s wirklich so, legte sie zu wenig Leidenschaft hinein? Man hatte ihr, gerade ihr, fast von Jugend auf soviel gesprochen vom schönen Maßhalten. Tat sie des Guten zu viel? Oder – Ja – oder? Zum ersten Mal eigentlich stieg in ihr ein Sinnen über die Grenzen ihrer Begabung empor. Oft genug hatte sie, wie jeder Künstler, mit sich gekämpft und mit ihren Aufgaben. Aber das war immer vorübergegangen, sie hatte es niedergerungen. Jetzt wollte es so nicht gehen. Fehlte es ihr wirklich an Temperament, dass sie sich nicht zu den höchsten Akzenten der Leidenschaft steigern konnte?
Sie ging in der Enge ihres Zimmers die Julia noch einmal durch, laut – zum Teil vor dem Spiegel. Es mochte schon sein, dass der Herzog mit seiner Auffassung der Rolle nicht unrecht hatte. Sie musste versuchen, dem nachzukommen.
Aber Dorothea fand selbst: ihr war das nicht gegeben. Sie konnte sich wohl künstlich in eine Art von Ekstase versetzen, künstlerisch wirkte sie dann nicht mehr. Mehr noch: sie wurde unwahr. Es war nicht mehr Leben, was sie gab, es wurde nur Komödie. Ganz charakteristisch war’s. Einmal steckte Minna den Kopf durch die Tür und meinte: „Gnä‘ Fräulein, Sie schreien heute aber fürchterlich. Dass sich die Nachbarn nur nicht beschweren.“
Nein, die Darstellung ihrer Julia musste schon so bleiben, wie sie war, trotz Serenissimus.
Und wie sie das vor sich hindachte, kam ihr ein befreiendes Lachen. Serenissimus! Weiß der Himmel, armer Herzog August-Otto, wie ein Serenissimus schaust du nicht drein. Das hässliche Wort bitte ich dir ab. Wie ein frischer, lieber Mensch siehst du aus, nur dass deine Augen so traurig sind. Als ob dir das Glück karg im Leben gewesen wäre. Und ihr glitt Lessings Wort durch den Sinn: „Ein Fürst hat keinen Freund!“
Viel Freunde vielleicht, aber keinen Freund! –
Einmal – es war nach einer Vorstellung der „Braut von Messina“, sie hatte den Herzog in der Hofloge bemerkt – fragte sie Tante Rakolski: „Ist der Herzog unglücklich?“
Ihre Exzellenz schüttelte den Kopf: „Wieso, Diedelchen?“
„Er hat so traurige Augen.“
„Erlaube mal, Diedel, was gehen dich die Augen des Herrn an?“ Frau von Rakolski lachte, dass Liddy, Siddy und Piddy ganz erstaunt zu ihr aufsahen. Aber dann wurde sie nachdenklich, und schließlich meinte sie: „Traurig wohl nicht, aber etwas schwermütig, das mag stimmen. Es war nicht immer so. Der Herzog war ein fröhliches Kind und ein froher, junger Mann. Nun, scheint’s, dass er vereinsamt. Es wäre das Beste, wenn er endlich heiratete.“
„Ohne Liebe?“
„Aber du Schäfchen! Fürsten müssen doch fast immer ohne die sogenannte Liebe heiraten. Überhaupt – Liebe! Ich habe hundert Ehen gekannt, die aus leidenschaftlicher Liebe geschlossen – und unglücklich wurden. Und fünfhundert Ehen, die ohne Liebe zustande kamen – und glücklich geworden sind. Die Liebe kommt schon in der Ehe, wenn sich beide Teile nur nicht voneinander abgestoßen fühlen.“
„Das ist aber schrecklich.“
„Das ist gar nicht schrecklich, das ist nur natürlich. Die feinsinnige Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt: ‚Jede gute Ehe wird Freundschaft!’ Die Freundschaft ist eben wichtiger für die Ehe als die Liebe, oder gar die Leidenschaft. Und wenn das für uns gewöhnliche Sterbliche gilt, dann gewiss erst recht für die Fürsten.“
Dorothea antwortete nicht mehr. Aber sie dachte an eine einsame Bank im Park draußen an der Elm. Nein, nein! Was die gute Exzellenz sagte, waren Worte. Nichts als Worte! Mit Worten ließ sich viel beweisen –
Ganz merkwürdig oft war der Herzog jetzt im Theater.
Er saß dann meist nicht in der großen Hofloge, sondern in seiner kleinen Proszeniumsloge, ganz allein hinter dem halb zugezogenen Vorhang. Bisweilen sah ihn Dorothea gar nicht; sie hörte nur: der Herr ist im Hause. Bisweilen aber, und immer öfter, bemerkte sie, dass der Herzog, sobald sie die Bühne betrat, die rotsamtene Portiere ein wenig zurückschob, und dann sah sie, in einer Spielpause, seine ernsten Augen auf sich gerichtet.
Einmal meinte Edgar Maurer, und sie fühlte aus seinen Worten einen eignen Unterklang heraus: „Serenissimus sieht sich ja heute die ganze Barnhelmin schon zum dritten Male an.“
Und der Intendant erklärte bei einer Konferenz ein wenig ägriert (verbittert): „Die Oper scheint Allerhöchsten Orts ganz in Ungnade gefallen zu sein.“
Gesprochen hatte Dorothea den Herzog seit ihrem ersten Debüt nicht wieder. Manchmal tat ihr das leid. Sie hätte gern wieder einmal sein Urteil gehört, zumal die Tageskritik in Gemar recht wenig gab und die beiden einzigen Männer von Beruf, auf deren Ansicht sie hier etwas hielt, Maurer und Ecker, merkwürdig zurückhaltend gegen sie waren.
Zweimal noch war sie in den Teesalon zur Herzoginwitwe befohlen worden. Aber Herzog August-Otto war nie anwesend gewesen.
So vergingen die ersten Monate. Weihnachten war vorüber und Neujahr, und der Herzog war auf einige Wochen zu den großen Hoffestlichkeiten nach Berlin gereist.
Es gab beruflich viel zu tun. Das war ein Segen. Auch allerlei gesellige Ansprüche stellten sich ein. Gottlob! Die Gedanken wurden dadurch ein wenig abgelenkt. Diese dummen, törichten Gedanken, die immer wieder auf ein Paar schwermütige Augen zurückkehrten. Und doch nur – das war das Ärgerlichste –, weil die Augen im Antlitz eines hohen Herrn glänzten. Vielleicht nur, weil sie ein Rätsel aufgaben, das zu lösen so eigen reizte. Vielleicht nur, weil diese Augen das Mitleid wecken mussten.
Dann stand eines Abends der Herzog plötzlich vor ihr.
Es war nach dem Schluss einer Vorstellung der „Jungfrau von Orleans“. Die letzte Szene klang noch in ihrer Seele nach:
„Saht ihr den Regenbogen in der Luft?
Der Himmel öffnet seine goldnen Tore,
Im Chor der Engel steht sie glänzend da,
Sie hält den ew’gen Sohn an ihrer Brust,
Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen.
Wie wird mir? – Leichte Wolken, heben mich –
Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide.
Hinauf! Hinauf! Die Erde flieht zurück –
Kurz ist der Schmerz – doch ewig währt die Freude!“
Zwei-, dreimal war sie gerufen worden. Nun ging sie nach ihrer Garderobe, um sich umzukleiden.
Dass der Herzog im Hause war, ahnte sie nicht. Sie glaubte ihn noch in Berlin.
So erschrak sie heftig, als er ihr entgegentrat. Ganz allein. Auch niemand der Kollegen, keiner der Bühnenarbeiter war zu sehen. Fast schien es, als hätte ein Wink des Herzogs all und jeden verscheucht. Vielleicht genügte auch schon der unausgesprochene Wunsch, den irgendeine Schranze von seinem Gesicht abgelesen haben mochte.
„Guten Abend, gnädiges Fräulein!“ sage er. „Habe ich Sie erschreckt? Dann bitte ich um Entschuldigung. Ich wollte Ihnen nur danken. Leider konnte ich nur die letzten Aufzüge sehen, denn ich bin erst am Spätnachmittag zurückgekehrt. Aber gerade die letzten Szenen sind mir immer als die gewaltigsten erschienen. Ich war ganz im Banne der Dichtung. Nochmals: Ich danke Ihnen.“
Er hatte gegen seine Gewohnheit sehr schnell gesprochen, fast hastig, wie jemand, der eine starke innere Erregung durch lebhafte Worte zu verhüllen sucht.
„Eure Königliche Hoheit sind sehr gnädig.“
Indem sie es sagte, empfand sie den Satz als beschämend banal. Aber der höfische Ton gestattete in diesem Augenblick kaum etwas andres. Und dann – sie war ein wenig verwirrt. Die Begegnung war zu unerwartet.
Er lehnte sich leicht an die Wand. An ihm vorüberzuschreiten wäre unmöglich gewesen. Dicht vor ihm musste sie stehenbleiben, in ihrem weißen Gewand, den Panzer über der Brust. Den Helm hatte sie in der Hand, ihr Haar – sie verschmähte die Perücke – flutete ihr über den Nacken.
Da begann er wieder, nun in ruhigerem Ton: „Ich hatte so lange nicht das Vergnügen, Sie zu sehen. Dies schreckliche Berlin hielt mich wider Willen fest. Pflichten, immer Pflichten! Und ich hatte so große Sehnsucht – Sehnsucht nach unserm stillen Gemar. Es geht Ihnen gut, Fräulein von Lindenbug?“
„Ich danke, Königliche Hoheit. Ich bin zufrieden.“
„Glücklich, wer das von sich sagen darf.“
Sie sah kaum auf. Aber sie fühlte wieder, wie sein Blick sie umfing, dass seine Augen ihr sagen wollten: Ich bewundere dich!
„Ich bin jedenfalls sehr froh, dass Sie sich bei uns wohl fühlen. Hoffentlich kommt man auch in Bezug auf das Repertoire Ihren Wünschen entgegen. Sonst befehlen Sie, gnädiges Fräulein. Ich bin zwar nicht Fürst auf den Brettern, die die Welt bedeuten, aber vielleicht könnte ich doch bei unserm allmächtigen Intendanten etwas ausrichten. Und das würde mir eine große Freude sein.“
Sie verbeugte sich tief. Und wieder sagte sie: „Ich bin wirklich zufrieden, Königliche Hoheit.“
„Wissen Sie, das sich Sie lieber ein wenig unzufrieden wüsste? So, dass Sie mir Gelegenheit geben könnten, Ihnen einen Wunsch zu erfüllen. Aber so geht es uns immer, wo wir einmal unser Interesse erweisen möchten, begegnen wir einer Abweisung.“
Der Panzer drückte plötzlich. Der Helm zog wie ein schweres Gewicht in der Hand. In dem engen Gang war es schwül. Kaum zu atmen – diese Bühnenluft! Und so einsam hier, wo sonst geschäftiges Leben hastete. Nur von fernher drang aus den Garderoben das Geplauder der Kollegen, der Statisten; dann und wann ein dumpfer Ton von der Bühne dazwischen; dort räumte man wohl auf.
„Das Leben hat mich dazu erzogen, Königliche Hoheit, mit Wünschen sparsam zu sein.“
„Wenn man so jung und so schön ist, gnädiges Fräulein, hat man viele Wünsche frei an das Schicksal.“
Sie schüttelte den Kopf. „Doch wohl nicht, Königliche Hoheit. Man muss sich abfinden mit dem, was das Schicksal bringt.“
Er antwortet nicht gleich. Erst nach ein paar Sekunden sagte er: „Vielleicht haben Sie recht. Ich habe oft gegen das Schicksal anzukämpfen versucht, versuche es noch, und das Ende wird doch wohl Resignation sein.“ Dann schwieg er wieder. Sie hörte, dass er schwer atmete. Und als sie mit einem scheuen Blick aufsah, sah sie, dass er den Kopf auf die Brust gesenkt hatte. Ein Gefühl heißen Mitleids stieg in ihr auf, sie musste ihm etwas Gutes sagen. Der Augenblick riss sie fort.
„Königliche Hoheit, wir Frauen sind keine Kämpfer. Das fühlte ich gerade heute als Johanna. Uns gibt nur die Idee – eine Vision – auf kurze Zeit Kraft. Aber ein Mann darf, soll, ringen – kämpfen. Es ist seine Mission auf dieser Erde, und wenn er von Gott hochgestellt ist, dann ist der Kampf erst recht seine Aufgabe.“
Er sah auf. Ihre Blicke begegneten sich. Über sein Gesicht flog eine leichte Röte. Er nickte lebhaft. Aber dann senkte er den Kopf wieder.
Und sie gereute schon, was sie gesagt. Wer gab ihr ein Recht, dieses Fürsten Egeria (Gleichnis aus römischer Mythologie: Beraterin) sein zu wollen? Und lauerte nicht vielleicht hinter der nächsten Wand ein Lauscher? Was würden die bösen Zungen tuscheln und zischen –
Das Blut stieg ihr in die Wangen. Ihr graute vor dem Kulissenklatsch.
Da sagte er plötzlich in leichtem, gesellschaftlichem Ton, aber sie fühlte, wie er sich dazu zwang:
„Übrigens hätte ich fast vergessen, mich eines Auftrags zu entledigen. Ich fuhr heute von Halle aus zusammen mit meiner Mutter, und sie sprach davon, das sie ihre kleinen Donnerstagabende ein wenig durch Lesen mit verteilten Rollen beleben möchte.“ Ein leises, ironisches Lächeln glitt um seine Lippen. „Sie verstehen gewiss, gnädiges Fräulein: die Tradition! Wenn wir auch Epigonen sind, man möchte doch den Großen nacheifern. Nun, wenn meine gute Mama daran Vergnügen findet, warum nicht? Dürfen wir auf Ihre freundliche Mitwirkung rechnen? Viel Freude kann ich Ihnen freilich nicht versprechen, denn unsre Gesellschaft – ich fürchte den ärgsten Dilettantismus.“
Dorothea atmete erleichtert auf. Erleichtert, dass ihn ein „Auftrag“ hinter die Kulissen geführt. Wenn eine kleine, ganz kleine Enttäuschung dabei mit unterlief, die konnte man schon in den Kauf nehmen.
„Wann darf ich die Befehle Ihre Hoheit in Empfang nehmen?“ fragte sie.
„Ja, am besten doch wohl schon morgen. Vielleicht um drei Uhr im Wittumspalais. Ich werde Mama benachrichtigen – nun aber will ich Sie nicht länger aufhalten, gnädiges Fräulein –”
Er machte eine leichte Verbeugung. Und dann hob er plötzlich die Hand. Sie konnte nicht anders, als die ihre hineinlegen. Nur ein flüchtiges Berühren war es, aber sie empfand, wie seine Hand zuckte.
Da hastete sie auch schon an ihm vorbei, den Gang entlang, ihrer Garderobe zu. Und plötzlich wurde es um sie her lebendig. Ein paar Türen gingen. Frau Brandt, die heute Abend die Isabeau tragiert hatte, steckte ihre spitze Nase aus der einen: „Ach, Fräulein von Lindenbug, ich wollte gerade zu Ihnen. Meine Marie hat die Schminktücher vergessen – können Sie mir nicht aushelfen?“ Ein Trupp Statisten versperrte den Weg. Dann sah sie auf einen einzigen Moment Maurer in einige Entfernung. Vielleicht täuschte sie sich: ihr war’s, als zöge er eine spöttische Grimasse.
Es kam nicht viel Schlaf in ihre Augen in dieser Nacht.
Zwei Monate hindurch währten die intimen Donnerstagabende der Herzoginmutter bis Mitte März.
Ein „Wunsch“ des Herzogs befreite Fräulein von Lindenbug ein für allemal für den Donnerstag von ihren Verpflichtungen. Auf einen „Wunsch“ des Herzogs musste ihr Herr Ecker bei der Auswahl der zu lesenden Stücke zur Hand gehen. Auf einen „Wunsch“ des Herzogs musste ihr der Oberstallmeister für diese Abende eine Hofequipage zur Verfügung stellen.
Und die bösen Zungen am Theater, in der Stadt, im ganzen Ländchen begannen zu tuscheln.
Es ahnte niemand außer den Teilnehmern, wie harmlos es an den Donnerstagabenden im Wittumspalais zuging. Äußerlich so bescheiden, wie einst bei der schöngeistigen Herzogin Amalia. Auch in dieser Beziehung war die Tradition Trumpf, fast bis ins Komische hinein: Tee, ein kleines Souper von zwei Gängen, ein paar Karaffen Rot- und Weißwein, einige Male den historischen Punsch, der sehr aromatisch, aber sehr dünn sein musste.
Im Grünen Salon ein großer Lesetisch, mit Kerzen darauf. Obenan die greise, hohe Frau, die einzige oft, die mit jugendlichem Feuer ganz bei der Sache war. Drei, vier Damen, ebensoviel Herren; sorgsam ausgesucht, aber leider wenig begabt, oft mehr dem Zwang gehorchend, als dem eignen Trieb. Die Tradition genügte denn doch nicht, Vergangenes neu aufleben zu lassen.
Man las fast nur Schiller, Goethe, Lessing. Ein Versuch mit Shakespeare – mit dem „Sommernachtstraum“ – scheiterte. Einige Kleinigkeiten von Kotzebue wurden dazwischengeschoben. Von „Neueren“ kamen einmal Freytags „Journalisten“ zur Geltung.
Der Herzog war stets anwesend. Aber er übernahm niemals eine Rolle. Er saß auch nicht mit am großen Tisch, sondern suchte sich meist einen Platz in der einen tiefen Fensternische. Nur an der Diskussion, die die Herzoginmutter, nachdem zwei oder drei Akte gelesen waren, eröffnete, nahm er dann und wann teil.
Dorothea hatte die Aufgabe, die Stücke auszuwählen, nach Rücksprache mit der hohen Frau die Rollen zu verteilen und jedes Stück mit einem kurzen Resümee einzuleiten. Ihr fiel meist auch die wichtigste Frauenrolle zu. „Es muss doch jemand das Ganze zusammenhalten“, meinte die Herzoginmutter nicht mit Unrecht.
Die Donnerstagabende bereiteten Dorothea viel Arbeit, kosteten ihr viel Zeit, und sie hatte dabei die untrügliche Empfindung, dass sie ihr wenig Dank einbrachten. Die Herzoginmutter war zwar, zumal im Anfang, äußerst gnädig und gütig; die befohlenen Herren und Damen der Hofgesellschaft blickten bald scheel auf den Eindringling, der mit sicherem Takt seine Stellung zu behaupten wusste, aber doch eben ein Eindringling blieb, die „Komödiantin“ trotz ihres adligen Namens.
Die Abende brachten Dorothea, je länger sie währten, immer mehr Verdruss – auch Sorgen, elende Geldsorgen, wie sie überhaupt intensiver, immer dringender an ihre Tür pochten. So einfach der Zuschnitt des Ganzen war, sie musste doch ihre Toilette der Hofgesellschaft anpassen. Gerade sie konnte nicht allzu oft in derselben Robe erscheinen. Und auch ihre weibliche Eitelkeit ließ das nicht zu. Hinter den drei andern Damen zurückstehen: Nein! Nein! Lieber mochte Herr Durieux mit seiner Rechnung warten, bis irgendein glückliches Ungefähr, etwa ein lohnendes Gastspiel, Hilfe brachte.
Dann schließlich harrte sie doch jedes Donnerstags mit einer Ungeduld, die sie sich selber nicht eingestehen mochte, die sie aber auch vor sich nicht ableugnen konnte. Und jedes Mal pochte ihr Herz, wenn sie die breite, teppichbelegte Treppe zum Grünen Salon emporstieg.
Wenn man sie gefragt hätte: „Ist es Liebe, die du für den Herzog empfindest?“, sie hätte aus innerster Überzeugung verneint, rückhaltlos, ohne zu zögern. Es wäre die Wahrheit gewesen, aber doch wohl nicht die ganze Wahrheit. Denn sie fühlte, dass das lebhafte Interesse, das sie empfand, Liebe werden konnte. Nur des einen letzten Funkens bedurfte es, der vom Herzen zum Herzen springen muss. Um zu zünden. Noch war’s nur ein leises Glimmen: es konnte heute, es konnte morgen zur Flamme auflodern.
Sie rang schwer mit sich. Eine fremde Unruhe hatte sie gepackt, ängstigte sie und beglückte sie zu gleicher Zeit. Manchmal durchforschte sie ihr Gewissen: Wenn August-Otto nun nicht der Fürst wäre, würdest du anders für ihn empfinden? Verblendet dich die Eitelkeit? Bist du ehrlich gegen ihn, gegen dich selber? Sie konnte nicht zur Klarheit kommen.
Er sprach selten direkt zu ihr. Es bot sich ja auch nur selten eine Gelegenheit dazu. Er fragte dann und wann nach ihrer Meinung, nach ihrer Ansicht über eine Auffassung, eine literarische Frage, verwickelte sie in eine kurze Debatte. Aber immer war der kleine Kreis der verstohlenen Neugierigen dabei, immer die Herzoginmutter, und immer brach er bald ab, wie von einer geheimen Scheu beseelt.
Aber seine Augen sprachen zu ihr, sehnsuchtsvoll, wunschreich. Auf karge, knappe Momente schwand dann der Ausdruck der Schwermut aus ihnen, sie leuchteten auf, bis sich dann gleich wieder die Lider senkten, dass nur ja niemand den verräterischen Glanz erspähe.
Ein einziges Mal hatte er ihr eine direkte Aufmerksamkeit erwiesen.
Die Herzoginmutter war eine große Blumenfreundin. Der Obergärtner musste die Jardinieren in ihren Gemächern täglich neu füllen.
Da hatte der Herzog eines Abends aus einem Rosenarrangement einige voll erblühte, schöne La France Rose herausgezogen und ihr überreicht. Wortlos –
Aber er fing wohl einen erstaunten, missbilligenden Blick der Mutter auf. Sofort reichte er auch der Gräfin Mawinska und Fräulein von Dachhusen eine Rose mit ein paar Scherzworten.
Dorothea hatte alle Ursache, sich mit der einzigen Waffe, die ihr blieb, zu wappnen: mit ihrem Stolz: Gegen sich selber und gegen die Welt.
Täglich empfand sie schwerer, wie der Boden, auf dem sie stand, sich verschob und unter ihr bebte.
Am schmerzlichsten war es ihr, dass die Herzoginmutter sich sichtlich von ihr abwandte. Die hohe Frau war zuerst voll heller Begeisterung für „ihre Abende“ gewesen; jetzt erlahmte ihr Interesse. Sie hatte zuerst die junge Schauspielerin sichtlich ausgezeichnet – nun war ihr Dorothea nicht mehr das „liebe Kind“, sondern „Fräulein von Lindenbug“. Der herzliche Ton war verklungen. Ja, Dorothea musste sich sagen, sie wurde in dem Kreise, wurde von der Herzoginmutter nur noch geduldet. Vielleicht nur, weil die kluge Greisin fürchtete, durch ein schärferes Betonen ihrer Abneigung den entschiedenen Widerspruch des Sohnes herauszufordern, weil sie fürchtete, Öl in das Feuer seiner Leidenschaft zu gießen.
Und er hatte früher schon einige Male gezeigt, dass er der „Herr“ war.
Der Intendant begegnete Dorothea mit der ausgesuchten Höflichkeit des Hofmanns, der abzuwarten verstand, wie die Wetterfahne hoher Gunst sich wenden und drehen könnte. Aber auch hier war der herzliche Ton verklungen. Die Einladungen von Frau von Rakolski wurden selten und seltener; die gute Tante Gertrud markierte eine leise Zurückhaltung und hatte ein eigen verlegenes, ein eigen frostiges Lächeln.
Außerordentlich entgegenkommend waren nur die Geschäftsleute der Stadt. Man drängte Dorothea den Kredit geradezu auf. Als sie einmal eine kleine Reparatur an einer alten Brosche, einem Erbteil der Mutter, hatte, stellte der Hofjuwelier ihr seinen ganzen Laden zur Verfügung. Und als sie lächelnd ablehnte, lächelte auch er: „Aber, mein gnädigstes Fräulein –“ Es war ein Lächeln, das ihr das Blut ins Gesicht trieb.
Und auch die Kollegen und Kolleginnen hatten dies seltsame Lächeln, aus dem hier der Neid, dort die Devotion sprach. Auch Edgar Maurer lächelte, aber sein Lächeln hatte etwas bitter Ironisches, und bisweilen, wenn sie mit ihm zusammen spielen musste, überschlich sie jäh die Angst: er hasst dich! Er könnte dir ein Leid antun. Der Tor – ist eifersüchtig. Es kam vor, dass er sie in irgendeiner Rolle wie stürmischer an sich riss, als die Situation es forderte; es kam vor, dass er sie von sich stieß, als ob er sie beleidigen wollte.
Dann gab er ihr eines Vormittags am Schluss der Probe ein Zeitungsblatt.
„Bitte, lesen Sie nachher, Fräulein von Lindenbug. Vielleicht – ich weiß es ja nicht, kann es auch nicht beurteilen – vielleicht interessiert es Sie, was die Kritik über die Aufführung der ‚Roten Robe’ sagt.“
Sie las und wusste im Voraus, dass sie eine Malice lesen würde.
Seit einigen Wochen lag die Kritik des zweiten Blattes der Residenz in neuen Händen. Der Kritiker führte eine scharfe Feder.
„… Die Bäuerin Danetta gab Fräulein von Lindenbug. Der Zufall fügte es, dass Schreiber dieser Zeilen die junge Schauspielerin vor etwa einem Jahre in einer kleinen Provinzstadt auf der Bühne einer Schmiere sah. Die hieß damals freilich schlicht Fräulein Linden, war aber der Stern der Truppe, was bei deren Unzulänglichkeit nicht viel sagen wollte. Immerhin berechtigte sie zu gewissen Hoffnungen. Seitdem scheint sie überraschend schnell Karriere gemacht zu haben. Zugelernt aber hat sie wenig oder nichts, wenn man von der äußeren Routine absieht. Die baskische Bäuerin Danetta, eine Glanzrolle französischer Tragödinnen, ist eine Glutgestalt voll wilder, südländischer Leidenschaft. Fräulein von Lindenbug aber machte aus ihr eine Karikatur. Denn Leidenschaft muss echt sein, sonst wirkt sie komisch. Sie wirkte komisch – auf mich wenigstens. Keine Spur von Temperament, alles Mache, Mache, Mache! Eine leidlich gute Salondame mag die Lindenbug sein. Schweren Rollen ist sie einfach nicht gewachsen. Die Intendantur macht einen Fehlgriff nach dem andern, indem sie das Fräulein in allen nur erdenkbaren Rollen beschäftigt, das heißt, wenn sie dankbar sind. Aber vielleicht kann, vielleicht darf der Herr Intendant nicht anders. Wir sind ja Hoftheater!!! Und es pfeifen ja die Spatzen auf den Dächern, was sich hierzulande der hohen und höchsten Protektion erfreut. Übrigens kein schlechter Geschmack, denn kund sei’s und zu wissen: sie ist die Schönste im ganzen Land. Aber nur schön – schön – – schön! So schön etwa, wie einst Madame Jagemann war, die auch einen Fürsten bezauberte. Man schlage nur die Chronika nach!“
Und Dorothea weinte, weinte bittere Tränen.
Was der Mann über ihre Danetta schrieb, war ihr heute gleichgültig. Vielleicht hatte dieser Herr Fritz Spritze, der vom Neumöller Tageblatt zum Gemarer Generalanzeiger avanciert war, sogar nicht einmal unrecht. Die Rolle der Danetta lag ihr nicht. Sie hatte Exzellenz Rakolski das gar nicht verhehlt, doch der Intendant war nun einmal plötzlich modern geworden, modern um jeden Preis.
Aber die Schlusssätze rissen ihr das Herz wund. Maurer hatte gewusst, was er ihr antat, als er ihr dies Blatt in die Hand drückte. Dies Blatt, das nun in Tausend und Abertausend Exemplaren in die Öffentlichkeit kam, so dass heute schon Hinz und Kunz es schwarz auf weiß lesen konnten: das schöne Fräulein von Lindenbug ist die Herzensfreundin des Herzogs!
Dass das sein durfte! Dass sie sich nicht wehren konnte!
Nicht auf die Straße mehr würde sie sich trauen –
Aber nein! Weshalb denn? Hatte sie nicht ihren Stolz! Und ihr reines Gewissen! Mochte man sie doch mit Schmutz bewerfen: der musste von ihr abgleiten. Und wer anständig gesinnt war, konnte diesem elenden Gewäsch nicht Glauben schenken. Mitleid nur musste man mit ihr haben, verteidigen musste man sie!
Hoch richtete sie den Kopf auf. Mit Verachtung wollte sie starten, wo man sie beleidigte. Sie und den Herzog –
Doch als sie eine halbe Stunde später nach Minna rief, kam niemand. Und als sie hinausging, fand sie die alte, treue Seele in Tränen, und vor ihr lag das unglückselige Blatt. Minna jammerte nicht um ihre arme Herrin, sie hatte kein andres Wort, als immer wieder: „Gut nur, dass das unsre liebe gnädige Frau nicht erleben brauchte –“
Am Abend war Komödie.
Wirklich Komödie: der „Probepfeil“ von Oskar Blumenthal. Sie gab die Beate, die sieghaft aus allen Intrigen als glückliche Braut hervorgeht.
Schal und abgeschmackt kam ihr die Komödie vor, heute noch mehr als sonst. Sie wusste, dass sie gleichgültig spielte und schlecht. Im letzten Akt noch dazu voreingenommen und zerstreut. Hatte ihr doch Maurer, der den jungen Helmut gab. mit bewusster Absichtlichkeit zugeraunt: „Haben Sie Hoheit gesehen? Er sitzt ganz hinten in seiner Loge.“
Sie spielte schlecht. Aber das merkwürdig dicht besetzte Haus war so beifallslustig ihr gegenüber, wie nur je. Und der Beifall widerte sie heute an. Sie fühlte ja: er gilt der „interessanten“ Person, der „schönen“ Lindenbug!
Das Stück war zu Ende.
Gerade, als der Vorhang zum letzten Male gefallen war, stürzte der Intendant auf die Bühne, sichtlich erregt. Er hielt Maurer, der schon halbwegs im Abmarsch war, fest und rief halblaut: „Bitte – bitte – meine Herrschaften! Seine Königliche Hoheit wünschen Sie zu sprechen, gleich im Konversationszimmer.“
Man eilte dorthin.
Es bildete sich – Schauspieler sind in solchen Dingen sehr gewandt – fast unwillkürlich eine Art Gruppe, und, ohne dass sie es hindern konnte, kam Dorothea in deren Mitte zu stehen.
Da kam auch schon der Herzog, vom Oberst Huglin, dem ersten Flügeladjutanten gefolgt.
In großer Uniform, mit dem Stern des Hausordens auf der Brust, schritt er schnell auf die Schauspieler zu. Er sah sehr blass aus, aber als er zu sprechen begann, ergoss sich eine Blutwelle über sein Gesicht.
„Meine Damen und Herren!“ sprach er, ein wenig hastend, doch mit scharfer Betonung. „Ich habe Sie bitten lassen, noch einen Augenblick zu verweilen. Euer Exzellenz darf ich wohl bitten, etwaige unberufene Hörer zu entfernen –“
Der Intendant verneigte sich. „Königliche Hoheit zu Befehl. Es ist bereits geschehen.“
„Sie werden voraussichtlich ohne Ausnahme schon Kenntnis haben von dem schmählichen Angriff, den sich ein Bube auf die Ehre einer Ihrer Kolleginnen erlaubt hat. Unsre Gesetze erschweren es leider, solche Schmähungen in der eigentlich richtigen Weise zu ahnden, man kann kaum anders, als sie mit Verachtung strafen. Mir musste aber unendlich viel daran gelegen sein, vor Ihnen jenes elende Zeitungsgewäsch als das zu kennzeichnen, was es ist: als eine niederträchtige, erbärmliche Verleumdung. Ihnen, mein gnädiges Fräulein“ – er wandte sich direkt an Dorothea – „möchte ich persönlich den Ausdruck meines innigsten, aufrichtigsten Bedauerns zu Füßen legen. Wollen Sie mir gestatten, Ihnen hiermit das Kreuz der Frauenklasse des von meinem hochseligen Vater gestifteten Hausordens zu übergeben – ein Kreuz „ – er schloss mit erhobener Stimme – „ein Ehrenzeichen, das noch nie eine Unwürdige getragen hat. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren!“ Noch einmal neigte er das Haupt, wandte sich kurz und ging.
Dorothea stand in tiefster Verwirrung, in der Rechten das geöffnete Etui, aus dem das blau-weiße Band herabflatterte.
Kaum dass sie den Tränen wehren konnte.
Die Kollegen umdrängten sie. Jeder, jede hatte ein liebenswürdige Wort. Exzellenz Rakolski gratulierte.
Und in demselben Augenblick hätte Dorothea vor Schmerz aufschreien mögen. Jäh empfand sie: wenn der Herzog lieber geschwiegen hätte! Großer Gott, wenn er doch geschwiegen hätte! Großer Gott, wenn er doch geschwiegen hätte! All die Glückwünsche, all die Schmeicheleien, die nicht aufhören wollten, waren ja Lug und Trug. Die gute, edle Absicht August-Ottos hatte ja nur das Gegenteil erreicht von dem, was er gewollt: es glaubte ihm ja niemand!
Sie reckte zwar den Kopf und lächelte stolz. Aber sie wusste: ihr Stolz wurde ihr nur als Hochmut und ihr Lächeln als Heuchelei gedeutet.
Und als sie dann ging, da hörte sie hinter sich tuscheln und zischeln, und ihr war es, als vernehme sie eine hässliche Stimme: „Nun, was nicht ist – wenn es nicht ist – kann ja werden!“
Es war in diesen Tagen des Leids, dass Dorothea, seit längerer Zeit zum ersten Male, einen Brief ihrer jungen Verehrerin aus Brochum, der hübschen Margaret Wignam, erhielt. Das Mädchen war anhänglich und treu wie Gold, und ihre Epistel hatten immer etwas eigen Liebes und Frisches, das wohltun musste: Diesmal freilich weckte der Brief in Dorothea allerlei seltsame Erinnerungen und Empfindungen. Die Rheinländerin schrieb:
„Unser Bert ist zu Vaters Freude auf dem besten Wege, ein gemachter Mann zu werden. Ordentlich Respekt kriegt man vor ihm. Er hat eine famose Stellung bei den Helioswerken und ist schon nach kurzer Zeit Vertrauensperson geworden. Jetzt – und nun kommt’s – jetzt baut er eine große Elektrizitätszentrale – so heißt das Ding, glaube ich – auf einer Herrschaft im Holsteinischen und hat sich mit dem Besitzer sehr angefreundet. Der aber – es muss ein interessanter Mann sein – der, meint Bert – muss Dich kennen. Er heißt von Kastrop, und das Hauptgut heißt Schneeholm. Ja also, unser Bertchen schreibt, der Freiherr hätte ihn zuerst furchtbar komisch angeguckt, so, wie man jemand ansieht, von dem man meint: ‚Gesehen musst du den Menschen doch schon haben, aber wo?’ – Verstehst Du? Na, und da ist’s denn schließlich herausgekommen: am Niederwalddenkmal ist’s gewesen, wo ihr, Bertchen und Du, das Goethesche Mariagespiel gespielt habt. Drollig, was? Und das Drolligste, dass der Freiherr das Spiel für ernst genommen zu haben scheint. Du und unser Bertchen! Verschossen war unser Bertchen ja sicher in eine gewisse Schöne, aber unser Bertchen als Ehemann! Zum Kobolz schießen –“
Kastrop!
Ludolf von Kastrop – und draußen im Park an der Elm die einsame Bank, wo der tote Bruder ihr heiße Liebesworte ins Ohr geflüstert, – der unglückliche Konrad, dem in der Entscheidungsstunde der Bruder sich versagt hatte –
Nein – nicht mehr schmähen!
Das hatte sie sich schon einmal geschworen, das schwur sie sich jetzt aufs Neue: mochte Ludolf von Kastrop sein, wie er wollte, ohne zwingende Gründe hatte dieser Mann den Bruder nicht im Stich gelassen.
Und ihr kam im Wirrwarr ihrer Gedanken ein merkwürdiger Wunsch: wenn du doch diesen Ludolf von Kastrop zum Freunde hättest, dass er dir raten könnte, aus deines Herzens Nöten dich zu lösen. Es war ja lächerlich, es war Unsinn, sie sagte es sich selber. Aber Gedanken und Wünsche sind zollfrei. Sie hatte ihn zurückgestoßen, sie hatte sein Ehrgefühl schwer getroffen, diesen Ludolf von Kastrop – aber Vertrauen, unbedingtes Vertrauen hätte sie doch zu ihm fassen können.
Wenige Tage später kam durch Karl Oskar Braune ein lockendes, lohnendes Gastspielanerbieten für Mannheim, wo plötzlich die erste Liebhaberin schwer erkrankt war. Der Intendant machte große Augen, als Dorothea um Urlaub bat. Er hatte sein „Unmöglich“ schon auf der Zunge. Doch dann überlegte er wohl, ob der Wunsch von Fräulein von Lindenbug nicht ein verschleierter, allerhöchster Wunsch sein könne: man wollte vielleicht den Klatsch sich verbluten lassen. Und so wurde sein „Unmöglich zu einem liebenswürdigen „Ja“.
Es war eine Wohltat, ein Himmelsgeschenk, das Dorothea gerade jetzt mit diesem Gastspiel geworden. Sie atmete freier, sobald sie in der Eisenbahn saß; jede Meile, die sich zwischen sie und Gemar legte, gab ihr etwas von der alten Sicherheit zurück.
Schnell vergingen die zehn Tage, in denen sie achtmal mit starkem Erfolg auftrat. Mit erleichtertem Herzen und – zum ersten Male: mit einem wohltuend beschwerten Portemonnaie dachte sie die Rückreise anzutreten. Der Frühling war ins Land gekommen, die Sonne lockte verführerisch; Dorothea plante einen Umweg über Wiesbaden, als sie plötzlich eine Depesche der Intendantur heim rief:
„Allerhöchste Gäste erwartet. Festvorstellung ‚Minna Barnhelm’ Donnerstag befohlen. Drahtantwort, wann hier.“
Es wurde eine staubige, heiße Fahrt. Und gerade so, wie auf der Reise von Gemar gen Westen sich ihr Herz aufgerichtet hatte, so sank es wieder, als Dorothea gen Osten fuhr.
In Frankfurt hatte sie sich einige Zeitungen gekauft, doch sie blieben unbeachtet liegen. Dorothea starrte zum Fenster hinaus auf die sonnenübergleißten Hänge und Fluren, Wälder und Felder, aber sie sah alle Wunder des Lenzes nur mit den Augen, ihre Seele wollte nichts davon wissen.
Dann sank endlich die Dämmerung, und bei dem matten Schein der Coupelampe
griff sie nach den verstaubten Zeitungen neben sich. Vielleicht lenkten sie doch ihre Gedanken ab.
Sie blätterte und blätterte. Zuerst suchte sie selbstverständlich nach den Rubriken „Kunst und Wissenschaft“. Nichts Neues, nun ja, die tote Saison rückte ja näher, die Sommerzeit. Dann kam doch eine Notiz, die sie überraschte.
„Sicherem Benehmen nach hat Herr Edgar Maurer, das ausgezeichnete Mitglied des Gemarer Hoftheaters, seinen dortigen Kontrakt nicht erneuert, ist vielmehr vom 1. Oktober an an das Königliche Schauspielhaus in Berlin engagiert. Man kann der Königlichen Bühne nur zu diesem Revirement (franz., hier Entscheidung), das eine wesentliche Verstärkung ihrer künstlerischen Kräfte bedeutet, gratulieren. Die Engagements-Verhandlungen wurden durch die persönliche Vermittlung des Geheimen Kommissionsrates Karl Oskar Braune nach Überwindung vieler Hindernisse zum Abschluss gebracht.“
Karl Oskar Braune hat natürlich die Notiz selbst in das Blatt lanciert. Sein Stil ist unverkennbar, dachte Dorothea.
Edgar Maurer in Berlin! Nun, dann war er am Ziel seiner Wünsche, seines Strebens.
Wunderlich: vor einigen Monaten hätte die Nachricht Dorothea doch schmerzlich berührt. Sie verdankte Maurer mancherlei; immer wieder hatte er Einfluss auf ihr Vorwärtskommen genommen, hatte auch ihre künstlerische Entwicklung gefördert. Es hatte eine Zeit gegeben, in der sie sich sogar für seine Persönlichkeit lebhafter zu interessieren begann.
Nun war er ihr ganz fern gerückt, weltenfern. Ja, sie atmete sogar erleichtert auf. In den letzten Monaten hatte es Momente gegeben, wo sie sich vor ihm fast fürchtete. Vielleicht liebte er sie – sofern seiner schwankenden Natur überhaupt ein tieferes Herzensempfinden gegeben war. Sei nicht ungerecht, sagte sie sich selber – er mochte eifersüchtig sein, und das konnte ihm immerhin als eine Entschuldigung dienen. Aber dann schrie es in ihr: Nein – niemals! Wenn er dich wirklich geliebt hätte, so würde er zu dir gestanden haben gegen alle Verleumdungen. Er hat dich beleidigen lassen, hat dich selbst beleidigt, hat dich geschmäht, mit Wort und Blick.
Er mag ein großer Künstler sein – ein großer Mensch ist er nicht!
Es ist ganz gut, dass unsre Wege sich scheiden –
Eine Weile saß sie noch und sann der Nachricht nach. Nun wieder in milderer Stimmung überlegte sie: „Ein großer Künstler ist er doch! Ein starkes Talent, vielleicht ein Genie. Wir in Gemar verlieren viel mit ihm, aber in Berlin wird er erst ganz zur Geltung kommen. Ich gönne es ihm – trotzdem er ein kleiner Mensch ist. Nicht nur mir gegenüber –“ Und sie dachte an seine Rücksichtslosigkeiten in Neumöller, sie gedachte an sein Benehmen gegen den armen, unglückseligen Willibald Sickel –
Der Zug ratterte und ratterte durch das Land. Im Mondlicht flogen die Telegrafenstangen draußen vorüber. Dann und wann leuchteten aus dem fahlen Schein die hellen Lichter eines Dorfes, eines Städtchens auf.
Wohl eine Stunde lagen die Zeitungen unberührt auf Dorotheens Schoß. Dann griff sie doch wieder zu ihnen. Und da fiel ihr Auge fast sofort auf eine andre Nachricht, die sie ganz anders traf, als die über Maurers Fortgehen aus Gemar:
„Seine Majestät der Kaiser trifft heute, von der Wartburg kommend, in Gemar ein. Seine Anwesenheit dort erhält eine besondere Bedeutung dadurch, dass gleichzeitig auch der Herzog von Altenburg mit Familie erwartet wird. Wie man uns berichtet, ist der Herzog von seiner jüngsten Tochter, der Prinzessin Elisabeth, begleitet. Wir haben Grund zu der Annahme, dass dieser Besuch in Verbindung steht mit dem Wunsch des ganzen Herzogtums Gemar, seinen Fürsten endlich vermählt zu wissen. Die Thronfolge im Herzogtum ist bisher ungesichert, denn der einzige Agnat, Prinz Leopold, des Herzogs Vetter, ist, wie bekannt, seit Jahren geistig umnachtet und somit regierungsunfähig. Eine gesetzliche Regelung der Frage, welche die konservative Partei im Landtag schon vor zwei Jahren anregte, wurde von der Regierung abgelehnt. Wie uns ein Telegramm aus Berlin weiter meldet, soll der Kaiser sich für das Zustandekommen der Heirat sehr interessieren. Die Prinzessin Elisabeth von Altenburg ist kürzlich zwanzig Jahre alt geworden und erregte auf den Berliner Hofbällen des letzten Winters durch ihre Schönheit und ihre außergewöhnliche Anmut großes Aufsehen.“
Die Zeitung flatterte zu Boden. Das also war das Ende.
Dorothea hatte einen schweren Kampf in der Einsamkeit ihres Wagenabteils durchgerungen. Doch als sie in Gemar durch die festlich geschmückten Straßen ihrer Wohnung zufuhr, lag ein Lächeln auf ihren Lippen. Ein wehmütiges Lächeln freilich, aber das Lächeln eines festen, reifen Entschlusses.
Am nächsten Abend war die Galavorstellung vor den Allerhöchsten Herrschaften.
In letzter Stunde war das Programm umgestoßen worden. Anstatt „Minna von Barnhelm“ wurde die „Jungfrau von Orleans“ angesetzt. Am Vormittag fand noch eine Probe statt, man erzählte sich im Konversationszimmer, dass die Abänderung auf besonderen Wunsch des Kaisers stattgefunden habe.
Im Gefolge des Kaisers befand sich auch Exzellenz von Hülsen, der Generalintendant der Kaiserlichen Schauspiele. Er wohnte in der Loge des Intendanten der Probe bei. Das war ein wenig ungewöhnlich und überraschend. Der alte Wenkstern, der den Thibaut gab, bemerkte die hohe Gestalt gleich im ersten Auftritt an der Brüstung der Loge und raunte Dorothea zu: „Exzellenz Hülsen – was will der bei uns?“
Dorothea achtete nicht sonderlich darauf. Ihr war eigen befangen zumute, aber wahrlich nicht des seltenen Gastes halber. Der innere Kampf, den sie gestern ganz und glücklich durchgerungen zu haben meinte, lastete doch noch auf ihr. Das „große, schwarze Loch“ des Zuschauerraumes gähnte sie wie unheimlich, unheilverkündend an. Während der letzten Stunden hatte sie der seltsamen Empfindung nicht Herr werden können: „Aber du weißt ja kein Wort von der Rolle der Johanna.“ Ihr war’s, als sei die ausgelöscht in ihrem Gedächtnis. Mühsam hatte sie die wundervollen Schillerschen Verse noch einmal durchmemoriert. Hier fehlte ein Verbindungsglied, dort ein Satz; wiederholt musste sie das Buch zu Hilfe nehmen, und als sie zum Theater gefahren war, hatte sie, sie sonst so Sichere, fast angstvoll gedacht: „Wenn nur heute unser guter „Kastengeist“ mich nicht im Stiche lässt.“
Als sie aber erst auf der Bühne stand, als die ersten Worte gefallen waren, fand sie sich wieder:
„Gebt mir den Helm!
Mein ist der Helm, und mir gehört er zu!“
Und ihr schönes Organ wuchs und schwoll:
„Vor Orleans soll das Glück des Feindes scheitern,
Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte reif.
Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen
und seines Stolzes Saaten niedermähn.
Herab vom Himmel reißt sie seinen Ruhm,
Den er doch an die Sterne aufgehangen –“
Exzellenz von Hülsen hatte den Vorhang der Loge ein wenig verschoben. Er sah und lauschte aufmerksam. Neben ihm saß Exzellenz von Rakolski. Dann und wann wechselten sie einige Worte.
Dann kam der große Monolog der Johanna:
„Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Tristen,
Ihr traulich stillen Täler, lebet wohl –“
Der Generalintendant beugte sich vor, weit und weiter –
„Braune hat mich schon wiederholt auf Ihre Lindenbug aufmerksam gemacht, liebe Exzellenz!“ sagte er. „Das ist in der Tat ein selten schönes Menschenkind. Spricht auch vorzüglich.“ – Es war ein uneingeschränktes Lob, und doch lag für Rakolskis feinhöriges Ohr etwas wie eine leise Einschränkung darin.
Eigentlich war Herrn von Rakolski das ganz lieb. Seine Stimmung war nicht sonderlich: die plötzliche Abänderung der Vorstellung hatte ihm viel Mühe und manchen Verdruss gebracht. Der Herzog war überhaupt in letzter Zeit nicht besonders gnädig gegen ihn gewesen. Die Herzoginmutter auch nicht. Vor ein paar Tagen hatte sie ziemlich unfreundlich geäußert, und natürlich hatte man es ihm hinterbracht: „Nun hat sich Rakolski den Edgar Maurer einfach von Berlin fortkapern lassen – ohne irgendwelchen Widerstand zu versuchen.“ – Edgar Maurer: als ob er zu halten gewesen wäre, mit seinen Ansprüchen – bei seiner Eitelkeit. Aber das fehlte gerade noch, dass auch die Lindenbug dem großen Kollegen aus dem Wasserkopf des Deutschen Reiches in die Augen stechen sollte! Gerade sie – gar nicht auszudenken wäre das gewesen. Ein Glück, dass Exzellenz Hülsen diese unausgesprochene Einschränkung seiner Anerkennung beliebte. Dorothea musste ihm doch nicht recht gefallen. Übrigens dieser Geheime Kommissionsrat Braune – es grenzte fast an Perfidie, wie der seine Netze spann.
„Wollen wir nicht frühstücken gehen?“
„Ich möchte doch gern noch bleiben, wenn es Ihnen recht ist, lieber Rakolski.“
Während der nächsten Szenen war Exzellenz von Hülsen ziemlich unaufmerksam. Aber sobald die große Erzählung Johannas vor dem König und dem Erzbischof an die Reihe kam, spannte sich sein markantes Gesicht wieder.
„Ehrwürd’ger Herr, Johanna nennt man mich,
Ich bin nur eines Hirten niedre Tochter,
‚Aus meines Königs Flecken Dom Remi –“
„Überraschend gut gesprochen. Wirklich, Braune hat recht. Ich vermisse allerdings eins – das starke Temperament scheint mir zu fehlen.“
„Das sagt auch die Kritik, Exzellenz.“
„Ah bah – die Kritik! Was sagt die Kritik nicht alles.“
Exzellenz Hülsen lehnte sich weit zurück, wie überlegend, nachsinnend.
Und Exzellenz von Rakolski sann auch nach und – überlegte. Ihm war plötzlich die Erinnerung gekommen an eine andre Aufführung der Johanna, vor etwa drei Monaten. Damals hatte diese unglückliche Geschichte eigentlich ihren Anfang als der Herzog ihm gesagt hatte: „Ich möchte Fräulein von Lindenbug ein paar Augenblicke allein sprechen.“ Eine unglückliche Geschichte – daran war nun einmal nichts mehr zu ändern. Seiner Diedel – der Dorothea von Lindenbug, konnte man dabei gewiss nichts vorwerfen, vielleicht musste sie einem sogar leidtun. Und der Herzog? Das Schlimme war eben, dass der’s so ernst nahm. Eine wirkliche Leidenschaft? Vielleicht! Und heute Abend würde da drüben in der Hofloge die junge, blonde Prinzessin sitzen, die zukünftige Herzogin! –
Ja – wer weiß: zukünftige Herzogin? Wenn die Diedel Lindenbug nicht wäre! – Gestern hatte die Herzoginmutter nach der Galatafel ihn beiseite genommen: „Sie hätten sich Fräulein von Lindenbug auch nicht gerade zurückzudepeschieren brauchen, lieber Rakolski –“
„Es ist unsre beste Kraft,“ dachte Rakolski, „der Kaiser ist da – und das Hoftheater musste zeigen, was es leistet.“ –
Der Monolog Johannas –
„Die Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen,
Auf blut’ge Schlachten folgt Gesang und Tanz –“
Als Dorothea geendet, stand Exzellenz von Hülsen auf: „Wollen wir nicht draußen ein wenig auf und ab gehen? Man wird steif vom ewigen Sitzen.“ Schweigend schritten sie zuerst durch die halbdunklen Korridore. Dann blieb Generalintendant von Hülsen plötzlich stehen.
„Eigentlich befinde ich mich in einer recht peinlichen Situation Ihnen gegenüber, Exzellenz. Da habe ich Ihnen den Edgar Maurer genommen, und nun – Aber ich will mit offenen Karten spielen. – – Also hören Sie: gestern Vormittag empfing mich die Herzoginmutter. Sie wissen wohl, dass sie eine besondere Gönnerin meines Vaters war, vielleicht darf ich sagen, Freundin. Ein Teil ihres Wohlwollens ist auch auf mich übergegangen. Sehen Sie: und da hat mich Ihre Königliche Hoheit in besonders eindringlicher Weise auf Fräulein Lindenbug aufmerksam gemacht. Ich wollte zuerst nicht reagieren, obwohl ich eine tüchtige, junge Kraft recht gut gebrauchen könnte. Mir war es peinlich, nachdem ich Ihnen eben Maurer fortengagiert hatte. Die Herzoginmutter ließ aber nicht nach. Nun, mir ist ja auch allerlei zugetragen worden, und wenn ich auch auf dieses Gewäsch wenig gebe – wir beide kennen ja diesen giftigen Klatsch – schließlich musste ich aber doch den Wunsch Ihrer Königlichen Hoheit verstehen. Ich versprach also, mir die Lindenbug heute früh bei der Probe anzusehen. Ganz ehrlich gesagt: für eine große, geniale Künstlerin halte ich sie nicht. Es fehlt das große Feuer. Aber sie ist immerhin weit über den Durchschnitt, ist blendend schön, hat ein wundervolles Organ und scheint sehr klug zu sein. Ja – wenn es nicht unsrer Freundschaft einen unheilbaren Riss zufügen sollte: Ich würde gern auf Fräulein von Lindenbug reflektieren und ihr gute Bedingungen stellen –“
Er schwieg.
Und Rakolski schwieg auch.
Sie schritten wieder wortlos nebeneinander her durch das Rund des langen Korridors hinter dem ersten Rang.
Leicht wurde Herrn von Rakolski der Entschluss nicht. Im Gegenteil: bitter schwer. Da hatte man nun endlich einmal für verhältnismäßig geringes Gehalt eine Künstlerin, die allgemein gefiel, die vielseitig verwendbar war, nie Schwierigkeiten machte – und sollte sie verlieren. Doch das war das wenigste. Schließlich gönnte man ja der Diedel den Aufstieg auch. Gerade ihr! Aber der Herr – der Herzog! Es konnte Kopf und Kragen kosten. Dann war da auf der andern Seite die Herzoginmutter. Und es war die Hofclique, der die Diedel schon längst verhasst war. Und es war schließlich das Interesse des ganzen Herzogtums. –
Er seufzte leise auf.
Exzellenz Hülsen blieb weiter stehen. „Ja, wenn Sie nicht wollen, lieber Rakolski –“
„Ach, Exzellenz – wenn Sie in meiner armen Intendantenseele lesen könnten!“
„Das tue ich! Das Zündhölzchen nicht zwischen zwei, sondern zwischen mehreren Feuern. Unser Beruf mit seinen Dornen!“
„Schließlich weiß ich auch nicht, ob Fräulein von Lindenbug von uns weg will.“
„Ah bah! Sie wird keine Törin sein, Ich biete ihr – nun, sagen wir, neuntausend Mark – über alles andre mag später verhandelt werden.“
Rakolski seufzte wieder. Gegen das große „Berliner Portemonnaie“ war schwer aufzukommen.
„Ich will mit ihr sprechen“, sagte er dann plötzlich.
Und damit schieden sie. Rakolski aber ging langsam – ganz langsam den Weg bis zur Bühnentür zurück und stieg wieder langsam – ganz langsam die schmale Treppe hinunter. Er schwankte noch immer. Es war doch ein gefährliches Spiel – es konnte wirklich Kopf und Kragen kosten.
Die Probe neigte ihrem Ende zu.
Eine Weile stand der Intendant noch hinter der ersten Kulisse. Schade – jammerschade! Aber für die Diedel war’s am Ende ein Glück. Wie sie’s wohl aufnehmen würde? Ob sie einen andern Traum geträumt hatte? Ein Wunder wär’s nicht! Wenn sie ja sagte, ging’s ihm vielleicht an den Hals. Wenn sie aber nein sagte und der Herzog erfuhr nachher, dass er selber den Vermittler abgegeben – Gnade ihm –
Und da stand sie nun, mit dem Helm in der Hand, und wollte gerade zur Garderobe gehen.
Er hatte, seit sie in Gemar engagiert war, sie noch nie beim Vornamen genannt. Heute sagte er ihr leise: „Fräulein Diedel, ich muss sie sprechen. Gleich! Wenn Sie sich abgeschminkt haben, bitte kommen Sie auf ein paar Augenblicke in mein Zimmer. Bitte, liebes Kind!“ –
Dann, als er Dorothea Exzellenz Hülsens Vorschlag auseinandergesetzt hatte, war er selbst erstaunt, dass Dorothea, ohne auch nur einen Moment zu zögern, zustimmte. Sie erschrak zwar bei der überraschenden Mitteilung. Auf eines Atemzuges Länge dachte sie an Edgar Maurer, an alle wieder auflebenden Peinlichkeiten eines Zusammenwirkens mit ihm; aber gleich schlug doch mächtig wie eine brausende Welle das Wort in ihre Seele: das Königliche Schauspielhaus wirbt um dich, die Bühne, wo der Döring und die Frieb, Kahle und die Jachmann, die Erhard und die Niemann groß wurden, der heute die Poppe und Matkowsky angehören! Und doch gab nicht das allein den Ausschlag – ihr schien’s wie eine Himmelsfügung, dass sie jetzt, gerade jetzt von Gemar scheiden sollte. Es war wie eine Antwort von oben auf ein stilles Gelübde, das sie gestern getan hatte.
Fast ein wenig verletzt war die gute Exzellenz. „Also so leicht wird Ihnen das Scheiden, Fräulein von Lindenbug?“ –
Nun war aus dem Diedelchen wieder das Fräulein von Lindenbug geworden. – „So leicht – das hätte ich doch nicht gedacht.“
„Ich werde stets an Gemar mit innigem Danke zurückdenken, Exzellenz, und nicht zuletzt an alle Ihre Güte –“
Da war er schon wieder versöhnt. „Großer Gott, was wird meine Frau sagen? Die ist immer für Sie eingetreten – Fräulein Diedelchen, immer, auch wenn – na, Sie sind ein kluges Mädelchen und ein tapferes Mädelchen. Mir schwant so etwas – ja – hier, geben Sie mir mal Ihre liebe Patschhand – nun nicht mehr den Intendanten, sondern dem alten Onkel Rakolski. – Möchte doch alles zu Ihrem Glück ausschlagen!“
„Eine wahrhaft fürstliche, eine wahrhaft erlauchte Gesellschaft, vor der wir heute zu spielen die Ehre haben,“ versicherte der alte Wenkstern. „Seine Majestät fehlt zwar noch. Aber der Herzog ist schon da, die Herzoginmutter und – das muss doch wohl die Prinzess Elisabeth sein – hm – hübsch, sehr hübsch! Wollen Sie auch mal sehen, Fräulein von Lindenbug?“
„Ja – sie wollte auch einmal durch da kleine Loch im Vorhang blicken. Nur auf einen Augenblick, mit pochendem Herzen.
Eine blonde Schönheit. Ein liebliches, zartes Oval, von zwei schlichten Flechten gekrönt. Ein feines Profil, ein paar liebe Augen – wie eine Momentaufnahme empfand sie das alles – nichts Schales, nichts leer Höfisches in der ganzen Erscheinung – ein junges Weib, das glücklich machen kann.
Da tönte auch schon die Klingel des Inspizienten, und zugleich klangen jenseits des Vorhangs die Fanfaren auf: der Kaiser hatte die große Hofloge betreten.
„Majestät hatte besonders gebeten, nicht auf ihn zu warten“, wusste der alte Wenkstern wieder geschäftig zu berichten. „Daher haben unsre Herrschaften auch schon vor ihm Platz genommen. Sitzt meine Halskrause eigentlich richtig, Maurer?“
„Großartig! – Nun, Fräulein von Lindenbug, haben Sie sich auch die zukünftige Landesmutter genau angeschaut?“
Dorothea achtete nicht darauf. Sie ging schnell hinter die Kulissen zurück, ihres Stichwortes zu warten.
„Heute Abend“ – das wusste sie – „heute Abend werde ich mit Begeisterung spielen. Den Funken fühl‘ ich heute in mir. Zum Abschied –“
Zum Abschied – aber sie dachte dabei nicht an Gemar.
Eine glänzende Vorstellung! Der Kaiser selbst hatte es schon nach dem zweiten Akt ausgesprochen. Wie ein zündender Blitz flog das Kaiserwort durch das ganze ehrwürdige Haus. Es war eine seltsam gehobene Stimmung: die Anwesenheit des Kaisers – die junge, reizende Prinzessin, auf der so viele Hoffnungen ruhten – ja, und der Widerhall all unsrer alten Traditionen, die Erinnerung an unsrer klassische Zeit – so raunte man hier, und so raunte man dort – ja, und heute hat’s der Rakolski wirklich mal gut gemacht – und der Maurer und die Lindenbug – Seine Majestät hat ganz recht: eine glänzende Vorstellung!
Während des Spiels musste man auf die Bühne sehen – und es lohnte, denn die Lindenbug sah nicht nur blendend aus, sie hatte heute auch ihren besonders guten Tag – und in den Zwischenakten, da durfte man verstohlen nach der großen Hofloge schauen. Die alte Herzogin strahlt förmlich, wenn der Kaiser mit ihr spricht. Manchmal guckt sie auch das Prinzesschen wie mit zärtlichen Mutteraugen an. Übrigens ist der Herzog auch guter Stimmung – die Sache wird wohl in Ordnung sein, und demnächst lesen wir’s im Staatsanzeiger. Es tat auch Not, nach all dem Getratsch und Gewäsch! Denn es war sicher nur ein Gewäsch – wo würde man die Lindenbug denn sonst gerade heute spielen lassen? Und überhaupt, ihr soll wirklich gar nichts vorzuwerfen sein. Ihre Exzellenz Frau von Rakolski soll das auch gesagt haben! –
Dann, vor der letzten Szene, entstand in der großen Hofloge etwas wie ein leises Flüstern. Der Kaiser hatte den Generalintendanten von Hülsen, der bisher im Hintergrunde gestanden, herangewinkt. Vielleicht wegen Edgar Maurer; der ging ja nach Berlin. Schade! – Ob sich denn der Herzog Maurers Verlust so zu Herzen nimmt? Er sieht wirklich plötzlich fast wie ungnädig aus. Was ihr euch auch immer gleich einbildet! Etwas abgespannt mag er sein. – Großartig jetzt die Lindenbug –
„Höre mich, Gott, in meiner höchsten Not.
Hinauf zu dir, in heißem Flehenswunsch,
In deinen Himmel send‘ ich meine Seele.
Du kannst die Fäden eines Spinngewebs
Stark machen wie die Taue eines Schiffs;
Leicht ist es deiner Allmacht, ehrne Bande
In dünnes Spinngewebe zu verwandeln –
Du willst: und diese Ketten fallen ab –“
——————————————————————-
„Das ist mein König! Das sind Frankreichs Fahnen!
Doch meine Fahne seh‘ ich nicht – wo ist sie?
Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen,
Von meinem Meister war sie mir vertraut,
Vor seinen Thron muss ich sie niederlegen,
Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu –“
Der Kaiser hatte sich erhoben und das Zeichen zum Beifall gegeben. Wieder und wieder musste der Vorhang sich heben.
Plötzlich stand der Intendant neben Dorothea. Er war leichenblass. „Kommen Sie schnell, Diedel – liebe Diedel – in Ihre Garderobe! Der Herzog – Seine Hoheit will Sie sprechen. Sofort! Himmel, Himmel, muss der Kaiser auch gerade nach Ihnen fragen, und natürlich meldet Hülsen sofort, dass Sie – schnell, Diedel – der Herzog –so habe ich den Herzog überhaupt noch nie gesehen! Das ist totale Ungnade! Diedelchen, liebes Diedelchen, Sie müssen verständig sein –“
Auf eines Atemzugs Länge war ein Frohlocken in ihr. Aber gleich darauf war sie ruhig.
„Ich kann den Herzog in meiner Garderobe nicht empfangen. Ich will auch nicht, Exzellenz!“
Dabei hatte der Intendant sie aber schon den schmalen Gang entlang geführt. „Aber, Diedelchen, seien Sie nicht klein. Nur heute nicht! Denken Sie auch an meine weißen Haare. Ich flehe sie an! Rasend ist der Herzog. Gerade, dass er’s über sich gewann, sich einigermaßen in guter Form von Seiner Majestät zu beurlauben. Muss ja auch gleich wieder ins Palais. Diedelchen – ah –“
Da stand der Herzog vor ihnen.
Und Rakolski stieß die Tür auf, mit einer ganz, ganz tiefen Verbeugung.
Mit einem Male waren sie beide in der engen Garderobe allein. Dorothea wusste kaum, wie es gekommen war. Sie hörte nur, wie eine dienstwillige Hand von außen die Tür ins Schloss drückte, und dann hörte sie des Herzogs Stimme: „Verzeihen Sie –“
Sie selber stand wortlos.
„Fort wollen Sie? Fort?“
Sie antwortete nicht.
„Ich kann mir vorstellen, wie man Sie geschoben und gedrängt hat! Die Klugen – die Superklugen! Aber ich werde zwischen sie fahren. Gericht will ich halten! Bin ich denn ein Kind, bin ich eine Marionette? – So sprechen Sie doch! Ihr Schweigen tut mir so weh!“
„Was soll ich sagen, Königliche Hoheit –“
„Ob man Sie wieder beleidigt hat!“ stieß er hervor. „Weshalb wollen Sie fort?!“
„Es ist am besten, ich gehe, Königliche Hoheit.“
„Am besten?!“ Er lachte kurz auf. „Ist denn Ihr künstlerischer Ehrgeiz so groß, zieht Berlin so übermächtig?“
„Und wenn es das wäre?“
Wieder lachte er. „Ich weiß es besser: Sie gehen um meinetwillen – Dorothea, wie können Sie so mitleidlos sein! Als ob Sie nicht wüssten, dass in all den letzten Monaten mein ganzes Sein sich nach Ihnen sehnte, dass ich nur an Sie dachte, dass jeder Tag mir wie verloren war, wenn ich Sie nicht sehen konnte!“
Sie war zusammengezuckt, als er sie beim Vornamen nannte. Das Blut strömte ihr zum Herzen, während er sprach. Krampfhaft umklammerte ihre Hand den goldenen Helm der Johanna.
Mitleidlos hieß er sie –
Zum ersten Male hob sie die Augen und sah ihm in das erregte Gesicht.
„Dorothea –“
Langsam wich sie zurück, bis an die Rückwand des engen Raumes. Dann schüttelte sie traurig den Kopf. „Mitleidlos – nein, nein! Aber es muss sein – Königliche Hoheit, es muss sein. Und nun, bitte, nun lassen Sie mich –“
Auf ein paar Atemzüge war ein Schweigen zwischen ihnen. Und vor Dorothea zog noch einmal gleich Bildern das Erlebte des vergangenen Winters vorüber: die Abende im Theater, die Abende im Wittumspalais, jedes Begegnen mit ihm, jedes Wort, das zwischen ihnen gewechselt war, wie an seiner verhaltenen Leidenschaft auch ihr Interesse erwacht war. Interesse? Mehr wohl – eine herzliche Zuneigung. In diesen Augenblicken jedoch wurde ihr recht klar: vielleicht hätte unter andern Verhältnissen aus dieser Zuneigung die Liebe herauswachsen können – vielleicht! Jetzt aber wusste ihr Herz nichts von Liebe –
Da sprach er in ihre Gedanken hinein: „Dorothea – ich bitte um Ihre Hand –“
Ganz ruhig, plötzlich, ganz überlegt hatte er es gesagt.
Der Helm der Johanna klirrte zu Boden.
Und Herzog August-Otto kam auf sie zu, fasste die beiden Hände der Willenlosen und drückte sie innig. „Liebe Dorothea“, sprach er weiter, „mein Entschluss mag Ihnen plötzlich erscheinen. Sie irren! Er ist reiflich erwogen, seit Wochen schon. Sie wissen, dass ich Ihnen nicht den Platz an meiner Rechten bieten kann. Aber was tut das? Sie und ich sind doch über Äußerlichkeiten erhaben. Und was ich Ihnen biete, ist das Glück. Was Sie mir geben sollen, ist das Glück. Ich füge mich allen Ihren Wünschen in Bezug auf Ihre äußere Stellung, und ich werde diese Stellung in jeder Weise zu wahren wissen. Wehe, wer es wagt, Sie mit scheelen Augen anzuschauen – Dorothea – liebe Dorothea!“
Noch immer stand sie erschüttert. Sie fühlte, wie ehrlich der Herzog es meinte; fühlte seine tiefe, wahre Liebe. Es tat so wohl – und es tat so wehe.
„Ich verstehe, warum Sie zögern, Dorothea. Ich weiß, was dieser Entschluss für ein stolzes Mädchen bedeuten muss. Ein Sichbescheiden liegt immerhin darin. Oh – ich fühle das mit Ihnen. Aber sehen Sie doch nur um sich. Wir sind ja nicht die einzigen, die sich ein Glück neben dem Throne gewonnen haben. Die Vorurteile zerbrechen in unsrer Zeit. Da ist mein Oheim in M., das ist der Thronfolger an der Donau. Doch warum sie alle aufzählen –“
Nun endlich hatte sie sich die Kraft zurückgewonnen. Nun endlich wusste sie, was sie ihm antworten musste. Er war es wert, dass sie ihm die volle Wahrheit sagte. Und wenn ihm diese Wahrheit Schmerzen brachte: er war ein Mann, er würde es überwinden wissen.
Sie ließ ihm ihre Hände. Sie sah ihm offen in die Augen. Aber sie schüttelte langsam den Kopf: „Ich kann nicht –“
„Dorothea!“
„Mein Herz ist so voll von Dankbarkeit, Königliche Hoheit. Aber – ich kann nicht unwahr sein – ich empfinde nichts als eine innige und aufrichtige Freundschaft – wenn Königliche Hoheit den Ausdruck gestatten wollen –“
„Freundschaft – ja, Dorothea, Freundschaft ist die Grundlage der Liebe.“
Wieder schüttelte sie den Kopf. Und sie lächelte traurig. „Es kann nicht sein, Königliche Hoheit – es kann nicht sein.“
Ganz langsam entwand sie ihm ihre Hände.
Aber wie sie nun sah, dass sein Haupt tief hinabsank, griff sie wieder nach seiner Rechten, und sie sprach weiter: „Königliche Hoheit, wenn Sie einst dieser Stunde gedenken, werden Sie meinen Entschluss segnen. Denn dann wird längst, längst – ich fühle das, und es ist mir selber wie ein Trost – dann wird Ihnen ein andres Glück erblüht sein. Ein Glück, auf der Pflicht gegründet. Das mag hart klingen, Pflicht ist ja wohl immer ein herbes Wort. Aber die Pflicht bestimmt nun einmal die Gesetze der Welt. Und wer die Pflicht recht zu fassen weiß, der meistert sie auch. Sie erhebt ihn und befreit ihn – und führt ihn so doch zum Glück. Aus ganzem Herzen erflehe ich heute ein reiches Glück für Sie – für Ihr Haus – für Ihr Land! Ja, für Ihr Land – aber vor allem für Sie, Königliche Hoheit – für den guten, edlen Mann, dem ich armes Mädchen heute weh tun musste, und für den ich doch das Beste und Schönste vom Himmel herab holen möchte.“
Er antwortete nicht. Seine Rechte bebte in ihren Händen. Einmal sah er auf, sah mit einem tieftraurigen Blick sie an –
Plötzlich hob er ihre Hand und küsste sie leidenschaftlich. Und dann sprach er mit schwerer Stimme: „Die Pflicht also! Das ist der Rest.“
„Das ist die Zukunft, Königliche Hoheit – die Zukunft mit ihrem Segen!“
„So scheiden sich unsre Wege, Dorothea. Lassen Sie mich noch einmal Sie so nennen. Lassen Sie mich Ihnen noch einmal sagen, dass Sie immer auf einen Freund zählen können.“
„Ich danke innigst, Königliche Hoheit.“
Er reckte sich. Es war wie ein gewaltsames Aufrütteln.
„Die Pflicht – die Pflicht ruft mich ja wohl schon heute. In einer Viertelstunde werde ich lächeln müssen. Verstehen Sie, was das heißt? Lächeln und Konversation machen, meinen kaiserlichen Gast unterhalten und den Liebenswürdigen spielen –“
„Nicht bitter sein, Königliche Hoheit!“
„Nein – nein! Es ist ja Pflicht!“
Er hob die Hand, glitt einmal über Stirn und Schläfen, wie nach einem heftigen Schmerz tastend.
Dann sagte er hastig: „Leben Sie wohl, Fräulein von Lindenbug!“ Und noch einmal: „Leben Sie wohl – Dorothea!“ Und ging.
Die Tür schloss sich. Draußen im engen Korridor hallten seine Schritte.
Dorothea lauschte ihnen nach, bis sie verklangen, bis ein Trupp Statisten schweren Tritts den Gang entlang zog mit Lachen und Plaudern.
Da erwachte sie aus ihrem Traum.
Die Tränen schossen ihr aus den Augen.
Unmittelbar, ehe Dorothea nach Berlin übersiedelte, traf sie ein schwerer Schlag. Minna erkrankte und starb. Sie wollte nicht mit in das große Häusermeer, hatte sie schon Wochen vorher gesagt. Sie wollte in Gemar bleiben. Dorothea hatte es nie ernst genommen, nun wurden die Worte der alten, treuen Seele doch wahr, wenn auch wohl anders, als sie vielleicht selber gedacht hatte. Nur wenige Tage lag sie, bis fast zum letzten Atemzuge bei vollem Bewusstsein, bis zuletzt mit all ihren Gedanken und Sorgen bei dem „gnä‘ Fräulein“. Sie war keine leicht zu pflegende Kranke, wie sie auch nie eine ganz bequeme Dienerin gewesen war. Aber Dorothea wich nicht von ihrem Bett und hörte mit rührender Geduld die sich immer wiederholenden, schließlich fast ins Fieberhafte gesteigerten Reden an, in denen Minna ihre Abneigung gen „all den Speelerskram“ rückhaltloser denn je zum Ausdruck brachte.
Manchmal musste sie wohl lächeln, ein trübes Lächeln, das sie jetzt oft hatte. Nicht selten aber empfand sie doch auch die bitteren Wahrheiten, die hinter den hastenden Worten der Kranken standen. „Gnä‘ Fräulein, gnä‘ Fräulein – was ist mich denn dabei herausgekommen? Gesund sind Se gewest und frisch, und nu sind Se immer in der Rag‘ und haben an nichts ich mehr rechte Freud‘. Aber Schulden haben wer – Schulden wie ‘n Major. Gott verzeih’s mer: ich muss immer an den seel’gen gnä‘ Herrn denken. Un‘ Erfolg? Wenn ich schon bloß das Wort hören tu‘! Da schrein und klatschen ein paar wie toll und verrückt, un‘ ’ andern Morgen steht im Blatt: gar nix kann die Lindenbug. Rein nix kann se. Jeder dumme Junge darf sich ’ne – Extrakritik – so heißt’s ja woll? leisten. Un‘ glauben Se man ja nich, gnä‘ Fräulein, dass das nu in Preußisch-Berlin besser wird. Im Gegenteil! Da kommt der Neid erst recht un‘ die Sorgen, wenn schon zehnmal ein paar Groschen mehr da sind. Nee – ich mach‘ nich mit – ich will das Elend nicht mit meine alte Augens mit ansehn tun.“
Ganz zuletzt griff sie immer aufs Neue nach Dorotheas Hand. Ein wenig wirr schien nun doch, was sie mit fast erstickender Stimme raunte: „Ein‘ recht guten Mann wünsch‘ ich dem gnä‘ Fräulein – un‘ bloß man fort von de Speelerei –“ Dann sah sie wohl nicht mehr ihr gnä‘ Fräulein am Bett sitzen, sondern Dorothea war ihr wieder das Kind geworden, das sie auf den Knien geschaukelt hatte.
„Diedelchen, vergiss nich meine alte Brieftasch‘. Die mit den Perlen drauf – gnä‘ Frau hat sie mir mal geschenkt –“
Am Abend vor der Abschiedsvorstellung drückte Dorothea der alten, treuen Seele, die ihr in schweren Tagen nicht selten zur Freundin geworden war, die Augen zu. Und während Minna auf der Bahre in der Kapelle des Friedhofs ruhte, musste sie hinaus vor die Rampe – Schauspielerlos!
Schauspielerlos! Aber auch Schauspielerglück, dass die Welt mit ihrem Leid und Schmerz vor dem Darstellenden versinken kann, wenn der Vorhang aufgeht, das „große, schwarze Loch“ sich vor ihm auftut, der Geist über ihn kommt und er in seiner Rolle alles, alles, was irdisch ist, vergessen kann.
Noch einmal raste das ausverkaufte Haus Dorothea Beifall zu, als sie, eine wahrhaft hoheitsvolle Iphigenie, über die Bühne schritt. Der Hof war vollständig vertreten, bis auf den Herzog, der seit Wochen in Lappland jagte. Blütengeschmückt war die Garderobe, Blumen und Kränze häuften sich am Schluss vor Dorothea. Dann stand sie noch einmal im Teesalon vor der Herzoginmutter. Es war fast, als wollte die Greisin ihr etwas besonders Liebes erweisen, es war vielleicht, als leiste sie ihr im stillen Abbitte. Sie fand die gütigsten Worte, sie sprach vom Wiedersehen, sie wünschte Dorothea viel, viel Glück, und dann löste sie, wie in einer plötzlichen Eingebung, eine Brillantbrosche von ihrem Kleide: „Mein liebes, braves Kind – zum Andenken an eine alte Frau, die Sie sehr gern hatte.“
Draußen vor dem Hause staute sich die Menge. Als Dorothea aus dem Seiteneingang trat, brach ein Jubeln aus, ein Hoch- und Hurrarufen – „Auf Wiedersehen!“ – „Hierbleiben!“ Der Theaterportier hatte Mühe, ihr den Weg bis zum Wagen zu bahnen, und dann kamen zwei Feuerwehrmänner und schoben die Kränze und Blumenspenden ihr noch in das Coupé. Kaum rühren konnte sie sich und musste immer und immer wieder sich verneigen und danken.
Dabei graute sie sich vor ihrer einsamen Wohnung. Ihr war’s, als ginge der Tod noch immer in den schon halb ausgeräumten Zimmern um.
Aber als sie die Tür aufschloss, war der Korridor erleuchtet, und drinnen stand Frau von Rakolski am gedeckten Teetisch. „Du solltest, du durftest heute Abend nicht allein sein“, meinte Ihre Exzellenz. „Da habe ich mich bei dir eingeladen, und morgen bist du mein Gast. Liddy, Siddy und Piddy freuen sich schon darauf – und übrigens, nicht zu vergessen, der Fritzle auch. Ja – mein Fritzle – der wird nun auch bald gehen –“
Bis spät in die Nacht saßen sie zusammen und sprachen über Vergangenheit und Zukunft.
Auch über den Herzog. „Meine wackere Diedel, Hand aufs Herz – hast du ihn geliebt?“
Sie errötete wie ein ganz junges Ding.
„Fritzle hat mir erzählt, dass der Herr dich damals, als der Kaiser hier war, noch einmal sprach –“
Dorothea neigte den Kopf. Und dann sagte sie: „Ich würde keinem andern, antworten als dir, Tante Rakolski. Und auch dir wohl nur heute. Ja, es gab Stunden, in denen ich selber glaubte, ich liebte ihn. Aber es war doch anders. Ich hatte ihn eben nur lieb. Verstehst du den Unterschied? Darum bin ich auch leichter darüber hinweggekommen, als ich zuerst fürchtete.“ Sie sann einen Augenblick nach. „Vielleicht bin ich überhaupt nicht zu einer vollen, ganzen Liebe geschaffen – vielleicht haben die recht, die mir auch als Künstlerin das Letzte, Höchste, die große Leidenschaft, absprechen – vielleicht hängt das eine mit dem andern eng zusammen.“
Ihre Exzellenz lachte: „Wenn nur erst der Rechte kommt!“ Aber sie brach ab, als glaubte sie selber nicht, dass ihrer Diedel je der Rechte kommen könnte.
Dann sprachen sie von Minna und ihrem Sterben. Und dabei erinnerte sich Dorothea plötzlich der Brieftasche, der Minnas letzte Worte gegolten hatten. Der praktische Sinn von Tante Rakolski regte sich. Was sollte eigentlich mit Minnas kleinem Kram werden? Hatte sie Verwandte, Erben?
Sie gingen hinüber in die Kammer. Dorothea fröstelte. Das Fenster stand noch weit auf, die Herbstluft wehte kühl herein. Und auf das Sterbebett hatte eine mitleidige Hand flüchtig eine Decke gebreitet.
Alte, gute Minna –
Rührend ordentlich lagen ihre paar Sachen in der kleinen Kommode. Obenauf im obersten Fach die Brieftasche mit der Perlenstickerei auf dem Deckel. Ein altes, abgegriffenes Ding, das Minna aber als Andenken hoch und in Ehren gehalten hatte.
Dorothea hätte sie nicht anrühren mögen, aber in Tante Rakolski war die Neugier wach geworden.
Ein Bogen Papier steckte in der Hülle.
Darauf stand, mit Datum und voller Unterschrift, in ungelenken, aber deutlichen Schriftzügen:
„Gestern habe ich Nachricht erhalten, dass meine einzige Schwester in dem Herrn entschlafen ist, ohne Kinder. Ich habe weiter keine Verwandten gehabt. Darum soll meine liebe Herrin Fräulein Dorothea von Lindenbug meine Erbin sein. Das Sparkassenbuch steckt hierbei. Und ich wünsche dem lieben gnä‘ Fräulein viel Glück und Segen für das ganze Leben.“
Frau von Rakolski lächelte über die letzten Aufzeichnungen dieser rührend treuen Seele. Als sie dann die Tasche umwandte und das vergilbte Sparkassenbuch fand und die Schlusssumme las, erstarb das Lächeln, und die Tränen traten ihr in die Augen.
Es waren gegen dreitausend Mark, die sich Minna in ihrem langen, fleißigen Leben erspart hatte.
„Du bist ein Stehauf!“ hatte einst Frau von Lindenbug zu Dorothea gesagt, als sie noch die kurzen Backfischkleider trug.
„Was ist das, Mama: ein Stehauf?“
„Einen Stehauf – kennst du den nicht? Drüben in der Servante steht solch Ding – ich will er dir zeigen.“
Es war ein Gläschen mit rund geschliffenem Boden und einer eigentümlichen Schwergewichtsverteilung. Wie man es auch hinlegen mochte, es richtete sich immer wieder von selber auf. Die Urgroßmütter liebten solche Scherze; in der Biedermeierzeit, als man noch zu Wagen nach Karlsbad reiste, brachte wohl jeder Kurgast seinem Herzensschatz einen „Stehauf“ aus den böhmischen Bädern mit.
Ein Stehauf also sollte Diedelchen gewesen sein. Und Dorothea wartete nun sehnsüchtig darauf, ob sich das Mutterwort auch noch jetzt an ihr bewähren würde – nun, in Berlin.
Sie hatte ja eigentlich allen Grund, mit ihrer bisherigen Laufbahn zufrieden zu sein. Es gab nicht viele unter ihren Kolleginnen, die gleich schnell „hochgekommen“ waren.
Wie im Fluge war es gegangen: die kleine Provinzialbühne, das mittlere Stadttheater, das Gemarer Hoftheater – und nun die erste Bühne im Deutschen Reich. Die erste – mindestens die vornehmste. Und auf allen Stufen hatte sich freudiger, herzlicher Beifall eingestellt, war der Erfolg nicht ausgeblieben. Die vereinzelten Missklänge waren stets verhallt, in der großen „Versenkung“ des Vergessens verschwunden.
Trotzdem, es wollte Dorothea mit dem „Stehaufsein“ nicht recht glücken. Seit Gemar war etwas zerbrochen in ihr. Die feste frohe Zuversicht, der Glaube an sich selbst war erloschen. Und wie sie ihn auch anzufachen suchte, die Asche wollte nicht so recht zünden.
Vielleicht täuschte sie sich, oft nannte sie sich ungerecht: ihr war’s, als wehte ihr aus den Berliner Verhältnissen eine eigen kühle, fast frostige Luft entgegen. Man empfing sie nicht gerade unfreundlich, aber man empfing sie wie eine Fremde. Sie selber empfand: Du wirst gleich einem Eindringling angesehen.
Sie hatte auch bei Karl Oskar Braune ihren Besuch gemacht, und der Theatergewaltige führte sie sofort seiner kleinen, gestrengen Gebieterin zu. Frau Mechthildis war eitel Wonne. Schon am nächsten Tage musste Dorothea in der wunderschönen Villa in der vornehmen Rauchstraße speisen: ganz im engsten Kreise, hieß es – und es wurde ein Diner von zwanzig Personen. Der einzige Bekannte aber unter diesen Direktoren, Kritikern, dramatischen Dichtern, Kollegen, Kolleginnen war – Edgar Maurer.
Er hatte schon in Gemar in den letzten Monaten das frühere gute Einvernehmen mit Dorothea wiederherzustellen versucht; mit einem leichten Scherz das eine Mal, mit einer verhüllten Abbitte zum zweiten Mal. „Sie wissen doch, Gnädigste, wie Schleiermacher das Wesen der Eifersucht umschreibt? Er sagt, dass sie mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Ich habe die tiefe Wahrheit dieses Wortes erkannt –”
Dorothea war nicht auf seine Bemühungen eingegangen. Er hatte sie zu sehr verletzt in ihrer Frauenehre, in ihrer weiblichen Würde. Auch heute blieb sie kühl und abweisend. Man hatte sie bei Tisch zusammengesetzt, wohl weil man sie für befreundet hielt; aber sie wich der Unterhaltung mit ihm aus, so sehr sie nur konnte, und wandte sich ihrem Nachbar zur Rechten zu, Herrn Rollinder, dem Dramaturgen des „Deutschen Theaters“, der der jungen, stolzen Schönheit vom ersten Augenblick an huldigte. Er würdigte sie eines sehr langatmigen Einblicks in seine Auffassung der Regie Shakespearescher Dramen. „Der große Dichter ist der tiefste Kenner der geheimnisvollen Natur“, sagte er unter anderm. „Darum müssen wir von der Bühne herab die Steine zum Publikum sprechen und die Bäume zu ihm reden lassen. Die Natur muss lebendig werden –”
„Und wir armen Schauspieler?“ fragte sie dazwischen.
„Der wahrhafte Künstler hat sich dem Ganzen unterzuordnen. Auch er ist nur ein Mittel zum Zweck. Und der höchste Zweck ist die Stimmung. Stimmung, meine Gnädigste!“
Er setzte mit einem Ruck den Kneifer fester auf die Nase. „Stimmung ist alles!“ Dabei trank er ein Glas Sekt nach dem andern und fischte sich aus dem Entensalmi nur die Trüffelstücke heraus, wahrscheinlich auch, um in die rechte Stimmung zu kommen.
Nachher nahm Frau Mechthildis ihren jüngsten Gast zur Seite, in ihr Allerheiligstes, ein kleines, mit rosa Siede ausgespanntes, in rosa Licht getauchtes Boudoir.
Es ging nicht ab ohne einen Kuss auf die linke und den zweiten auf die rechte Wange.
„Was habe ich mich immer für Sie interessiert, Sie wunderschönes, Sie liebes Menschenkind. Über Ihre Erfolge in Gemar – in meiner einzig geliebten Vaterstadt. Ich weiß alles – alles weiß ich: Sie brauchen mir gar nichts zu sagen –”
Frau Mechthildis war in der Zwischenzeit noch puppenhafter geworden, aber auch noch „völliger“, und da sie sich bedenklich schnürte, so wurde ihr oft der Atem kurz. Sie unterbrach sich dann, schnaufte in paarmal wie ein Kinderlokomotivchen, blinzelte und spann ihr Garn weiter.
„Sie edles Mädchen! Oh ich, die ich so vielfach in den Sumpf schauen muss, ich weiß es zu ehren, wenn eine meines Geschlechts sich rein erhielt unter den tausend Gefahren, die die Bühne bietet. Sie sind stark und fest gewesen, mein liebes, liebes Fräulein von Lindenbug. Wie oft habe ich Ihrer gedacht, und immer wieder habe ich Karl Oskar eingeschärft: vergiss mir unsre Lindenbug nicht. Nun – nun – hat er’s nicht erreicht, hat er’s nicht gut gemacht? Ja, Exzellenz Hülsen gibt etwas auf uns –”
Das Kinderlokomotivchen strömte wieder Dampf aus, und dann ging die Fahrt ein Stückchen weiter.
„Nun haben wir Sie endlich hier. Wie habe ich mich gefreut. Es gibt eben Menschenkinder, die man vom ersten Augenblick an liebhat. Und nun müssen sie recht viel bei uns, bei mir sein. Ich bin ja so einsam, mitten in dieser großen, weiten, flutenden Welt. Ja – kommen Sie nur immer zu mir, auch wenn Sie einmal mühsam und beladen sind. Das wird ja nicht ausbleiben. Leicht wird man es Ihnen hier gewiss nicht machen. Ich weiß ja – ich weiß ja.“
Noch nicht zwei Worte hatte Dorothea erwidern können. Sie saß neben Frau Mechthildis auf einem ganz winzigen, rosaroten Sofa und musste all den Redeschwall über sich ergehen lassen, unsicher, was an dem Überschwang der Empfindungen echt – ob überhaupt etwas daran echt war.
„Haben Sie sich bei Tisch gut unterhalten? Ja, mit Rollinder – ich sah es. Ein geistreicher Mann, aber zu modern, viel zu modern. Von unsern alten, guten Gemarer Traditionen hält der selbstverständlich gar nichts. Es muss immer etwas Neues sein, und das Neueste ist ihm immer das Beste und das einzig Richtige, weil’s eben neu ist. Ja – aber mit Maurer habe ich Sie eigentlich gar nicht sprechen sehen –”
„Ich weiß – ich weiß. Natürlich, wenn man so viel zusammengearbeitet hat, mag einem, sozusagen, der Gesprächsstoff dünner werden. Wir hätten daran denken können. Oder – oder – haben sie etwas gegeneinander? Nein – nun, das beruhigt mich. Denn, wissen Sie, ganz unter uns gesagt, ich möchte mir den Edgar Maurer nicht als Gegner wünschen. Ein bedeutender Künstler, ohne Zweifel, aber ein Fuchs.“
„Aber das ganz unter uns, liebes, liebes Fräulein von Lindenbug. Karl Oskar würde mich sonst umbringen. Ja – und nun müssen wir wohl nach vorn. Grünfull wollte noch spielen, und die Wyß-Smoller soll uns eins ihrer Kinderlieder singen. Haben Sie die schon gehört? Herzig, sage ich Ihnen, herzig –”
Der große Grünfull meisterte sein Cello wunderbar, und Frau Wyß-Smoller sang wirklich herzig. Aber in der Seele Dorotheens wollte heute keine Begeisterung aufkeimen.
Und sie kam auch nicht in der nächsten Zeit.
Vor allem fehlte Dorothea die Beschäftigung. Sie war bisher, seit dem ersten Tage, an dem sie die Bühne betreten, fast immer „im Dienst“ gewesen: war sie nicht am Abend beschäftigt, so brachte der Tag sicher Proben, und des Memorierens und Studierens war kein Ende. Nicht selten hatte sie sich nach mehr Ruhe, nach einer Periode des Ausspannens gesehnt. Nun hatte sie die Ruhe – mehr als genug! Man sandte ihr keine Rolle, man – man verlangte nicht nach ihr.
Zuerst hatte sie es nicht so unangenehm empfunden. Da nahm das Wohnungssuchen ihre Zeit in Anspruch, und als sie endlich eine kleine Wohnung im Westen gefunden hatte, suchte sie eine Zofe, und als sie die gefunden hatte – ein frisches Ding mit hellen Augen –, erkannte sie sehr bald, dass „Fräulein Sophie“ zwar sehr schön reden, aber sonst gar nichts konnte. „Gute, alte Minna!“ Wie oft hatte sie diese Worte in den letzten Wochen in tiefer Dankbarkeit vor sich hingesagt, als das Häuflein quittierter Rechnungen vor ihr wuchs und wuchs.
Auch die Zeit des Einrichtens und Einlebens ging vorüber, und – keine Rolle kam. Es war, als sei sie vergessen. Als sie einmal zum Oberregisseur ging, um sich zu beschweren, lächelte der hohe Herr gnädig: „Nur Geduld, Fräulein von Lindenbug. Wir sind ja noch in der stillen Saison.“
Doch auch als die ersten Neueinstudierungen, ja als eine Novität, eines der unvermeidlichen Salonlustspiele, an die Reihe kam, erhielt Dorothea keine Rolle. Wieder ging sie zum Oberregisseur, und wieder lächelte er: „Ja, Fräulein von Lindenbug, bei unserm riesigen Personal! Ich bitt‘ Sie, jedes Rollenfach ist ja bei uns dreifach, vierfach besetzt. Aber nur Geduld, nur Geduld! Exzellenz hat Sie nicht vergessen.“
Langsam und öde schlichen die Tage. Und wenn Dorothea anfangs gern, fast an jedem Abend, in die Schauspielerloge gegangen war oder sich ein Billet in einem andern Theater erwirkt hatte, so verlor auch das bald seinen Reiz. Ihr war’s, als flüsterten die Kolleginnen hinter ihrem Rücken: „Mal wieder eine, die man um ihrer Schönheit willen engagiert hat, und nun getraut man sich nicht, sie herauszubringen, wozu wohl gute Gründe vorliegen werden.“
Einmal, als sie ihre Gage in Empfang nahm, traf sie Maurer. Er war wieder sehr verbindlich, fast zu artig: „Aber man sieht Sie ja gar nicht, gnädiges Fräulein!“
Sie zog die Achsel hoch, und ein bitteres Lächeln wollte sich nicht unterdrücken lassen. „Ich habe es schlechter getroffen, als Sie, Herr Maurer. In jeder Woche sah ich Sie ein paarmal – mich scheint man kaltstellen zu wollen.“ Sie war ehrlich genug, ihre Überzeugung nicht zu verschweigen.
„Übrigens gratuliere ich Ihnen zu Ihrem neulichen Mortimer. Wir alten Gemarer können stolz sein auf diese Leistung.“
Es lohte über sein Gesicht. „Fanden Sie mich wirklich gut? Ich danke Ihnen – lang ist’s her, dass ich eines freundlichen Wortes von Ihnen gewürdigt wurde. So tut es mir doppelt wohl.“
Sie gingen zusammen aus dem Hause und einige hundert Schritt die Charlottenstraße hinauf. Und Dorothea hatte die Empfindung, während sie mit ihm sprach: endlich doch mal wieder ein Mensch! So vereinsamt war sie. Es schien ihr selbst fast, als wäre die Stunde des Ausgleichs mit Maurer gekommen. Anschlussbedürftig, hilfsbedürftig, wie sie geworden, sehnte sie sich nach einer Hand, die sich ihr entgegenstreckte. Sie wusste ja, es bedurfte nur noch eines liebenswürdigen Wortes ihrerseits. Vielleicht hätte sie auch diese Scheu überwunden, wenn er nicht unvorsichtig gewesen wäre.
„Wo wohnen Sie eigentlich, gnädiges Fräulein?“
Sie nannte Straße und Nummer.
Er schwieg ein paar Augenblicke, um dann plötzlich zu sagen: „Wann darf ich Sie einmal besuchen?“
„Herr Kollege, ich kann keinen Herrenbesuch empfangen.“
Die Anwandlung, die über sie gekommen, war schon mit seiner Frage und Antwort erloschen.
Maurer lachte scharf: „Aber, ich bitt‘ Sie. Wir sind doch vom Bau! Und einst, einst hab‘ ich Sie doch in Ihrem Heim aufsuchen dürfen – im schönen Neumöller.“
„Da lagen die Verhältnisse noch anders, Herr Maurer. Hier – nein!“
Er sah sie wieder an, und sie fühlte förmlich die herausfordernde Ironie seines Blickes.
„Fräulein von Lindenbug, kennen Sie das Dichterwort: Wer sich der Einsamkeit ergibt, ist bald allein?“
„Jawohl – ich kenne es. Aber ich werde auch in der Einsamkeit ‚ich’ bleiben.“
„Ein stolzes Wort. Und dennoch: Sie brauchen einen Menschen. Sie kommen allein nicht zum Ziel.“
Dorothea war stehengeblieben. Unauffällig, als warte sie auf die elektrische Bahn. Um ihre Lippen spielte wieder ihr stolzestes Lächeln.
„Meinen Dank, Herr Kollege – ah, da kommt ja endlich mein Wagen.“
Ganz kurz neigte sie den Kopf zum Abschied.
Aber dann, als sie in der Ecke ihres Wagens saß, stieg es heiß in ihr auf. Ein Gefühl lastender Ungewissheit, der Sorge fast, überkam sie. Sie wusste nur zu gewiss, sie hatte sich einen Mann, der einst ihr Bundesgenosse war, zum Feinde gemacht. Und dennoch: wenn sie sich selber fragte, wie sie anders hätte handeln sollen, sie hätte nicht Rat gewusst.
Denn hinter den scheinbar harmlosesten Worten Maurers stand immer ein Wunsch, der für sie gleichbedeutend mit schwerster Beleidigung war.
Und wieder schlichen die Tage. Nicht, dass Dorothea es nicht gegeben gewesen wäre, sich selbst zu beschäftigen. Sie hatte ja ihre Bücher, sie liebte die Kunst, wurde eine fleißige Besucherin der Museen, belegte einige Vorträge in der Universität, andre in der Humboldtakademie. Nein, die Langeweile brauchte sie nicht zu fürchten. Nur unter dem Überfluss an freier Zeit litt sie. Über zwei Monate durfte sie sich jetzt Mitglied des Königlichen Schauspielhauses nennen und war noch nicht einmal aufgetreten.
Sie las sehr viel, las auch die Tageszeitungen. Und da stieß sie eines Morgens auf den Namen Ludolf von Kastrop. Die himmelhohe Jugendleidenschaft für den Bruder war mehr und mehr in den Hintergrund ihres Fühlens gerückt, war zu einer schönen Erinnerung geworden, verklärt durch seinen Heldentod. Die Neigung der reiferen Blütezeit, die ihr Gemar gebracht, hatte sie selbst erstickt, und dass das ohne schwere Schmerzen möglich gewesen, bewies ihr immer aufs Neue, wie es eben nur Neigung, nicht Liebe gewesen war. Für Edgar Maurer hatte sie sich wohl interessiert – aber sie schied eine Welt. Kein andrer Mann hatte Spuren in ihrem Gedenken hinterlassen. Nur Ludolf von Kastrop konnte sie nicht vergessen. Und wenn er einmal für kurze Zeit aus ihrem Gedächtnis zu verschwinden schien, immer wieder tauchte er auf. Im Wachen und auch im Träumen. Und immer wieder sagte sie sich: Dein Herz weiß nichts von ihm. Aber ich möchte die eine Begegnung mit ihm auslöschen können, die im Lesezimmer des kleinen Hotels zu Tenburg, die Viertelstunde möchte ich tilgen aus seiner und meiner Erinnerung. Denn da meinte ich groß zu sein, indem ich ihn beleidigte, und ich war doch nur klein und armselig.
So saß sie und sann über das Zeitungsblatt hinweg, bis sie dann endlich wirklich las und fand, was seinen Namen in das Blatt gebracht hatte.
Es erstaunte sie nicht: er war Landtagsabgeordneter. Es würde sie auch nicht erstaunt haben, wenn sie gehört oder gelesen hätte, dass er Unterstaatssekretär, Minister geworden wäre, oder dass er in irgendeinem fernen Weltteil eine große Entdeckung, oder dass er eine Erfindung von der höchsten Bedeutung gemacht hätte.
Für morgen stand eine ihm angeregte, von seiner Fraktion eingebrachte Interpellation auf der Tagesordnung: „Welche Stellung gedenkt die Regierung einzunehmen zur Sicherung des bedrohten Deutschtums in der Nordmark?“
Politik hatte Dorothea eigentlich nie interessiert. Auch diese Interpellation interessierte sie wenig. Das war Männersache. Gerade dass sie wusste, ganz im Allgemeinen, worum es sich handelte: um die Frage „Deutsch oder Dänisch“ für das nördliche Schleswig.
Aber ganz jäh schoss in ihr der heiße Wunsch auf, ihn Ludolf von Kastrop, auf der Rednerbühne zu sehen, ihn zu hören, aus irgendeinem Eckchen der Zuschauerloge heraus, ungekannt und ungesehen von ihm.
Warum auch nicht? Sie hatte ja Zeit! Zeit, Zeit, Zeit, mehr als sie brauchte und wünschte.
Am Morgen des nächsten Tages fuhr Dorothea nach dem Abgeordnetenhause, schickte dem Bürochef ihre Karte und erhielt einen Platz. Das Haus war noch wenig gefüllt; ein leichtes, gleichgültiges Redegeplänkel über eine andre und wichtige Angelegenheit füllte die erste Stunde, bis dann die Stimme des Präsidenten erscholl: „Das Wort hat der Abgeordnete für Neumöller-Heide zur Begründung der Interpellation (parlamentarische Anfrage) über die Stellung der Regierung zum Schutz des bedrohten Deutschtums in Nordschleswig.“
Es gab zunächst eine starke Enttäuschung für Dorothea. Sie hatte gemeint, es müsste tiefe Stille und angespannteste Aufmerksamkeit eintreten. Nichts von alledem: die Abgeordneten schienen so wenig Interesse für diese Frage zu haben, wie für die vorher verhandelten. Sie unterhielten sich, sie standen in kleinen Gruppen beieinander, sie erledigten scheinbar auf ihren Pulten Privatkorrespondenzen.
Dann sah sie plötzlich Ludolf von Kastrops hohe Gestalt auf der Rednertribüne, sah sein scharf geschnittenes Gesicht, hörte seine klangvolle Stimme. Und schon nach seinen ersten Worten zuckte sie in freudiger Erregung zusammen, denn sie fühlte instinktiv, dass er sofort das Haus fesselte. Die summenden Gespräche verstummten, die Augen richteten sich auf den Redner.
Wuchtig sprach er, ohne sonderliches Pathos, aber mir einer Beredsamkeit, die in jedem deutschen Herzen einen Widerhall wachrufen musste. Das war der Auftakt. Dann kam die Begründung in strengster Sachlichkeit, auf ein umfassendes Studium, auf eigenste Anschauung und Erfahrung gestützt.
Ein paar Male unterbrachen den Redner heftige Zwischenrufe. Ein kleiner Lärm entstand um die Gruppe der Dänen, denen sich einige linksstehende Abgeordnete zugesellt hatten. Manchmal dachte Dorothea, das ist ja fast wie bei uns im Theater! Manchmal bangte sie um ihn. Aber sie sah dann sein ruhiges Gesicht, sah sein stolzes Lächeln und fühlte seine Überlegenheit, fühlte wieder recht deutlich: Er ist ein Mann, ein ganzer Mann!
Er sprach ziemlich lange und schloss mit kraftvollen Worten, die das Deutschtum als Kulturmacht obenan stellten und von der schlecht beratenen an die gut zu beratende Regierung appellierten. Lauter Beifall klang auf. Der Minister erhob sich und erklärte sich zur sofortigen Beantwortung bereit.
Aber was der Herr dort am Ministertisch sagte, interessierte Dorothea gar nicht. Sie wartete das Ende seiner etwas nüchternen Auseinandersetzung nicht ab. Ihr war’s, als ob eine innere Stimme riefe: „Lass dir den schönen Eindruck nicht verkümmern.“
Und so ging sie.
Für eine Episode nahm sie’s nur, aber sie freute sich des Erfolges, den am nächsten Morgen die Zeitungen konstatierten. Einen ganzen Packen Blätter kaufte sie. Es war auch fast wie bei der Theaterkritik. Es gab Nuancen, es gab Schattierungen. Aber im Allgemeinen hatte Ludolf von Kastrop, wie man bei der Bühne sagte, eine „gute Presse“. Das eine Blatt sprach von ihm als von dem „kommenden Manne“, das andre gab der Überzeugung Ausdruck, dass hier, was selten geschehe, sich schon in der „Jungfernrede“ der „geborene Parlamentarier“ gezeigt habe. In der Kreuzzeitung stand ein Überblick auf seinen Lebensgang. Dorothea erstaunte, als sie las, dass Kastrop seinen Besitz nur unter großen Schwierigkeiten hätte behaupten können, dass er erst durch eine intensive Wirtschaftsführung die Herrschaft Schneeholm rentabel gemacht hätte. Einen unsrer hervorragendsten Landwirte nannte ihn die Zeitung.
Unmittelbar darauf ging der Landtag in die Weihnachtsferien, und gleichzeitig erhielt Dorothea ihre erste Rolle.
Es war wiederum eine bittere Enttäuschung.
Man mutete ihr zu, eine unbedeutende Figur in einer unbedeutenden Novität zu übernehmen. Ein Gesellschaftsfräulein, das nicht viel mehr zu tun hatte, als hübsch auszusehen und Ja und Amen zu sagen.
Zuerst wollte sie die Rolle zurückweisen. Dann biss sie die Zähne aufeinander. Es mochte vielleicht klüger sein, nicht die Schmollende und nicht die Trotzende zu spielen.
Aber schon auf der Arrangierprobe gereute sie der Entschluss. Denn da stand Maurer, der den ersten Liebhaber gab, mit ironischem Lächeln und benutzte die nächste Gelegenheit, um ihr zuzuraunen: „Wie ich das aber bedaure! Warum sind Sie nicht zu mir gekommen – ich hätte das mit Leichtigkeit anders arrangieren können. In Gemar die Iphigenie – und hier Grete Maltern!“
Sie antwortete nicht. Sie spielte. Zu machen war aus der Rolle nichts. Vielleicht war sie auch unlustig, so sehr sie sich zu beherrschen suchte. Jedenfalls aber sah sie bei den Kollegen und den Kolleginnen nur verwunderte Gesichter, und nach der Premiere wusste sie, dass der Abend für sie völlig bedeutungslos vorübergegangen war. Nur ein einziger Kritiker nahm Notiz von ihr: „Fräulein von Lindenbug, der ein guter Ruf als talentvolle Künstlerin vorausgeht, gab die Gesellschaftsdame der Gräfin. Sie ist eine blendende Erscheinung; mehr aber wüsste ich von ihr nicht zu sagen.“
„Mehr aber wüsste ich nicht zu sagen!“ Der gute Mann hatte ganz recht. Und auch die andern Kritiker wussten nicht mehr, aber meist noch weniger zu sagen, als Dorothea in den nächsten Wochen noch zu einigen geringfügigen Episodenrollen beschäftigt wurde.
Immer tiefer fraß die Bitterkeit in ihrer Seele. Im Gefühl ihrer Ohnmacht ging sie zu Karl Oskar Braune und fragte ihn um Rat. Doch auch der Theatergewaltige zuckte die Achseln: „Geduld, Geduld! Geduld ist ein Wunderkräutlein. Ihre Zeit wird schon noch kommen. Oder wollen Sie fort? Torheit – ich bitt‘ Sie. Schauen Sie doch in Ihren Kontrakt! Wollen Sie die zehntausend Mark Konventionalstrafe zahlen? Nur solche Sachen nicht tragisch nehmen. Stecken Sie Ihre gute Gage ein – und amüsieren Sie sich. Und kommen Sie häufiger, als Sie das tun, zu meiner Frau. Dann fällt doch auch ein Strahl Ihrer Sonne auf mich.“
Geduld! Ja, aber gibt es denn nicht auch für die Geduld eine Grenze.
Ein ganz kleines Weihnachtsbäumchen hatte sich Dorothea angeputzt. Aber als die Lichter brannten, sah sie tränenden Auges auf den Schimmer im Tannengrün, und langsam, ganz langsam löschte sie ein Wachskerzlein nach dem andern aus. Sie fühlte sich so namenlos einsam, so tief unglücklich, so betrogen um all ihr Hoffen, um jeden Erfolg ihres Strebens. Es fehlte nicht viel, und sie hätte die Bühne und alles, was mit ihr zusammenhing, gehasst.
Von all den Kolleginnen, die sie bisher in Berlin kennengelernt hatte, war sie eigentlich nur einer einzigen ein wenig nähergekommen, der trefflichen Gramm, der köstlichsten aller komischen Alten. Die hatte ihr ein paarmal freundlich die Hand gedrückt, hatte, als sie einmal neben ihr in der Loge saß, ein paar von Herzen kommende Worte mit ihr gewechselt.
Zwischen Weihnacht und Neujahr fasste Dorothea in ihrer grenzenlosen Verzweiflung den Entschluss, der lieben alten Dame einen Besuch abzustatten. Sie musste irgendeinem Menschen ihr Herz ausschütten.
Die Gramm saß wie ein Großmütterchen beim Kaffeetisch am warmen Ofen, freute sich des Besuchs – „solch liebe, junge Augen schau‘ ich immer gern“ –, holte eigenhändig noch eine Tasse und schnitt ein mächtiges Stück Dresdner Weihnachtsstollen ab. Aber Dorothea konnte keinen Bissen hinunterzwingen, und dann schossen ihr jäh die Tränen aus den Augen. Wie ein Kind schluchzte sie.
Und wie ein Mütterchen hörte ruhig die alte Gramm zu, bis der Anfall vorüber war. „Weinen Sie sich nur aus, Kind. Das tut immer am wohlsten.“ Als sich Dorothea endlich gefasst hatte und um Entschuldigung bat und gehen wollte, fasste die Greisin sie, wie sie’s nannte, „am Schlafittchen“ und hielt sie fest: „Tränen sind gut, aber sich aussprechen ist die höhere Weisheit. Heraus also mit der Sprache!“ Etwas eigen Resolutes hatte sie, die alte Gramm, die nun an die sechzig Jahre auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stand und nimmer müde wurde.
So kam es, dass Dorothea sich aussprach. Ganz offen, ganz rückhaltlos. Und die Greisin nickte dann und wann und schüttelte den weißen Kopf.
„Ja, mein gutes Kind, “ sagte sie endlich, „das ist das geliebte, das vermaledeite Theater. Hol’s der Geier – aber es ist doch über alle Beschreibung schön. Und wer das rechte Theaterblut hat, der kommt über alles Schwere, über alle Enttäuschungen weg, weil ihn eben die Stunde – Sie verstehen schon, die eine Stunde, wo er in das große dunkle Loch starren darf, wenn der Vorhang hochgegangen ist – weil ihn die eine Stunde für alles entschädigt. Fragt sich nur, ob Sie das rechte Theaterblut haben? Ich sah Sie ja nur in den kleinen Rollen, über die Sie so unglücklich sind, ja – aber unsereiner hat so sein eignes Urteil auch solch geringen Aufgaben gegenüber! Und sehen Sie, ich fand Sie immer verständig, klug, im Vollbesitz aller äußeren Mittel – nur ohne das rechte Temperament. Ruhig, mein Kind, ruhig! Wollen’s mal abwarten, vielleicht täusch‘ ich mich auch –
Ja, und dann dürfen Sie nicht gleich alles für bösen Willen halten. Der Chef hat Sie, wenn ich recht unterrichtet bin, als Ersatz für die Listler engagiert, die damals sehr krank war, so dass man an ihrem Aufkommen zweifelte. Nun aber ist sie wieder kreuzgesund und puppenlustig und würde Exzellenz die Augen auszukratzen versuchen, wenn er ihr auch nur eine Rolle fortnehmen wollte. Und dann: bei uns ist nun mal Überfluss an Personal. Und dann: Berlin ist nicht Gemar, Gemar ist nicht Berlin. Und dann – und dann – und dann: ich könnte die Reihe noch lange fortsetzen. Schließlich aber kommt’s doch immer auf dasselbe heraus, auf den alten Erfahrungsgrundsatz: wir ‚Speelersleute’, ob wir nun in Buxtehude oder in Berlin auftreten, müssen immer auf einen Glücksfall warten. Der kommt – oder der kommt nicht. Mancher stirbt darüber. Sie, Kind, Sie sind ja noch so jung – Sie können wirklich warten.“
So wartete Dorothea also –
Aber manchmal dachte sie doch über die Trostworte der guten, alten Gramm nach: ich hab‘ wohl nicht das rechte Theaterblut, sonst müsste mir auch das Warten leichter werden. Und öfter noch kam es über sie wie tiefe Sehnsucht: sie wusste selbst nicht recht, wonach?! Nach einem stillen Erdenwinkel, in dem es liebe Menschen gab und täglich neue Pflichten, denen man gern nachlebte; nach dem Handdruck eine steilnehmenden Freundes, nach ein paar guten, klugen Worten, nach einem heiteren Lachen.
Das heitere Lachen wenigstens sollte ihr früher erklingen, als sie selber gehofft.
Mit flinken jungen Schritten kam es die Treppe herauf, schellte gar kräftiglich, brauste in den Korridor, sauste in das Zimmer –
„Da sind wir, Gret‘ und Bert! Da hast du uns, geliebtes Diedelchen, wie freu‘ ich mich! Gleich lass dich mal anschauen –”
„Jawohl, da haben Sie uns, Gret‘ sowohl wie den Bert. Der möchte Sie nämlich auch anschauen dürfen, Fräulein Doro – Fräulein Diedel, können wir nicht sofort wieder Mariage à la Goethe spielen. Ich –“
„Wirst du wohl!“ fiel ihm die Schwester ins Wort.
„Ist das eine Art, mit einer Königlichen Hofschauspielerin umzugehen! Respekt, mein Junge! Hat sich was zu mariagen. Gell, wir heiraten überhaupt nimmer, wir modernen Frauen!“
„Bis halt der Rechte kommt. Jawohl – das kennen wir, Jungfer Naseweis aus Brochum –“
Zum Mitreden kam Dorothea zunächst gar nicht. Wollte auch gar nicht. Wollte nur rechts und links die treuen Hände drücken, wollte die jungen Stimmen und das helle, frohe Rheinländerlachen hören.
„Vater lässt grüßen. Hotel Bristol – fein, fein! Wir haben nämlich Konferenzen, Diedel, mit Großbanken, wir sollen nämlich gegründet werden.“
„Wir wollen aber nicht gegründet werden, es sei denn –“
„Es sei denn, dass es heidenmäßig viel Moneten gibt.“
„Lass du doch bloß Fräulein von Lindenbug mit dem Geschäft zufrieden, das ist Männersache. Und richt‘ lieber dein Sprüchlein aus!“
„Ja – also! Vater lässt herzlichst grüßen, die ‚Unvergessliche’ nämlich. Und Vater hat uns geschickt – gestern sind wir erst angekommen –, um dich in ein Auto zu packen und zu entführen.“
„Jawohl: zu entführen. Das erste vernünftige Wort, Gret‘, was heute über deine Korallenlippen kommt.“
„Und zwar gleich musst du mit uns kommen. Denn wir haben natürlich den Zettel nachgesehen – du spielst ja heute nicht, du hast also wohl Zeit.“
„Ja, Gret‘, ich hab‘ Zeit. Viel, viel Zeit. Kinder, wie freue ich mich! Pardon, Herr Bert – das Kinder bezog sich nur auf Gret‘.“
„Ich will aber meinen Teil auch haben. Das ist mir eine schöne Art, erst geben und dann nehmen.“
„Aber, Herr Dr. Ing., ich hab‘ doch solchen Respekt vor Ihnen.“
„Ach was – Respekt! Erlauben Sie mir wenigstens, dass ich noch einmal in kindlicher Verehrung die schönste aller Frauenhände küsse.“
Das Scherzen hatte bei diesen fröhlichen Menschenkindern kein Ende. In ihrem Ankleidezimmerchen, während sie schnell das Kleid wechselte, hörte Dorothea immerfort ihr übermütiges Lachen, und auch im Auto flogen die Worte wie beschwingte Federbälle herüber und hinüber.
Wie das wohl tat!
Und dann war sie plötzlich in einem großen Hotelsalon, und der alte Herr Wignam kam mit ausgestreckten Händen auf sie zu. Und jenseits stand, mit dem Rücken an eine Kredenz gelehnt – Ludolf von Kastrop.
Das Blut flutete ihr jäh ins Gesicht.
Und auch über sein Gesicht zuckte es.
Aber sie fühlte sofort: heute ist es an dir, gutzumachen. Lösch‘ das eine aus deiner und seiner Erinnerung! Dass es tot ist und vergessen.
Sie trat an ihn heran und reichte ihm die Hand. Dorothea sprach kein Wort, aber sie wusste: er musste sie auch ohnedem verstehen.
Und er verstand sie.
Etwas Hinterlist von der jungen Rheinlandsbrut war doch im Spiel gewesen. Sie waren so hellhörig, die beiden, so geschickt im Kombinieren. Aus halben Worten, aus halben Andeutungen nur hatten sie’s sich zusammengereimt, dass es zwischen Kastrop und Dorothea etwas auszugleichen gab, ein Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Und da nun Bert mit Kastrop von Schneeholm aus zufällig herübergekommen war, da Kastrop auch im Hotel Bristol wohnte, da gestern Abend noch die Bekanntschaft mit Papa Wignam zustande gekommen war, so schmiedeten die beiden ihr Komplöttchen, und was bei andern täppisch gewesen wäre, ihnen glückte es.
Vielleicht freilich hatten sie sich etwas ganz, ganz andres gedacht. Vielleicht waren sie enttäuscht, dass es zu gar keiner dramatischen Szene kam. Vielleicht dachten sie aber auch: was nicht ist, kann ja noch werden.
Vorläufig freilich saßen die, um welche sie ihre listigen Fäden geschlungen, als zwei sehr ernsthafte Menschen bei Tisch, und für den Übermut musste das Geschwisterpaar allein sorgen. Denn dem alten Herrn Wignam mochte das Geschäft, das ihn nach Berlin führte, doch gewaltig im Kopf herumgehen. Er war schweigsamer, als es sonst seine Art war.
Aber Gret‘ und Bert lachten und redeten und wollten, dass mindestens Dorothea auch mit ihnen täte. Mit dem Lachen: das brachten sie nicht fertig. Doch berichten und erzählen: ja, das gelang ihnen. Nur dass das auch wieder ernster wurde, als Gret‘ und Bert wohl geglaubt hatten. Denn Dorothea konnte nicht anders, sie musste hier offen sein. Offen und ehrlich, gerade hier, gerade jetzt. Sie fühlte zwei Augen auf sich ruhen, die das verlangten – durchdringend klare, ernste Augen, die keinen Lug und keine Eitelkeit duldeten.
Doch als sie dann gesagt hatte, was sie zu sagen hatte von all den Enttäuschungen der letzten Zeit, da kam der Champagner, und Papa Wignam hob sein Glas: „Solche Tage machen wir alle durch, Fräulein von Lindenbug. Solche Tage schmerzen, aber sie sind des Lebens beste Lehrmeister. Und wer sie sich richtig zu deuten versteht, dem bringen auch sie Glück. Auf Ihr Glück, auf eine frohe Zukunft, liebes Fräulein von Lindenbug, wollen wir unsre ersten Gläser leeren!“
Auch Kastrop stieß mit ihr an. Ihre Hand zitterte ganz leise. – Die junge Rheinlandsbrut jubelte: „Hoch soll sie leben! Hoch – dreimal hoch!“
„Ich erkenne Ihren Herrn Sohn gar nicht wieder, “ sagte Kastrop lächelnd zu dem alten Herrn. „Bei mir war er immer nur der ernste Fachmann. Nein, das ist nicht ganz richtig: ein ernster Mann überhaupt.“
„Ja – so ist unsre Jugend am Rhein. Ernst und froh, wie die Stunde es beut. Und so ist’s uns Alten recht, waren wir doch selber auch nicht anders.“
„Ich habe eine so schwere düstere Jugend gehabt, dass ich mich kaum erinnere, damals je fröhlich mit den Fröhlichen gewesen zu sein. Aber heute geht mir das Herz auf, wenn ich frohes Lachen höre.“
Er sah hinüber zu den Jungen und sah dann auf Dorothea. Aber ihr schönes Gesicht war ernst wie das seine.
Dann mischte sich Bert in das Gespräch. Er fragte: „Wann sprechen Sie wieder im Reichstag, Herr von Kastrop? Vater hat Ihre große Rede gelesen und möchte Sie gern hören.“
„Es wird in den nächsten Wochen kaum zu Redeschlachten kommen, denn der Etat steht auf der Tagesordnung.“
Nun sprach Herr Wignam von der Nordmark. Er kannte sie nicht, erbat über dies und das Aufklärung, und Kastrop stand willig Rede. Da sagte Dorothea plötzlich: „Das haben Sie damals wirklich überzeugend entwickelt, Herr von Kastrop.“
„Haben Sie meine Rede gelesen, gnädiges Fräulein?“ fragte er erstaunt.
„Ich war sogar im Hause –“
Als sie es gesagt hatte, gereute es sie, denn sie fühlte, dass sie errötete wie ein junges Ding von siebzehn Jahren.
Auf eines Atemzugs Länge sah er sie starr an. Dann neigte er ein wenig den Kopf und fuhr in seinen Auseinandersetzungen fort. –
Es wurde ziemlich spät, als man endlich aufbrach. Albert Wignam holte Dorotheens Mantel aus der Garderobe. Er bestand darauf, sie „durch alle Fährnisse der Weltstadt“ sicher nach Hause zu geleiten.
Bis in das Vestibül ging Kastrop mit. Und während Albert sich um eine Droschke bemühte, fragte er mit einem jähen Entschluss, wie Dorothea empfand: „Was führte Sie ins Abgeordnetenhaus, gnädiges Fräulein?“
Die Frage hatte wieder etwas Ungewöhnliches an sich, etwas ganz Unverbindliches, fast Herrisches. Aber sie wirkte heute nicht mehr verletzend auf Dorothea, wie einst.
Nur peinlich war ihr die Antwort. So zögerte sie. Aber dann brach die Empfindung übermäßig in ihr durch: Du darfst nicht lügen! Du musst die Wahrheit sagen!
„Ich wollte Sie sprechen hören, Herr von Kastrop.“
„Also – Neugier?“
Da sagte sie heiß: „Warum tun Sie mir weh? Ich habe Ihnen doch vorhin so vieles stumm und still abgebeten. Nein – nicht aus Neugier. Wahrhaftig nicht. Ich wollte – ich wollte Sie kennenlernen. Ich wollte auch damit gutmachen –“
Zur Antwort kam er nicht. Denn gerade jetzt erschien Albert Wignam wieder.
Nur auf ihre Hand neigte sich Kastrop. Dann wandte er sich schnell und ging den breiten Gang nach den Fahrstühlen entlang.
Wignam hatte eine schweigsame Fahrtgenossin, und all sein Humor verfing nicht recht. Erst als er von Kastrop und von Schneeholm zu erzählen begann, horchte Dorothea auf, fragte auch ein paarmal dazwischen und brach wieder jäh ab, wenn Albert den Majoratsherrn mit jugendlicher Begeisterung rühmte: seine Energie, seine Umsicht, seinen rastlosen Fleiß, seine soziale Fürsorge. –
Einmal, fast am Ziel der Fahrt, fasste sich Albert ein Herz: „Gestrenge, Gütige – sind Sie der Gret‘ und mir auch nicht böse?“
Da wehrte sie heftig ab: „Nein! Nein! Wie können Sie das nur glauben!“ und sank wieder in ihr Schweigen zurück. Aber auf ihren Lippen lag ein ganz, ganz leises Lächeln.
Und es kam die Nacht, und es kam der Morgen.
In der Nacht hatte Dorothea einen lieblichen Traum. Aber als der trübe Wintermorgen in ihr Zimmer schien, wusste sie nichts mehr von dem Traum, und ihr graute vor dem Tag. Es würde ein Tag werden, wie alle andern jetzt, und ihm würden weitere Tage folgen, bleifarben wie der dort draußen – und der Zufall, der sie gestern mit Ludolf von Kastrop zusammengeführt, kehrte gewiss nie wieder.
Manchmal scherte sie zusammen: ja, was war das denn? Weshalb sehnte sie denn solch einen Zufall herbei? Ihn sehen, ihn sprechen? Sie liebte ihn doch nicht! Es war ja Torheit. Sie hatte ihn achten gelernt – sie bewunderte ihn – sie hatte ihr Unrecht eingesehen – sie – sie –
Doch dann kam immer wieder etwas ganz Neues über sie, etwas nie Geahntes, nicht zu Begründendes, nimmer zu Definierendes. Etwas, worüber man auch gar nicht nachsinnen durfte. Nein – nein, nicht nachsinnen! Sich dort drüben in den Lehnstuhl setzen, der noch von Mütterchen stammte, ganz tief hinein, und die Augen schließen und warten – vielleicht kam doch der Traum wieder –
Manchmal schrak sie dann auf. Er ist so herrisch – ich glaube, er könnte nie bitten. Er ist so herb, ich glaube, er will mich demütigen. Aber ich will gebeten sein! Gebeten – Ludolf – Und wieder sanken die Lider herab – und der Traum kam – und sie lächelte selig –
Und da lag ja wohl die Morgenzeitung. Ob etwas darin stand von ihm? Wo sind denn nur die Verhandlungen des Abgeordnetenhauses versteckt? Immer das Wichtigste bringen diese Redakteure an den heimlichsten Stellen unter. Ach so – hier. Auf der Tagesordnung steht der Etat des Finanzministeriums – nein, so etwas Langweiliges – Nur Zahlen, Zahlen und nochmals Zahlen – Und hier, darüber: aus Gemar? Große Freude im ganzen Ländle, der Herzog verlobt! Guter August-Otto! Ich konnte dir doch nun einmal das Glück nicht bringen – In meinem Herzen lagen wohl schon unbewusst andre Keime – aber ich wünsche dir viel Glück und Segen – und eine Glückliche wünscht dir Glück –
Draußen schellt es –
Nein! Nein! Er kommt nicht. Das ist nicht seine Art.
Aber zusammengezuckt war Dorothea doch, und mit einem Male ganz wach und ganz klar.
Ein Rohrpostbrief. Eine etwas zittrige Damenhandschrift darauf:
Gnädiges Fräulein!
Mein Neffe Kastrop bittet Sie durch mich um eine
Unterredung in meinem Hause. Wenn Sie keine andre Zeit
bestimmen, würden wir Sie um zwei Uhr nachmittags erwarten. Wollen Sie liebenswürdigerweise das Ungewöhnliche dieser Bitte mit den besonderen Verhältnissen entschuldigen. In ausgezeichneter Hochachtung
Ihre ergebenste
Klara von Zielendorf, Fasanenstr. 8
Da war wieder der leise Schauer bei dem sicheren Gefühl: Der Brief ist nach seinem Diktat geschrieben! Der Mann stand dahinter mit dem festen, dem fast herrischen Willen.
Es tat weh – und es tat doch wohl –
Aber bitten musst du mich, Ludolf! Bitten musst du mich –
Ein kleiner, altjungfräulicher Salon.
Die alte, zierliche Dame mit weißen Haaren, weiß wie die Mullvorhänge an den Fenstern, ist soeben hinausgerauscht.
Dorothea steht an dem winzigen Schreibtisch. Das Herz ist ihr schwer und beklommen. Die frohe Zuversicht ist im Wanken. Es war doch wohl nur ein Traum.
Und die Tür wird geöffnet.
Kastrop hat ein ernstes Gesicht. In der Hand hält er ein Paket Briefschaften. Er verbeugt sich ehrerbietig.
„Meinen Dank, gnädiges Fräulein, dass Sie groß genug dachten, meine Bitte zu erfüllen. Ich glaube, Ihnen eine Erklärung zu schulden – Ihnen und mir. Es wird nicht in zwei Minuten abzumachen sein. Wollen Sie nicht gütigst Platz nehmen?“
Er blieb stehen.
„Gnädiges Fräulein, in unsrer ersten unglücklichen Unterredung erwähnte ich nur kurz meinen armen Bruder. Sie schnitten mir damals das Wort ab – ich gestehe heute, dass Sie recht hatten, dass ich die denkbar unglücklichste Form gewählt hatte. Ohne es zu wollen, habe ich Sie schwer verletzt. Ich bitte Sie um Verzeihung. Sie haben mich für einen hartherzigen Bruder gehalten, vielleicht halten müssen. Und doch waren Sie in einem Irrtum befangen. Ich habe meinen Bruder sehr, sehr geliebt, ich habe für Konrad mehr Opfer gebracht, als ich vor mir selber verantworten durfte. Die Beweise wollen Sie, wenn es Ihnen beliebt, aus diesen Briefen ersehen. Sie werden daraus auch erkennen, dass mein bedauernswerter Bruder bei allen glänzenden Eigenschaften leider ein Mann ohne festen Charakter war, ohne Halt, unzuverlässig – ein Verschwender. Sie werden auch sehen, dass – aber ersparen Sie mir, Ihnen das alles weiter auszuführen. Der Tod hat gesühnt, und an uns ist es nicht, zu richten.“
Er hatte rasch hintereinander gesprochen, wie um eine Unterbrechung auszuschließen. Nun legte er die Briefe auf den Tisch vor Dorothea.
Das Herz tat ihr weh zum Brechen. Sie stöhnte schmerzlich auf.
Nein und tausendmal nein! Sie konnte diese herbe, herrische Art nicht tragen – und wenn ihr Glück darüber noch einmal in Scherben ging!
Mit einem jähen Entschluss schob sie die Schriftstücke zur Seite.
„Was sollen mir diese Briefe, Herr von Kastrop?“ sagte sie vorwurfsvoll. „Ich glaube Ihnen alles – ich –“ Sie stockte. Und plötzlich sprang sie auf – nur beseelt von dem einen Gedanken: Fort! Fort von hier! Und blieb doch und schlug die Hände vor das Gesicht und schluchzte laut auf.
Da fühlte sie zwei Männerhände, die ganz sanft die ihren lösten.
„Fräulein von Lindenbug“, hörte sie, „weinen Sie um den Verstorbenen? Ihm ist wohl –“
Sie schüttelte den Kopf. Sie wollte sprechen, wollte ihm sagen – sagen – was wollte sie ihm doch sagen? So viel – so viel – und brachte doch kein Wort hervor.
„Es musste das eine klar zwischen uns werden. Schmerzte es so sehr?“ Seine Stimme klang nun gar nicht mehr hart.
Wieder schüttelte sie den Kopf.
„Können Sie jetzt verstehen, wie ich es damals meinte – in meiner ungeschickten Art – dass ich es gut meinte, wenn ich auch in der Form fehlte?“
Da sah sie ihn an. Und sie neigte den Kopf.
„Dorothea – es ist heute wie damals und ist doch wohl ganz anders – “ Er hatte noch immer ihre Hände nicht freigegeben, hielt sie in den seinen, und die schlossen sich fester und fester um sie. „Ich habe in meinem Leben nicht viele Übereilungen begangen, damals aber war ich verblendet und unklug. Wir sind heute wohl beide ruhiger, sind innerlich freier und weiter. Mein Herz empfindet wie damals – Dorothea, ich bitte Sie – Dorothea, ich liebe Sie –“
Und nun klang der Glockenton in seiner Stimme wie schwingendes Erz, und plötzlich fühlte sie, dass er ihre Hände freiließ, aber sie im gleichen Atemzug umfasste und an sich zog. Und sie lag an seiner Brust. Wie heute Morgen im Traum – und er hatte ja gebeten, der harte, herrische, der geliebte Mann –
Der Frühabend dämmerte. Da hielt im stiebenden Schnee der Wagen vor Dorotheens Tür. Kastrop sprang heraus, half seiner Braut aussteigen, und sie huschten durch die weißen Flocken in den Hausflur, nur zu einem letzten Abschiedswort für heute, zu einem seligen: „Auf Morgen!“
Aber gerade als sie hinter der Glastür standen, kam ein Depeschenbote hinter ihnen drein, pochte an die Portierloge, fragte etwas und kam dann auf Dorothea zu: „Fräulein von Lindenbug?“
Ein Rohrpostbrief. Kastrop lachte – oh, wie merkwürdig fröhlich konnte er doch lachen! „Sieh‘ einmal an – da steht ja in der Ecke ‚Königliche Angelegenheit’. Wir sind ja gewaltig vornehm.“
Sie riss den Umschlag auf. Es wallte über ihr Gesicht. Und dann reichte sie ihrem Bräutigam das Blatt: „Lies – bitte.“
Er las:
„Fräulein Liftler plötzlich wieder erkrankt. Ersuchen Sie morgen die Julia zu übernehmen. Probe ist elf Uhr. Drahtantwort erbeten. Königliches Schauspielhaus.
Dorothea sah in sein Gesicht, sah, wie seine Augenbrauen sich zusammenzogen, wie die zwei schweren, finsteren Falten sich noch tiefer in seine Stirne gruben.
„Du willst es nicht?“ fragte sie bebenden Herzens.
Er faltete das Blatt zusammen und schob es in den Umschlag.
„Ich sagte dir schon, es ist mein Wunsch, dass du nie – nie wieder auftrittst –“
„Ludolf – aber daran habe ich gar nicht gedacht: ich bin ja kontraktlich verpflichtet.“
„Kontrakte lassen sich lösen.“
„Ja – aber ich muss eine hohe Konventionalstrafe zahlen – zehntausend Mark.“ Es kam ganz verzagt heraus.
Da lachte er, und es war wieder das frische Lachen, das sie heute schon so oft gehört hatte: „Du liebes Kind! Dazu wird schon noch Rat werden!“
„Ludolf, es demütigt mich. Ich bin ja so arm wie eine Kirchenmaus.“
„Was mein ist, ist dein. Kein Wort darüber, ich bitte dich – du schreibst also ab?“
Sie rang mit sich. Es war ein schwerer Kampf. Dann neigte sie den Kopf. „Um deinetwillen, Ludolf –“
Seinem scharfen Auge war ihr Ringen nicht entgangen.
„Liebe Dorothea“, sagte er warm. „Es wurde dir sehr schwer. Ich danke dir doppelt. Aber warum wurde es dir eigentlich so schwer? Nach dem, was du gestern, bei Wignams, sagtest, hab ich wirklich angenommen, dass die große Leidenschaft für die Bühne, wenn ich’s so ausdrücken darf, bei dir längst erloschen ist.“
„Es ist so, Ludolf, “ gab sie lebhaft zurück. „Aber du, sollst immer die ganze Wahrheit von mir wissen: sieh‘, ich habe hier Enttäuschung auf Enttäuschung erlebt. Man hat mich auf jede Art zurückgesetzt, als ob ich eine Anfängerin wäre. Und nun plötzlich die Julia. Ich darf sagen, eine meiner besten Rollen. Sei gerecht! Ist es nicht menschlich erklärlich, dass der heiße Wunsch in mir aufstieg, einmal noch, gerade nur dies eine Mal noch ihnen allen zu zeigen, dass ich doch etwas kann. Es wäre ein schöner Abschied für mich gewesen. Doch du hast entschieden, und ich füge mich – ohne Bitterkeit. Ja, das Opfer erscheint mir jetzt schon so klein gegen all deine Güte und Liebe.“
Sie hatte seine Hand ergriffen und hielt sie fest. Er sah ihr tief in die Augen. Auch in ihm, war nun der schwere Kampf. Doch nur auf ein paar Atemzüge. Dann nickte er ihr zu und lächelte: „Da hätte ich wahrhaftig beinahe aus purem Fanatismus dir die Freude verdorben. Warum soll ich dir den Triumpf nicht gönnen? Selbstverständlich spielst du, und ich werde dich noch einmal auf der Bühne sehen und werde tüchtig Beifall klatschen – und dann – nicht wahr, Dorothea, dann ist Schluss! Der Vorhang sinkt – und ein neues Leben beginnt!“
Neugierige Gesichter auf der Probe. Ein Zischeln und ein Tuscheln, ein Aufschauen dann und ein Aufhorchen. „Ausgezeichnet!“ raunte Romeo – Edgar Maurer – einmal. „Geben Sie’s ihnen, zeigen Sie’s ihnen. Doch endlich wieder meine alte Partnerin!“ Allmählich wuchs das Interesse bei den Kollegen zum Staunen. Wer hätte das gedacht? Und dabei gab sich die Lindenbug augenscheinlich gar nicht mal ganz aus. Markierte freilich nicht, aber hielt doch zurück, wie ein guter Spieler seine besten Trümpfe. Wenn das die Liftler sehen könnte, sie würde bis heute Abend noch gesund!
„Sehr gut, Fräulein von Lindenbug, “ meinte nach der großen Balkonszene der Geheimrat und putzte sich den Kneifer. „Hm – man kennt sich doch nicht aus. Beim Theater kommt eben immer alles anders.“
Schließlich pochte die alte, gute Gramm an die Garderobentür: „Gratuliere, liebes Fräulein von Lindenbug. Gratuliere und revoziere: Sie haben ja doch Theaterblut! Prächtig Ihre Julia. Schauen Sie, da haben wir halt den Glücksfall, von dem ich immer gesprochen habe – den Glücksfall –“
Und dann kam der Abend. Und da kam doch das große Herzpochen wieder: Wird’s dir auch gelingen? Wirst du’s auch gutmachen? Wirst du sie packen und fortreißen? Den ganzen Nachmittag hatte sie memoriert und wieder memoriert – nun war doch die Sorge da: fehlen dir auch keine Zwischenglieder? Und dann war über allem andern die größte Sorge da –eine Sorge, die eine unendliche Seligkeit in sich schloss: heute sieht er dich, heute hört er auf dich, heute musst du ihm gefallen, heute wirst du ihm, ihm allein das Hohelied der Liebe spielen.
Hoch rauschte der Vorhang. Noch einmal sah Dorothea in das gewaltige, schwarze Loch, und es durchschauerte sie.
Und nun hob das Spiel an und ward ein Singen und Triumphieren, von Szene zu Szene wachsend. Wie diese Julia selber wuchs von Szene zu Szene!
Einmal sah sie Kastrop. Und ihr war’s, als leuchteten seine Augen.
Edgar Maurer –
Ja, war der Mann denn toll? Vielleicht noch nie hatte er den Romeo so glänzend gespielt, so hinreißend, so leidenschaftlich.
Aber was bildete er sich ein? Er spielte ja mit ihr, als wäre –
Auch das war ein kleiner Triumph in dem großen, eine Revanche: „Mäßigen Sie sich ein wenig, Herr Kollege! Dass Sie es nur wissen – in der Fremdenloge links sitzt mein Bräutigam – ich bin seit gestern die Braut des Freiherrn von Kastrop auf Schneeholm –“
Ein Raunen war’s nur, in einer Szene stummen Spiels, und dann ging der Akt weiter. Aber sie sah, dass Edgar Maurer unter der Schminke erbleichte, dass er seine Zähne aufeinanderbiss – sie hörte, wie er stockte, auf den Souffleur lauschen musste.
Was tat’s?
Sie spielte ja nur mit Edgar Maurer, sie spielte nicht für ihn. Ihre Julia galt dem geliebten Manne dort in der Loge – allein ihm galt das Hohelied der Liebe –
„Willst du schon gehen? Der Tag ist noch so fern.
Es war die Nachtigall und nicht die Lerche,
Die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang.
Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort.
Glaub‘, Lieber, mir, es war die Nachtigall –“
Und nun sank der Vorhang zum letzten Male, nachdem ein Beifall, wie er in diesem Hause selten ist, Romeo und Julia wieder und wieder vor die Rampe gerufen.
Die Kollegen und Kolleginnen umringten Dorothea, nur Edgar Maurer stand abseits. Es war ein Glückwünschen, als ob der deutschen Schauspielkunst eine neue Größe entdeckt worden wäre. Der alten, guten Gramm standen die Tränen in den Augen: „Und da hab‘ ich ihr gesagt, sie hätte kein rechtes Theaterblut –“
Dorothea aber gedachte der klugen Worte, die einst der Herzog in Gemar ihr im kleinen Teesalon gesagt. Jetzt erst verstand sie ganz, was er gemeint. Und jetzt wusste sie, was ihr bisher gefehlt, und was ihr nun plötzlich geworden war, wie eine Offenbarung, für heute, wo sie zum letzten Male auf der Bühne stand: das Feuer der Leidenschaft, die große, heilige Flamme.
Es war doch ein schöner, ein herrlicher Abschied – und ihre Seele war voll Dank, dass sie diese Weihestunden noch gehabt.
Dann, als sie die Garderobe verließ, traf sie auf Karl Oskar Braune. Er, der überall Zutritt hatte, musste aus sie gewartet haben. Meine Mechthildis ist einfach hingerissen. Ja – und was haben Sie mir neulich gesagt? Dass Sie fort wollen. –
Machen wir. Denken Sie sich: Direktor Schlenther war im Hause. Ist begeistert. Ich habe schon alles eingefädelt: Wiener Hofburgtheater. Nun, wie stehe ich da? Mein Auto wartet unten, wir fahren zu Adlon, und in einer Stunde –”
„Lieber Herr Geheimrat, erschrecken Sie nicht: ich bin heute zum letzten Male aufgetreten. Seit gestern bin ich die Braut des Herrn von Kastrop auf Schneeholm. Aber Dank – Dank und schönste Grüße an Ihre Frau Gemahlin!“
Und nun stürmte die die Treppe herunter.
Unten stand Ludolf.
In seine Arme flog sie hinein, an seine Brust. Und sie jubelte ihm zu: „Nun nimm mich, Ludolf! Ade, du bunte Welt! Nun gehöre ich dir, Ludolf, nur dir und unserm Glück!“.
Ende