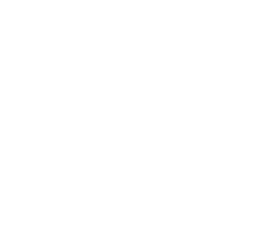Mit dem Kochlöffel
Eine Geschichte aus dem Preisausschreiben „Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt“
Wer mehr Informationen zum Preisausschreiben von 1905 lesen möchte, kann hier weiterlesen.
Als mein Mann starb, war ich so blutjung, dass ich fast ebenso nötig eines Vormundes bedurft hätte wie mein zweijähriger blonder Junge. Aber selbst dieser hatte nur einen „dem Namen nach“. Zu verwalten gab’s nichts, und danach zu fragen, wie die gesunden, weißen Zähnchen täglich zu ihrem allernötigsten Brot kämen, ist ja nicht Pflicht des Vormundes. Und es war einer, der gewissenhaft seine Pflicht, aber auch nur diese, tat.
Hinterlassen hatte mir mein Mann nichts, gar nichts, kein Barvermögen, keine Rente oder Pension, nur unsere bescheiden hübsche Einrichtung, die gerade zur Bestreitung der Kranken- und Begräbniskosten zureichte und einen kleinen, ganz kleinen Notpfennig für allerschlimmste Zeiten ergab. So stand ich, knapp zwanzigjährig, allein mit dem Kinde da, auf meine eigene Erwerbskraft angewiesen. Und ich war aus vornehmer, plötzlich verarmter Familie und hatte viel, ach, gar so viel gelernt, nur eben nicht — arbeiten! — Dass ich mich von meinem Jungen nicht trennen würde, stand bei mir fest, und dieser „Eigensinn“ verscherzte mir auch noch das letzte Restchen fürsorglicher Gunst des Herrn Vormunds, der Willi irgendwo in Pflege geben wollte und mir eine ganz annehmbar bezahlte Stelle als Gesellschafterin verschafft hatte, „Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen“ — damit tröstete er sein Gewissen.
Ich nahm mir also ein Zimmerchen bei einem kinderlosen Ehepaar und verlegte mich aufs Stundengeben: Englisch, Französisch, auch Musik und Malen, was gerade verlangt wurde, vorzügliches leistete ich in nichts, und die Stunden wurden auch gerade nur so bezahlt, dass ich bei angestrengtester Tätigkeit mein und Bubis Leben fristen konnte.
Etwas ersparen für jene Zeit, wo Willis Erziehung mehr kosten und meine Leistungsfähigkeit einmal durch Krankheit geschwächt würde, war ganz unmöglich. Das bereitete mir viele Sorgen und schlaflose Nächte. Aber vergebens sann und grübelte ich nach — mir wollte kein lohnender Erwerb, dem ich gewachsen war, einfallen. So vergingen zehn Jahre — zehn Jahre überreich an Entbehrung, Kummer und sorgenden Zukunftsgedanken. Willi lernte brillant, und unser beider höchster Wunsch war, ihn studieren zu lassen, woher aber die Mittel dazu nehmen?
Stipendien waren für uns so gut wie ausgeschlossen, da mein Mann ein Ausländer (Rumäne) gewesen war; auch war unser Herr Vormund gar nicht von der Notwendigkeit durchdrungen, Willi studieren zu lassen, dass er sich irgendwelche Mühe darum hätte geben sollen. Handwerker, Handelsangestellte müsste es auch geben, und — was für seine unbegabten, faulen Jungen gut genüg war, warum sollte das nicht auch für den Sohn einer armen Sprachlehrerin genügen?
Ich sann und grübelte, da kam mir unerwartet und ungesucht eine Antwort und Lösung, an die ich am wenigsten gedacht hatte. Ein sehr reiches amerikanisches Ehepaar hatte für einige Wochen Aufenthalt in unserem Städtchen genommen. Eine Fußverletzung der Frau hatte sie dazu gezwungen, und nun wollten sie diese unfreiwillige Rast ausnützen, sich etwas in der deutschen Sprache zu vervollkommnen. Ich wurde ihnen empfohlen und täglich für eine Stunde engagiert. Trotz ihres durch den Mund der Leute ins Fabelhafte gesteigerten Reichtums nur zu dem ortsüblichen Preis. Ein richtiger Amerikaner zahlt keinen Heller mehr, als er zahlen muss. Es sei denn, er — schenkt.
Und geschenkt nehmen — nein, so weit war’s mit Willis Mama noch lange, lange nicht! In Grammatik ließ sich in der kurzen Spanne Zeit wenig erreichen; erst beschränkten wir uns auf Konversation, plauderten über dies und das. Was Wunder, dass da auch nach und nach etwas von meiner Lebenslage zur Sprache kam! Mr. Wentig machte ein sehr nachdenkliches Gesicht. Die Brillengläser auf der Stirn sah er mich lange scharf und prüfend mit seinen kalt beurteilenden Kaufmannsaugen an. — „Where is a will, there is a way — ich wüsste auch Ihnen Rat, vorausgesetzt, dass Sie die Fähigkeiten besäßen, um die es sich handelt. Können Sie gut, sehr gut kochen?“ Ich glaube, noch nie in meinem Leben habe ich einen Menschen so verblüfft angeschaut wie den grauköpfigen, kleinen Amerikaner. „Kochen? — Sie — Sie meinen doch nicht etwa — das ist ganz und gar ausgeschlossen, Köchin — ich, die Tochter eines Bergdirektors, Witwe eines Offiziers“ . . . „Ja, wenn Sie auf dem Standpunkt stehen, dann allerdings“ . . . und seelenruhig setzte er die Lektion fort, die wir gerade als Übung angefangen hatten.
Auch ich kam an diesem und dem nächsten Tage auf das Thema nicht mehr zurück. Mein Wunsch, meinen über alles geliebten Jungen zu etwas Tüchtigem zu erziehen, war aber viel zu mächtig, um mich nicht doch über die Sache nachgrübeln zu lassen. Am dritten Tage fing ich von selbst davon an. „Sie sprachen neulich von — von Kochen. Das kann ich nun wirklich gut, vorzüglich. Papa war ein Feinschmecker und hielt darauf, immer das Beste, Feinste auf seiner Tafel zu sehen. Ich hatte Lust und Geschick dazu — mehr Talent, leider, als zu all den andern Dingen, mit denen ich mir nun mein Brot verdienen muss. Aber — mich als Köchin verdingen geht doch nicht. Das bedeutet überdies auch eine Trennung von Willi und brächte mir noch nicht so viel ein wie der „Posten einer Erzieherin oder Gesellschafterin“.
Mr. Wentig fixierte mich wieder: „Let us see — wie viel Gage bekommt so ein Girl per Monat? „Immerhin 50—60 Kr. bei verhältnismäßigem Glück nur; allerdings ist sie dann verpflichtet“ . . . „Sich von früh bis abends zu schinden, weiße Sklavin — all right, ich verstehe. Und mit 50—60 Kr. könnten Sie Ihrem Jungen auch verflucht wenig nützen. — Als Köchin, vorausgesetzt, dass Sie Ihre Sache wirklich verstehen, garantiere ich Ihnen 150—200 Kr. per Monat. Und — wohlverstanden, ohne Überanstrengung.“ Ich war sprachlos. war so etwas möglich? „Ja aber wo — wie?“ . . . „In Europa allerdings nicht, dort erreicht kaum eine Hotelköchin diese Monatsgage und muss noch ihre Gesundheit in einer Weise zusetzen, dass sie nicht länger als 10, 15 Jahre ‚beim Fach’ bleiben kann. Sie müssten sich also entschließen, zu uns zu kommen. Ich bin sonst der letzte, der Europäer und Europäerinnen zum Auswandern animieren möchte — dass bei uns leichter als hier Geld zu verdienen ist, ist längst eine Mär geworden. Mehr vielleicht — aber auch nur für entsprechend größere Leistungen.
Nur eine Berufsklasse kann Zuzug brauchen, die, im Verhältnis zu hier, geradezu königlich honoriert wird: brave, tüchtige Hausmädchen, vor allem Köchinnen. Von unseren Großmillionären, die sich ein oder auch mehrere Köche halten, sehe ich ganz ab — es gibt aber so reich gesäte ‚Klein Millionäre’ bei uns, die sich mit einer Köchin ‚behelfen‘, der sie gut und gern das Gehalt eines mittleren österreichischen Staatsbeamten bewilligen und von ihr nur beanspruchen, dass sie unter der Beihilfe etlicher Küchenmädchen den Mittags- und Abendtisch (dinner and supper) besorgen. Dass in solchen Häusern auch die ‚Nebeneinnahmen‘ — ich spreche nicht von den bei uns zulande unbekannten Trinkgeldern — einer Köchin nicht zu unterschätzen sind, versteht sich wohl von selbst.“
Mir schwindelte fast. „Ja, aber — eine solche Stellung erreichen — ohne Empfehlung, ohne Zeugnisse“, stammelte ich verwirrt, Zu drei Vierteln schon dem Vorschlag geneigt. — Mr. Wentig lächelte wieder sein skeptisches Amerikanerlächeln. „Empfehlungen, Zeugnisse — Humbug, als ob die auch nur einen Deut was wert wären! Ich könnte Ihnen ja mit leichter Mühe einen feinen Posten besorgen, so dass Ihnen die Überfahrt schon bezahlt würde. Dann müssten Sie sich aber auf mindestens ein Jahr binden — das ist nicht zu empfehlen. Riskieren Sie die Überfahrt aus Eigenem, gehen Sie zu dem einen oder dem anderen Platzierungsinstitut, das ich Ihnen nennen werde, und bei Ihrem vertrauenerweckenden Auftreten, Ihrer Sprachkenntnis garantiere ich Ihnen sofortige Stellungen zu 150—200 Kr. die Menge. Dann können Sie sich mit leichter Mühe ‚einen Namen‘ machen und Ihre Ansprüche gewaltig in die Höhe schrauben. Die Nachfrage ist eine enorme, so dass selbst sehr mittelmäßige Kräfte noch Gehälter erzielen, von denen sich hier die perfekteste Kochkünstlerin nichts träumen lässt.“
Wozu noch viele Worte! Ein Weilchen noch Schwanken und Überlegen, ein Nachrechnen des „Notgroschens“, ob er zur Überfahrt 2. Klasse für Bubi und mich reichen würde, ein Päckchen Briefe und Adressen meines einzigen Bekannten in der Neuen Welt, Mr. Wentigs, und wir schnürten unser Bündel und traten die Reise an. Dass unsere berühmten österreichischen Kochbücher in meinem Reisegepäck nicht fehlten, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Schon am zweiten Tage fand ich eine Stellung mit 200 Kr. Monatsgehalt und der Versicherung der Hausfrau, meine „Nebeneinkünfte“ würden die Höhe von 50—100 Kr. gewiss erreichen. Über diese Sanktionierung des „Körbelgeldes“ war ich sehr erfreut; ohne sie hätte ich in meiner Ehrlichkeit meiner Lady wahrscheinlich einen netten Begriff von der „grenzenlosen Naivität“ einer Österreicherin beigebracht. Ich hatte mein hübsches, eigenes Zimmer, in dem mich Willi besuchen konnte, so oft und solang es seine Zeit gestattete. Dass er die Mahlzeiten nicht bei mir einnahm, entlockte meiner Herrschaft ein mitleidiges Lächeln.
Dabei wurde ich mit der ausgesuchtesten Höflichkeit, die dort überhaupt mehr zu Hause ist, als man anzunehmen pflegt, behandelt, „Mrs. N. N.“ tituliert, gerade so wie meine Dame „Mrs. O. O.“ genannt wurde, und als ich nach einem Jahr weder kündigte noch mit einer Lohnsteigerungsforderung heran trat, erhöhte man mir freiwillig mein Gehalt. Vielleicht hätte ich es in einem anderen Hause noch weiter gebracht, denn ich hatte es wirklich verstanden, mir „einen Namen“ zu machen, und die „dinners“ im Hause O. erfreuten sich eines gewissen Renommees; aber ich war zufrieden, die Einkünfte reichten, da ich weder trank noch mir einen kostspieligen Liebsten hielt, was die Hauptgründe sind, dass viele Mädchen selbst mit diesen glänzenden Bezügen knapp oder gar nicht reichen, und ich hatte mich an meine kühl-freundliche Mrs. O. O., die ich höchstens ein- bis zweimal wöchentlich sah, gewöhnt.
Zwölf Jahre blieb ich in ihrem Hause, dann war mein Junge mit seinem technischen Studium fertig und trat eine Stellung als Bergingenieur in Norwegen an. Da zog es auch mich in die alte Heimat. Einige „Notgroschen“ hatten sich längst wieder eingefunden, mein Sohn unterstützt mich. Dass ich so glücklich bin, das Geld nicht zu brauchen, sondern es für ihn sparen kann, ahnt er nicht — und ich habe eine Kochschule eröffnet, die mir ein angenehmes, gesichertes Einkommen bietet.
Ich darf mich jetzt mit knapp 45 Jahren schon einer gewissen Bequemlichkeit hingeben und brauche nicht mehr so ängstlich mit dem Kreuzer zu rechnen wie früher. Schenkt mir Gott noch einige Jahre der Rüstigkeit und Arbeitskraft, so hoffe ich meinem Sohne nicht nur niemals zur Last zu fallen, sondern ihm dereinst ein kleines, rundes Erbteil hinterlassen zu können. Und trotz Kochlöffel und Küchenschürze bin ich die Dame geblieben, die ich war. Niemand versagt mir die Achtung, die jedem gebührt, der tapfer und ehrlich den Existenzkampf auf sich nimmt.
Ein paar Bemerkungen zur Geschichte:
Es war wohl so, dass es für junge Frauen, deren Mann (oder Vater) gestorben war, einen Vormund gab, meist ein Verwandter. Diese Vormünder werden in Erzählungen (ob nun -wie hier wahre Geschichten oder auch erfundene) meist negativ dargestellt – sie waren zur Unterstützung da, teilweise war wohl auch ihre Zustimmung zu bestimmten Handlungen erforderlich. Die gewünschte Unterstützung, insbesondere auch finanzieller Art, hielt sich meist in Grenzen – so auch hier.
In Österreich-Ungarn war die Währung damals Kronen (hier Kr abgekürzt) und Heller. Eine Krone entsprach ca. 85 Pfennig.
„Körbelgeld“ (oder Korbgeld) war das Geld, was die Bediensteten vom Einkauf übrig behielten, wenn sie geschickt handelten (und so einen Teil des erhaltenen Geldes „sparten“). Anscheinend durften sie diesen Betrag, d.h. wie hier erzählt, in Amerika offiziell selbst behalten. In deutschen Erzählungen entsteht der Eindruck, dies war bei Bediensteten nicht gerne gesehen und eigentlich nicht erlaubt.
Wenn Euch die Geschichte gefallen hat, hier sind weitere schon veröffentlichte Geschichten aus dem Preisausschreiben bzw. Buch davon „Vor den wirtschaftlichen Kampf gestellt“:
„Die Lithographin“ , „Vom Sprachunterricht zum Kunstgewerbe“ , „Ein Besorgungsinstitut“ , „Die Lehrerin“
„Mit eigenem Anbau zum Erfolg“ , „Der Lebensgang einer Schriftstellerin“ und „Am Telefon„